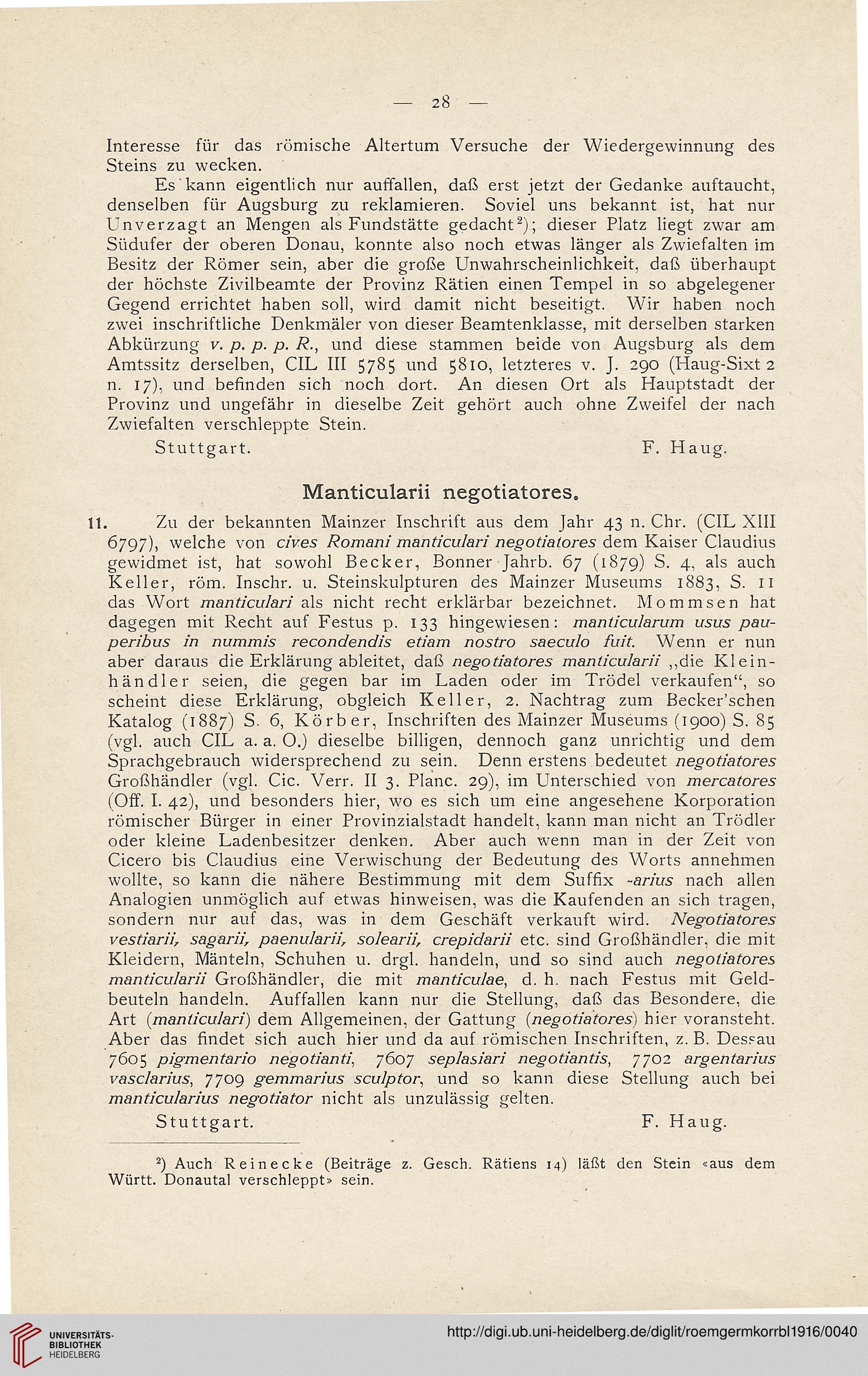28
Interesse für das römische Altertum Versuche der Wiedergewinnung des
Steins zu wecken.
Es kann eigentlich nur auffallen, daß erst jetzt der Gedanke auftaucht,
denselben fiir Augsburg zu reklamieren. Soviel uns bekannt ist, hat nur
Unverzagt an Mengen als Fundstätte gedacht 2); dieser Platz liegt zwar am
Südufer der oberen Donau, konnte also noch etwas länger als Zwiefalten im
Besitz der Römer sein, aber die große Unwahrscheinlichkeit, daß überhaupt
der höchste Zivilbeamte der Provinz Rätien einen Tempel in so abgelegener
Gegend errichtet haben soll, wird damit nicht beseitigt. Wir haben noch
zwei inschriftliche Denkmäler von dieser Beamtenklasse, mit derselben starken
Abkürzung v. p. p. p. R., und diese stammen beide von Augsburg als dem
Amtssitz derselben, CIL III 5785 und 5810, letzteres v. J. 290 (Haug-Sixt 2
n. 17), und befinden sich noch dort. An diesen Ort als Hauptstadt der
Provinz und ungefähr in dieselbe Zeit gehört auch ohne Zweifel der nach
Zwiefalten verschleppte Stein.
Stuttgart. F. Haug.
Manticularii negotiatores.
11. Zu der bekannten Mainzer Inschrift aus dem Jahr 43 n. Chr. (CIL XIII
6797), welche von cives Romani manticulari negotiatores dem Kaiser Claudius
gewidmet ist, hat sowohl Becker, Bonner Jahrb. 67 (1879) S. 4, als auch
Keller, röm. Inschr. u. Steinskulpturen des Mainzer Museums 1883, S. 11
das Wort manticulari als nicht recht erklärbar bezeichnet. Mommsen hat
dagegen mit Recht auf Festus p. 133 hingewiesen : manticularum usus pau-
peribus in nummis recondendis etiam nostro saeculo fuit. Wenn er nun
aber daraus die Erklärung ableitet, daß negotiatores manticularii ,,die Klein-
händler seien, die gegen bar im Laden oder im Trödel verkaufen“, so
scheint diese Erklärung, obgleich Keller, 2. Nachtrag zum Becker’schen
Katalog (1887) S. 6, Körber, Inschriften des Mainzer Museums (1900) S. 85
(vgl. auch CIL a. a. O.) dieselbe billigen, dennoch ganz unrichtig und dem
Sprachgebrauch widersprechend zu sein. Denn erstens bedeutet negotiatores
Großhändler (vgl. Cic. Verr. II 3. Planc. 29), im Unterschied von mercatores
(Off. I. 42), und besonders hier, wo es sich um eine angesehene Korporation
römischer Bürger in einer Provinzialstadt handelt, kann man nicht an Trödler
oder kleine Ladenbesitzer denken. Aber auch wenn man in der Zeit von
Cicero bis Claudius eine Verwischung der Bedeutung des Worts annehmen
wollte, so kann die nähere Bestimmung mit dem Suffix -arius nach allen
Analogien unmöglich auf etwas hinweisen, was die Kaufenden an sich tragen,
sondern nur auf das, was in dem Geschäft verkauft wird. Negotiatores
vestiarii, sagarii, paenularii, soiearii, crepidarii etc. sind Großhändler, die mit
Kleidern, Mänteln, Schuhen u. drgl. handeln, und so sind auch negotiatores
manticularii Großhändler, die mit manticuiae, d. h. nach Festus mit Geld-
beuteln handeln. Auffallen kann nur die Stellung, daß das Besondere, die
Art (manticulari) dem Allgemeinen, der Gattung (negotiatores) hier voransteht.
Aber das findet sich auch hier und da auf römischen Inschriften, z. B. Dessau
7605 pigmentario negotianti, 7607 sepiasiari negotiantis, 7702 argentarius
vasclarius, 7709 gemmarius sculptor, und so kann diese Stellung auch bei
manticularius negotiator nicht als unzulässig gelten.
Stuttgart. F. Haug.
2) Auch Reinecke (Beiträge z. Gesch. Rätiens 14) läßt den Stein «aus dera
Württ. Donautal verschleppt» sein.
Interesse für das römische Altertum Versuche der Wiedergewinnung des
Steins zu wecken.
Es kann eigentlich nur auffallen, daß erst jetzt der Gedanke auftaucht,
denselben fiir Augsburg zu reklamieren. Soviel uns bekannt ist, hat nur
Unverzagt an Mengen als Fundstätte gedacht 2); dieser Platz liegt zwar am
Südufer der oberen Donau, konnte also noch etwas länger als Zwiefalten im
Besitz der Römer sein, aber die große Unwahrscheinlichkeit, daß überhaupt
der höchste Zivilbeamte der Provinz Rätien einen Tempel in so abgelegener
Gegend errichtet haben soll, wird damit nicht beseitigt. Wir haben noch
zwei inschriftliche Denkmäler von dieser Beamtenklasse, mit derselben starken
Abkürzung v. p. p. p. R., und diese stammen beide von Augsburg als dem
Amtssitz derselben, CIL III 5785 und 5810, letzteres v. J. 290 (Haug-Sixt 2
n. 17), und befinden sich noch dort. An diesen Ort als Hauptstadt der
Provinz und ungefähr in dieselbe Zeit gehört auch ohne Zweifel der nach
Zwiefalten verschleppte Stein.
Stuttgart. F. Haug.
Manticularii negotiatores.
11. Zu der bekannten Mainzer Inschrift aus dem Jahr 43 n. Chr. (CIL XIII
6797), welche von cives Romani manticulari negotiatores dem Kaiser Claudius
gewidmet ist, hat sowohl Becker, Bonner Jahrb. 67 (1879) S. 4, als auch
Keller, röm. Inschr. u. Steinskulpturen des Mainzer Museums 1883, S. 11
das Wort manticulari als nicht recht erklärbar bezeichnet. Mommsen hat
dagegen mit Recht auf Festus p. 133 hingewiesen : manticularum usus pau-
peribus in nummis recondendis etiam nostro saeculo fuit. Wenn er nun
aber daraus die Erklärung ableitet, daß negotiatores manticularii ,,die Klein-
händler seien, die gegen bar im Laden oder im Trödel verkaufen“, so
scheint diese Erklärung, obgleich Keller, 2. Nachtrag zum Becker’schen
Katalog (1887) S. 6, Körber, Inschriften des Mainzer Museums (1900) S. 85
(vgl. auch CIL a. a. O.) dieselbe billigen, dennoch ganz unrichtig und dem
Sprachgebrauch widersprechend zu sein. Denn erstens bedeutet negotiatores
Großhändler (vgl. Cic. Verr. II 3. Planc. 29), im Unterschied von mercatores
(Off. I. 42), und besonders hier, wo es sich um eine angesehene Korporation
römischer Bürger in einer Provinzialstadt handelt, kann man nicht an Trödler
oder kleine Ladenbesitzer denken. Aber auch wenn man in der Zeit von
Cicero bis Claudius eine Verwischung der Bedeutung des Worts annehmen
wollte, so kann die nähere Bestimmung mit dem Suffix -arius nach allen
Analogien unmöglich auf etwas hinweisen, was die Kaufenden an sich tragen,
sondern nur auf das, was in dem Geschäft verkauft wird. Negotiatores
vestiarii, sagarii, paenularii, soiearii, crepidarii etc. sind Großhändler, die mit
Kleidern, Mänteln, Schuhen u. drgl. handeln, und so sind auch negotiatores
manticularii Großhändler, die mit manticuiae, d. h. nach Festus mit Geld-
beuteln handeln. Auffallen kann nur die Stellung, daß das Besondere, die
Art (manticulari) dem Allgemeinen, der Gattung (negotiatores) hier voransteht.
Aber das findet sich auch hier und da auf römischen Inschriften, z. B. Dessau
7605 pigmentario negotianti, 7607 sepiasiari negotiantis, 7702 argentarius
vasclarius, 7709 gemmarius sculptor, und so kann diese Stellung auch bei
manticularius negotiator nicht als unzulässig gelten.
Stuttgart. F. Haug.
2) Auch Reinecke (Beiträge z. Gesch. Rätiens 14) läßt den Stein «aus dera
Württ. Donautal verschleppt» sein.