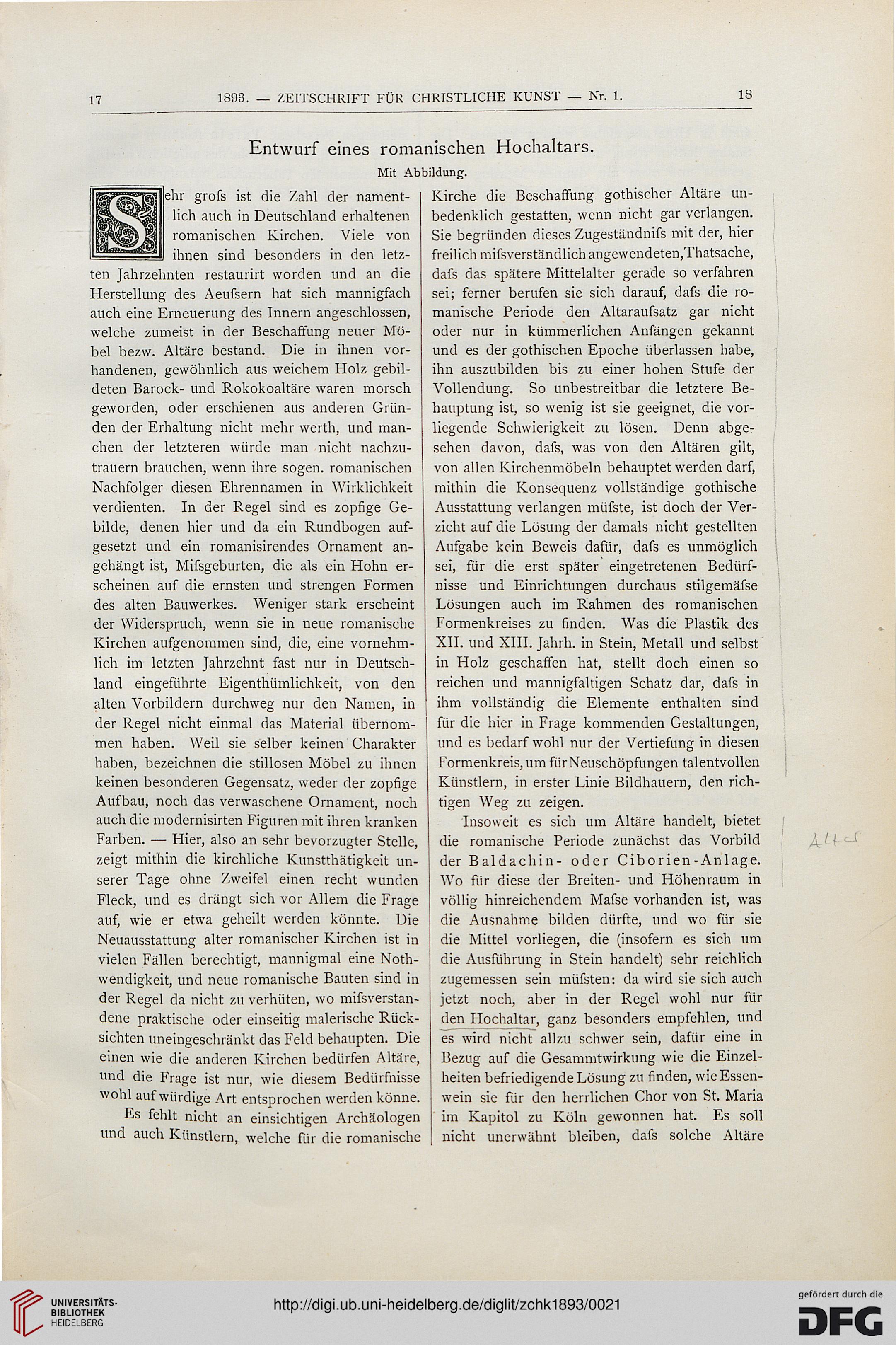17
1893. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
IS
Entwurf eines romanischen Hochaltars.
Mit Abbildung.
ehr grofs ist die Zahl der nament-
lich auch in Deutschland erhaltenen
romanischen Kirchen. Viele von
ihnen sind besonders in den letz-
ten Jahrzehnten restaurirt worden und an die
Herstellung des Aeufsern hat sich mannigfach
auch eine Erneuerung des Innern angeschlossen,
welche zumeist in der Beschaffung neuer Mö-
bel bezw. Altäre bestand. Die in ihnen vor-
handenen, gewöhnlich aus weichem Holz gebil-
deten Barock- und Rokokoaltäre waren morsch
geworden, oder erschienen aus anderen Grün-
den der Erhaltung nicht mehr werth, und man-
chen der letzteren würde man nicht nachzu-
trauern brauchen, wenn ihre sogen, romanischen
Nachfolger diesen Ehrennamen in Wirklichkeit
verdienten. In der Regel sind es zopfige Ge-
bilde, denen hier und da ein Rundbogen auf-
gesetzt und ein romanisirendes Ornament an-
gehängt ist, Mifsgeburten, die als ein Hohn er-
scheinen auf die ernsten und strengen Formen
des alten Bauwerkes. Weniger stark erscheint
der Widerspruch, wenn sie in neue romanische
Kirchen aufgenommen sind, die, eine vornehm-
lich im letzten Jahrzehnt fast nur in Deutsch-
land eingeführte Eigenthümlichkeit, von den
alten Vorbildern durchweg nur den Namen, in
der Regel nicht einmal das Material übernom-
men haben. Weil sie selber keinen Charakter
haben, bezeichnen die stillosen Möbel zu ihnen
keinen besonderen Gegensatz, weder der zopfige
Aufbau, noch das verwaschene Ornament, noch
auch die modernisirten Figuren mit ihren kranken
Farben. — Hier, also an sehr bevorzugter Stelle,
zeigt mithin die kirchliche Kunstthätigkeit un-
serer Tage ohne Zweifel einen recht wunden
Fleck, und es drängt sich vor Allem die Frage
auf, wie er etwa geheilt werden könnte. Die
Neuausstattung alter romanischer Kirchen ist in
vielen Fällen berechtigt, mannigmal eine Noth-
wendigkeit, und neue romanische Bauten sind in
der Regel da nicht zu verhüten, wo mifsverstan-
dene praktische oder einseitig malerische Rück-
sichten uneingeschränkt das Feld behaupten. Die
einen wie die anderen Kirchen bedürfen Altäre,
und die Frage ist nur, wie diesem Bedürfnisse
wohl auf würdige Art entsprochen werden könne.
Es fehlt nicht an einsichtigen Archäologen
und auch Künstlern, welche für die romanische
Kirche die Beschaffung gothischer Altäre un-
bedenklich gestatten, wenn nicht gar verlangen.
Sie begründen dieses Zugeständnifs mit der, hier
freilich mifsverständlich angewendeten,Thatsache,
dafs das spätere Mittelalter gerade so verfahren
sei; ferner berufen sie sich darauf, dafs die ro-
manische Periode den Altaraufsatz gar nicht
oder nur in kümmerlichen Anfängen gekannt
und es der gothischen Epoche überlassen habe,
ihn auszubilden bis zu einer hohen Stufe der
Vollendung. So unbestreitbar die letztere Be-
hauptung ist, so wenig ist sie geeignet, die vor-
liegende Schwierigkeit zu lösen. Denn abge-
sehen davon, dafs, was von den Altären gilt,
von allen Kirchenmöbeln behauptet werden darf,
mithin die Konsequenz vollständige gothische
Ausstattung verlangen müfste, ist doch der Ver-
zicht auf die Lösung der damals nicht gestellten
Aufgabe kein Beweis dafür, dafs es unmöglich
sei, für die erst später eingetretenen Bedürf-
nisse und Einrichtungen durchaus stilgemäfse
Lösungen auch im Rahmen des romanischen
Formenkreises zu finden. Was die Plastik des
XII. und XIII. Jahrh. in Stein, Metall und selbst
in Holz geschaffen hat, stellt doch einen so
reichen und mannigfaltigen Schatz dar, dafs in
ihm vollständig die Elemente enthalten sind
für die hier in Frage kommenden Gestaltungen,
und es bedarf wohl nur der Vertiefung in diesen
Formenkreis, um fürNeuschöpfungen talentvollen
Künstlern, in erster Linie Bildhauern, den rich-
tigen Weg zu zeigen.
Insoweit es sich um Altäre handelt, bietet
die romanische Periode zunächst das Vorbild
der Baldachin- oder Ciborien-Anlage.
Wo für diese der Breiten- und Höhenraum in
völlig hinreichendem Mafse vorhanden ist, was
die Ausnahme bilden dürfte, und wo für sie
die Mittel vorliegen, die (insofern es sich um
die Ausführung in Stein handelt) sehr reichlich
zugemessen sein müfsten: da wird sie sich auch
jetzt noch, aber in der Regel wohl nur für
den Hochaltar, ganz besonders empfehlen, und
es wird nicht allzu schwer sein, dafür eine in
Bezug auf die Gesammtwirkung wie die Einzel-
heiten befriedigende Lösung zu finden, wie Essen-
wein sie für den herrlichen Chor von St. Maria
im Kapitol zu Köln gewonnen hat. Es soll
nicht unerwähnt bleiben, dafs solche Altäre
1893. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 1.
IS
Entwurf eines romanischen Hochaltars.
Mit Abbildung.
ehr grofs ist die Zahl der nament-
lich auch in Deutschland erhaltenen
romanischen Kirchen. Viele von
ihnen sind besonders in den letz-
ten Jahrzehnten restaurirt worden und an die
Herstellung des Aeufsern hat sich mannigfach
auch eine Erneuerung des Innern angeschlossen,
welche zumeist in der Beschaffung neuer Mö-
bel bezw. Altäre bestand. Die in ihnen vor-
handenen, gewöhnlich aus weichem Holz gebil-
deten Barock- und Rokokoaltäre waren morsch
geworden, oder erschienen aus anderen Grün-
den der Erhaltung nicht mehr werth, und man-
chen der letzteren würde man nicht nachzu-
trauern brauchen, wenn ihre sogen, romanischen
Nachfolger diesen Ehrennamen in Wirklichkeit
verdienten. In der Regel sind es zopfige Ge-
bilde, denen hier und da ein Rundbogen auf-
gesetzt und ein romanisirendes Ornament an-
gehängt ist, Mifsgeburten, die als ein Hohn er-
scheinen auf die ernsten und strengen Formen
des alten Bauwerkes. Weniger stark erscheint
der Widerspruch, wenn sie in neue romanische
Kirchen aufgenommen sind, die, eine vornehm-
lich im letzten Jahrzehnt fast nur in Deutsch-
land eingeführte Eigenthümlichkeit, von den
alten Vorbildern durchweg nur den Namen, in
der Regel nicht einmal das Material übernom-
men haben. Weil sie selber keinen Charakter
haben, bezeichnen die stillosen Möbel zu ihnen
keinen besonderen Gegensatz, weder der zopfige
Aufbau, noch das verwaschene Ornament, noch
auch die modernisirten Figuren mit ihren kranken
Farben. — Hier, also an sehr bevorzugter Stelle,
zeigt mithin die kirchliche Kunstthätigkeit un-
serer Tage ohne Zweifel einen recht wunden
Fleck, und es drängt sich vor Allem die Frage
auf, wie er etwa geheilt werden könnte. Die
Neuausstattung alter romanischer Kirchen ist in
vielen Fällen berechtigt, mannigmal eine Noth-
wendigkeit, und neue romanische Bauten sind in
der Regel da nicht zu verhüten, wo mifsverstan-
dene praktische oder einseitig malerische Rück-
sichten uneingeschränkt das Feld behaupten. Die
einen wie die anderen Kirchen bedürfen Altäre,
und die Frage ist nur, wie diesem Bedürfnisse
wohl auf würdige Art entsprochen werden könne.
Es fehlt nicht an einsichtigen Archäologen
und auch Künstlern, welche für die romanische
Kirche die Beschaffung gothischer Altäre un-
bedenklich gestatten, wenn nicht gar verlangen.
Sie begründen dieses Zugeständnifs mit der, hier
freilich mifsverständlich angewendeten,Thatsache,
dafs das spätere Mittelalter gerade so verfahren
sei; ferner berufen sie sich darauf, dafs die ro-
manische Periode den Altaraufsatz gar nicht
oder nur in kümmerlichen Anfängen gekannt
und es der gothischen Epoche überlassen habe,
ihn auszubilden bis zu einer hohen Stufe der
Vollendung. So unbestreitbar die letztere Be-
hauptung ist, so wenig ist sie geeignet, die vor-
liegende Schwierigkeit zu lösen. Denn abge-
sehen davon, dafs, was von den Altären gilt,
von allen Kirchenmöbeln behauptet werden darf,
mithin die Konsequenz vollständige gothische
Ausstattung verlangen müfste, ist doch der Ver-
zicht auf die Lösung der damals nicht gestellten
Aufgabe kein Beweis dafür, dafs es unmöglich
sei, für die erst später eingetretenen Bedürf-
nisse und Einrichtungen durchaus stilgemäfse
Lösungen auch im Rahmen des romanischen
Formenkreises zu finden. Was die Plastik des
XII. und XIII. Jahrh. in Stein, Metall und selbst
in Holz geschaffen hat, stellt doch einen so
reichen und mannigfaltigen Schatz dar, dafs in
ihm vollständig die Elemente enthalten sind
für die hier in Frage kommenden Gestaltungen,
und es bedarf wohl nur der Vertiefung in diesen
Formenkreis, um fürNeuschöpfungen talentvollen
Künstlern, in erster Linie Bildhauern, den rich-
tigen Weg zu zeigen.
Insoweit es sich um Altäre handelt, bietet
die romanische Periode zunächst das Vorbild
der Baldachin- oder Ciborien-Anlage.
Wo für diese der Breiten- und Höhenraum in
völlig hinreichendem Mafse vorhanden ist, was
die Ausnahme bilden dürfte, und wo für sie
die Mittel vorliegen, die (insofern es sich um
die Ausführung in Stein handelt) sehr reichlich
zugemessen sein müfsten: da wird sie sich auch
jetzt noch, aber in der Regel wohl nur für
den Hochaltar, ganz besonders empfehlen, und
es wird nicht allzu schwer sein, dafür eine in
Bezug auf die Gesammtwirkung wie die Einzel-
heiten befriedigende Lösung zu finden, wie Essen-
wein sie für den herrlichen Chor von St. Maria
im Kapitol zu Köln gewonnen hat. Es soll
nicht unerwähnt bleiben, dafs solche Altäre