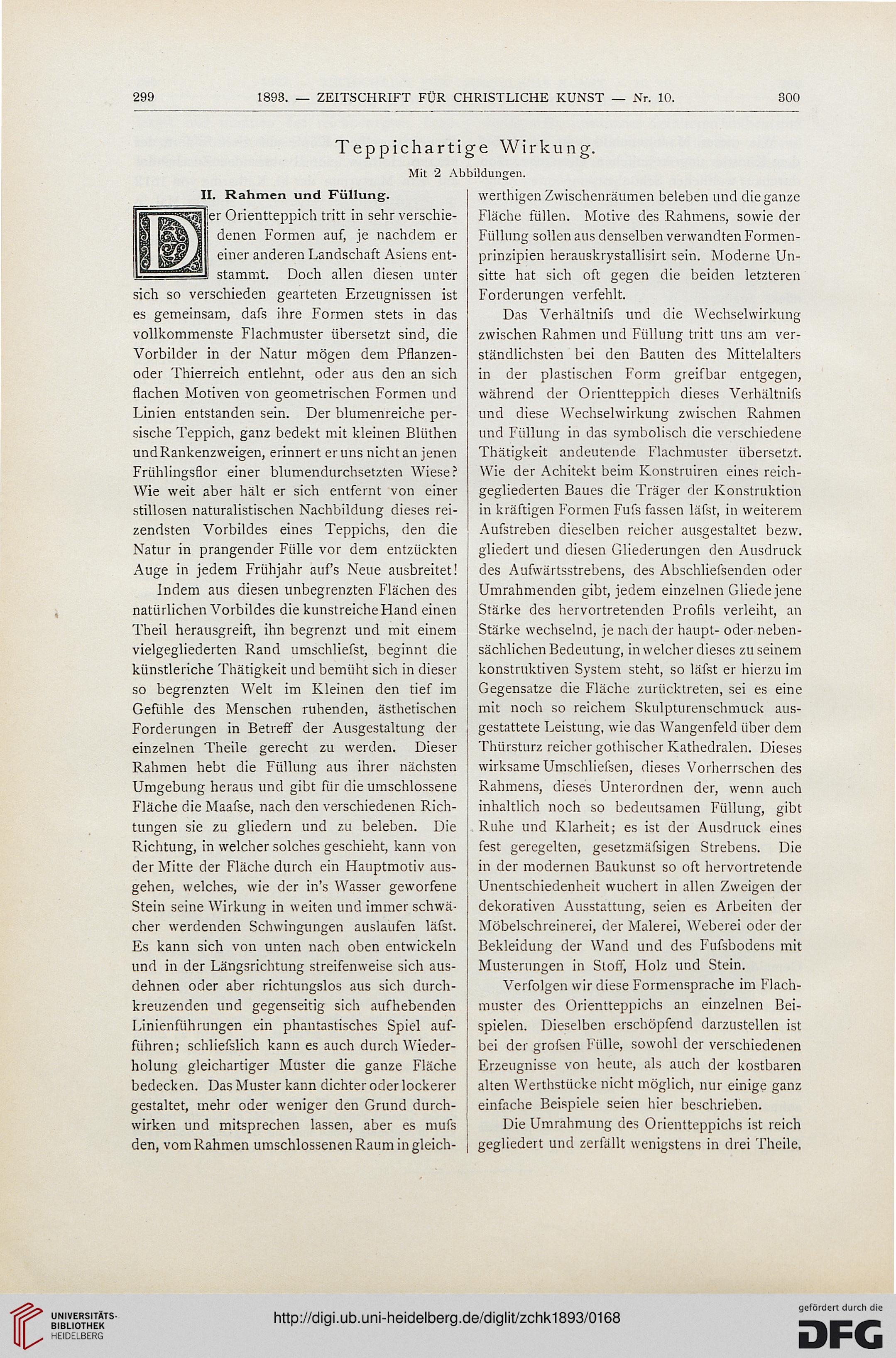299
1893. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
300
T e p p i c h a r t i g e Wirkung.
Mit 2 Abbildungen.
II. Rahmen und Füllung.
er Orientteppich tritt in sehr verschie-
denen Formen auf, je nachdem er
einer anderen Landschaft Asiens ent-
stammt. Doch allen diesen unter
sich so verschieden gearteten Erzeugnissen ist
es gemeinsam, dafs ihre Formen stets in das
vollkommenste Flachmuster übersetzt sind, die
Vorbilder in der Natur mögen dem Pflanzen-
oder Thierreich entlehnt, oder aus den an sich
flachen Motiven von geometrischen Formen und
Linien entstanden sein. Der blumenreiche per-
sische Teppich, ganz bedekt mit kleinen Blüthen
und Rankenzweigen, erinnert er uns nicht an jenen
Frühlingsflor einer blumendurchsetzten Wiese?
Wie weit aber hält er sich entfernt von einer
stillosen naturalistischen Nachbildung dieses rei-
zendsten Vorbildes eines Teppichs, den die
Natur in prangender Fülle vor dem entzückten
Auge in jedem Frühjahr auf's Neue ausbreitet!
Indem aus diesen unbegrenzten Flächen des
natürlichen Vorbildes die kunstreiche Hand einen
Theil herausgreift, ihn begrenzt und mit einem
vielgegliederten Rand umschliefst, beginnt die
künstleriche Thätigkeit und bemüht sich in dieser
so begrenzten Welt im Kleinen den tief im
Gefühle des Menschen ruhenden, ästhetischen
Forderungen in Betreff der Ausgestaltung der
einzelnen Theile gerecht zu werden. Dieser
Rahmen hebt die Füllung aus ihrer nächsten
Umgebung heraus und gibt für die umschlossene
Fläche die Maafse, nach den verschiedenen Rich-
tungen sie zu gliedern und zu beleben. Die
Richtung, in welcher solches geschieht, kann von
der Mitte der Fläche durch ein Hauptmotiv aus-
gehen, welches, wie der in's Wasser geworfene
Stein seine Wirkung in weiten und immer schwä-
cher werdenden Schwingungen auslaufen läfst.
Es kann sich von unten nach oben entwickeln
und in der Längsrichtung streifenweise sich aus-
dehnen oder aber richtungslos aus sich durch-
kreuzenden und gegenseitig sich aufhebenden
Linienführungen ein phantastisches Spiel auf-
führen; schliefslich kann es auch durch Wieder-
holung gleichartiger Muster die ganze Fläche
bedecken. Das Muster kann dichter oder lockerer
gestaltet, mehr oder weniger den Grund durch-
werthigen Zwischenräumen beleben und die ganze
Fläche füllen. Motive des Rahmens, sowie der
Füllung sollen aus denselben verwandten Formen-
prinzipien herauskrystallisirt sein. Moderne Un-
sitte hat sich oft gegen die beiden letzteren
Forderungen verfehlt.
Das Verhältnifs und die Wechselwirkung
zwischen Rahmen und Füllung tritt uns am ver-
ständlichsten bei den Bauten des Mittelalters
in der plastischen Form greifbar entgegen,
während der Orientteppich dieses Verhältnifs
und diese Wechselwirkung zwischen Rahmen
und Füllung in das symbolisch die verschiedene
Thätigkeit andeutende Flachmuster übersetzt.
Wie der Achitekt beim Konstruiren eines reich-
gegliederten Baues die Träger der Konstruktion
in kräftigen Formen Fufs fassen läfst, in weiterem
Aufstreben dieselben reicher ausgestaltet bezw.
gliedert und diesen Gliederungen den Ausdruck
des Aufwärtsstrebens, des Abschliefsenden oder
Umrahmenden gibt, jedem einzelnen Gliedejene
Stärke des hervortretenden Profils verleiht, an
Stärke wechselnd, je nach der haupt- oder neben-
sächlichen Bedeutung, in welcher dieses zu seinem
konstruktiven System steht, so läfst er hierzu im
Gegensatze die Fläche zurücktreten, sei es eine
mit noch so reichem Skulpturenschmuck aus-
gestattete Leistung, wie das Wangenfeld über dem
Thürsturz reicher gothischer Kathedralen. Dieses
wirksame Umschliefsen, dieses Vorherrschen des
Rahmens, dieses Unterordnen der, wenn auch
inhaltlich noch so bedeutsamen Füllung, gibt
Ruhe und Klarheit; es ist der Ausdruck eines
fest geregelten, gesetzmäfsigen Strebens. Die
in der modernen Baukunst so oft hervortretende
Unentschiedenheit wuchert in allen Zweigen der
dekorativen Ausstattung, seien es Arbeiten der
Möbelschreinerei, der Malerei, Weberei oder der
Bekleidung der Wand und des Fufsbodens mit
Musterungen in Stoff, Holz und Stein.
Verfolgen wir diese Formensprache im Flach-
muster des Orientteppichs an einzelnen Bei-
spielen. Dieselben erschöpfend darzustellen ist
bei der grofsen Fülle, sowohl der verschiedenen
Erzeugnisse von heute, als auch der kostbaren
alten Werthstücke nicht möglich, nur einige ganz
einfache Beispiele seien hier beschrieben.
Die Umrahmung des Orientteppichs ist reich
wirken und mitsprechen lassen, aber es mufs |
den, vom Rahmen umschlossenen Raum in gleich- | gegliedert und zerfällt wenigstens in drei Theile
1893. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
300
T e p p i c h a r t i g e Wirkung.
Mit 2 Abbildungen.
II. Rahmen und Füllung.
er Orientteppich tritt in sehr verschie-
denen Formen auf, je nachdem er
einer anderen Landschaft Asiens ent-
stammt. Doch allen diesen unter
sich so verschieden gearteten Erzeugnissen ist
es gemeinsam, dafs ihre Formen stets in das
vollkommenste Flachmuster übersetzt sind, die
Vorbilder in der Natur mögen dem Pflanzen-
oder Thierreich entlehnt, oder aus den an sich
flachen Motiven von geometrischen Formen und
Linien entstanden sein. Der blumenreiche per-
sische Teppich, ganz bedekt mit kleinen Blüthen
und Rankenzweigen, erinnert er uns nicht an jenen
Frühlingsflor einer blumendurchsetzten Wiese?
Wie weit aber hält er sich entfernt von einer
stillosen naturalistischen Nachbildung dieses rei-
zendsten Vorbildes eines Teppichs, den die
Natur in prangender Fülle vor dem entzückten
Auge in jedem Frühjahr auf's Neue ausbreitet!
Indem aus diesen unbegrenzten Flächen des
natürlichen Vorbildes die kunstreiche Hand einen
Theil herausgreift, ihn begrenzt und mit einem
vielgegliederten Rand umschliefst, beginnt die
künstleriche Thätigkeit und bemüht sich in dieser
so begrenzten Welt im Kleinen den tief im
Gefühle des Menschen ruhenden, ästhetischen
Forderungen in Betreff der Ausgestaltung der
einzelnen Theile gerecht zu werden. Dieser
Rahmen hebt die Füllung aus ihrer nächsten
Umgebung heraus und gibt für die umschlossene
Fläche die Maafse, nach den verschiedenen Rich-
tungen sie zu gliedern und zu beleben. Die
Richtung, in welcher solches geschieht, kann von
der Mitte der Fläche durch ein Hauptmotiv aus-
gehen, welches, wie der in's Wasser geworfene
Stein seine Wirkung in weiten und immer schwä-
cher werdenden Schwingungen auslaufen läfst.
Es kann sich von unten nach oben entwickeln
und in der Längsrichtung streifenweise sich aus-
dehnen oder aber richtungslos aus sich durch-
kreuzenden und gegenseitig sich aufhebenden
Linienführungen ein phantastisches Spiel auf-
führen; schliefslich kann es auch durch Wieder-
holung gleichartiger Muster die ganze Fläche
bedecken. Das Muster kann dichter oder lockerer
gestaltet, mehr oder weniger den Grund durch-
werthigen Zwischenräumen beleben und die ganze
Fläche füllen. Motive des Rahmens, sowie der
Füllung sollen aus denselben verwandten Formen-
prinzipien herauskrystallisirt sein. Moderne Un-
sitte hat sich oft gegen die beiden letzteren
Forderungen verfehlt.
Das Verhältnifs und die Wechselwirkung
zwischen Rahmen und Füllung tritt uns am ver-
ständlichsten bei den Bauten des Mittelalters
in der plastischen Form greifbar entgegen,
während der Orientteppich dieses Verhältnifs
und diese Wechselwirkung zwischen Rahmen
und Füllung in das symbolisch die verschiedene
Thätigkeit andeutende Flachmuster übersetzt.
Wie der Achitekt beim Konstruiren eines reich-
gegliederten Baues die Träger der Konstruktion
in kräftigen Formen Fufs fassen läfst, in weiterem
Aufstreben dieselben reicher ausgestaltet bezw.
gliedert und diesen Gliederungen den Ausdruck
des Aufwärtsstrebens, des Abschliefsenden oder
Umrahmenden gibt, jedem einzelnen Gliedejene
Stärke des hervortretenden Profils verleiht, an
Stärke wechselnd, je nach der haupt- oder neben-
sächlichen Bedeutung, in welcher dieses zu seinem
konstruktiven System steht, so läfst er hierzu im
Gegensatze die Fläche zurücktreten, sei es eine
mit noch so reichem Skulpturenschmuck aus-
gestattete Leistung, wie das Wangenfeld über dem
Thürsturz reicher gothischer Kathedralen. Dieses
wirksame Umschliefsen, dieses Vorherrschen des
Rahmens, dieses Unterordnen der, wenn auch
inhaltlich noch so bedeutsamen Füllung, gibt
Ruhe und Klarheit; es ist der Ausdruck eines
fest geregelten, gesetzmäfsigen Strebens. Die
in der modernen Baukunst so oft hervortretende
Unentschiedenheit wuchert in allen Zweigen der
dekorativen Ausstattung, seien es Arbeiten der
Möbelschreinerei, der Malerei, Weberei oder der
Bekleidung der Wand und des Fufsbodens mit
Musterungen in Stoff, Holz und Stein.
Verfolgen wir diese Formensprache im Flach-
muster des Orientteppichs an einzelnen Bei-
spielen. Dieselben erschöpfend darzustellen ist
bei der grofsen Fülle, sowohl der verschiedenen
Erzeugnisse von heute, als auch der kostbaren
alten Werthstücke nicht möglich, nur einige ganz
einfache Beispiele seien hier beschrieben.
Die Umrahmung des Orientteppichs ist reich
wirken und mitsprechen lassen, aber es mufs |
den, vom Rahmen umschlossenen Raum in gleich- | gegliedert und zerfällt wenigstens in drei Theile