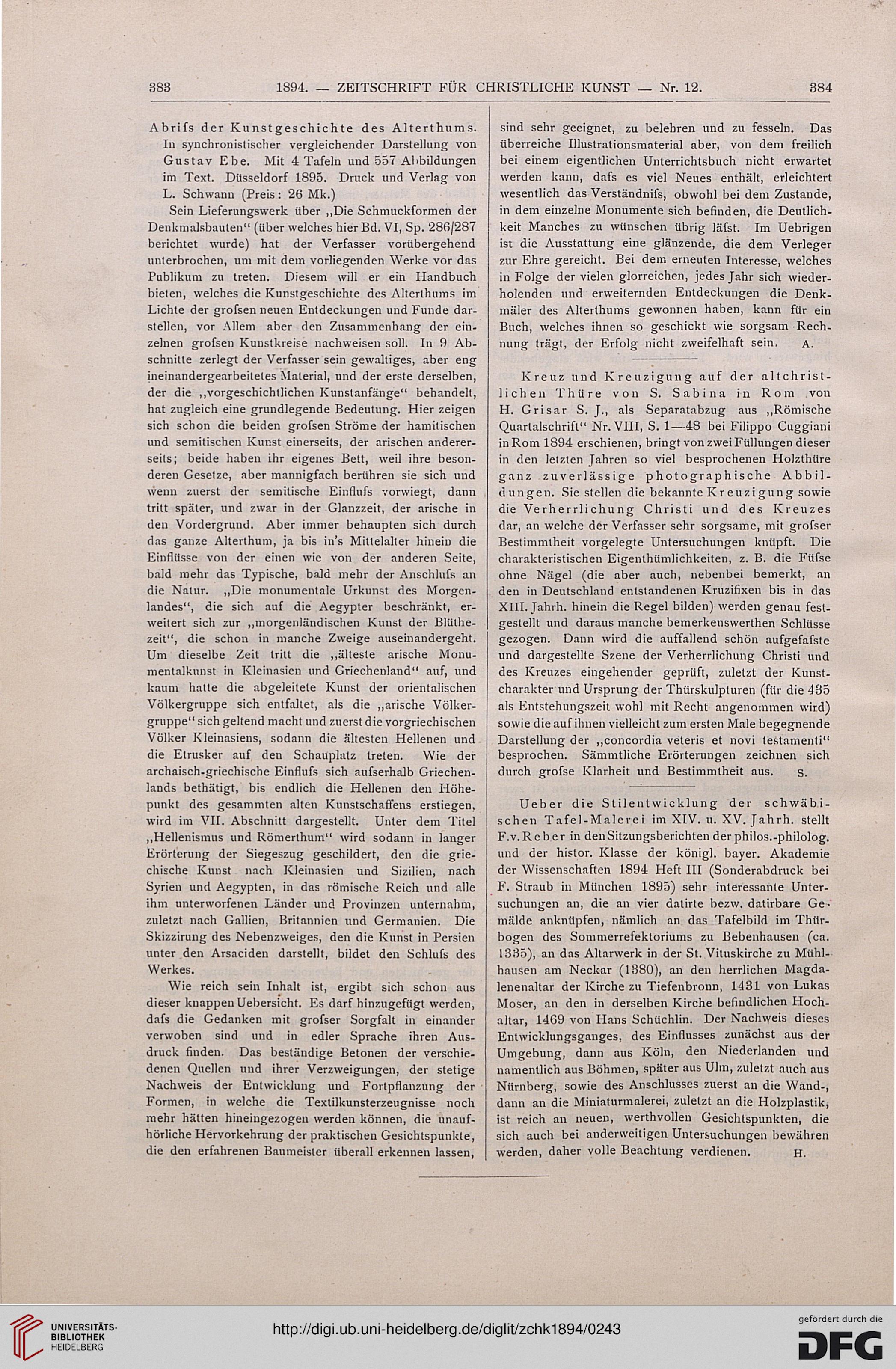3S3
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
384
Abrifs der Kunstgeschichte des Alterthums.
In synchronistischer vergleichender Darstellung von
Gustav Ebe. Mit 4 Tafeln und 557 Alibildungen
im Text. Düsseldorf 1895. Druck und Verlag von
L. Schwann (Preis: 26 Mk.)
Sein Lieferungswerk über „Die Schmuckformen der
Denkmalsbauten" (über welches hier Bd. VI, Sp. 286/287
berichtet wurde) hat der Verfasser vorübergehend
unterbrochen, um mit dem vorliegenden Werke vor das
Publikum zu treten. Diesem will er ein Handbuch
bieten, welches die Kunstgeschichte des Alterthums im
Lichte der grofsen neuen Entdeckungen und Funde dar-
stellen, vor Allem aber den Zusammenhang der ein-
zelnen grofsen Kunstkreise nachweisen soll. In 9 Ab-
schnitte zerlegt der Verfasser sein gewalliges, aber eng
ineinandergearbeileles Material, und der erste derselben,
der die „vorgeschichtlichen Kunstanfänge" behandelt,
hat zugleich eine grundlegende Bedeutung. Hier zeigen
sich schon die beiden grofsen Ströme der hamitischen
und semitischen Kunst einerseits, der arischen anderer-
seits; beide haben ihr eigenes Bett, weil ihre beson-
deren Gesetze, aber mannigfach berühren sie sich und
wenn zuerst der semitische Einflufs vorwiegt, dann
tritt später, und zwar in der Glanzzeit, der arische in
den Vordergrund. Aber immer behaupten sich durch
das ganze Alterthum, ja bis in's Mittelalter hinein die
Einflüsse von der einen wie von der anderen Seite,
bald mehr das Typische, bald mehr der Anschlufs an
die Natur. „Die monumentale Urkunst des Morgen-
landes", die sich auf die Aegypter beschränkt, er-
weitert sich zur „morgenländischen Kunst der Blüthe-
zeit", die schon in manche Zweige auseinandergeht.
Um dieselbe Zeit tritt die „älteste arische Monu-
mentalkunst in Kleinasien und Griechenland" auf, und
kaum hatte die abgeleitete Kunst der orientalischen
Völkergruppe sich entfaltet, als die „arische Völker-
gruppe" sich geltend macht und zuerst die vorgriechischen
Völker Kleinasiens, sodann die ältesten Hellenen und
die Elrusker auf den Schauplatz treten. Wie der
archaisch-griechische Einflufs sich aufserhalb Griechen-
lands bethätigt, bis endlich die Hellenen den Höhe-
punkt des gesammten alten Kunstschaffens erstiegen,
wird im VII. Abschnitt dargestellt. Unter dem Titel
„Hellenismus und Römerfhum" wird sodann in langer
Erörterung der Siegeszug geschildert, den die grie-
chische Kunst nach Kleinasien und Sizilien, nach
Syrien und Aegypten, in das römische Reich und alle
ihm unterworfenen Länder und Provinzen unternahm,
zuletzt nach Gallien, Britannien und Germanien. Die
Skizzirung des Nebenzweiges, den die Kunst in Persien
unter den Arsaciden darstellt, bildet den Schlufs des
Werkes.
Wie reich sein Inhalt ist, ergibt sich schon aus
dieser knappen Uebersicht. Es darf hinzugefügt werden,
dafs die Gedanken mit grofser Sorgfalt in einander
verwoben sind und in edler Sprache ihren Aus-
druck finden. Das beständige Betonen der verschie-
denen Quellen und ihrer Verzweigungen, der stetige
Nachweis der Entwicklung und Fortpflanzung der
Formen, in welche die Textilkunsterzeugnisse noch
mehr hätten hineingezogen werden können, die unauf-
hörliche Hervorkehrung der praktischen Gesichtspunkte,
die den erfahrenen Baumeister überall erkennen lassen,
sind sehr geeignet, zu belehren und zu fesseln. Das
überreiche Illustrationsmaterial aber, von dem freilich
bei einem eigentlichen Unterrichtsbuch nicht erwartet
werden kann, dafs es viel Neues enthält, erleichtert
wesentlich das Verständnifs, obwohl bei dem Zustande,
in dem einzelne Monumente sich befinden, die Deutlich-
keit Manches zu wünschen übrig läfst. Im Uebrigen
ist die Ausstattung eine glänzende, die dem Verleger
zur Ehre gereicht. Bei dem erneuten Interesse, welches
in Folge der vielen glorreichen, jedes Jahr sich wieder-
holenden und erweiternden Entdeckungen die Denk-
mäler des Alterthums gewonnen haben, kann für ein
Buch, welches ihnen so geschickt wie sorgsam Rech-
nung trägt, der Erfolg nicht zweifelhaft sein, A.
Kreuz und Kreuzigung auf der altchrist-
lichen ThU re von S. S ab i na in Rom von
H. Grisar S. J., als Separatabzug aus „Römische
Quartalschrift" Nr. VIII, S. 1—48 bei Filippo Cuggiani
in Rom 1894 erschienen, bringt von zwei Füllungen dieser
in den letzten Jahren so viel besprochenen Holzthüre
ganz zuverlässige photographische Abbil-
dungen. Sie stellen die bekannte Kreuzigung sowie
die Verherrlichung Christi und des Kreuzes
dar, an welche der Verfasser sehr sorgsame, mit grofser
Bestimmtheit vorgelegte Untersuchungen knüpft. Die
charakteristischen Eigenthümlichkeiten, z. B. die Füfse
ohne Nägel (die aber auch, nebenbei bemerkt, an
den in Deutschland entstandenen Kruzifixen bis in das
XIII. Jahrh. hinein die Regel bilden) werden genau fest-
gestellt und daraus manche bemerkenswerthen Schlüsse
gezogen. Dann wird die auffallend schön aufgefafste
und dargestellte Szene der Verherrlichung Christi und
des Kreuzes eingehender geprüft, zuletzt der Kunst-
charakter und Ursprung der Thürskulpturen (für die 435
als Entstehungszeit wohl mit Recht angenommen wird)
sowie die auf ihnen vielleicht zum ersten Male begegnende
Darstellung der „concordia veteris et novi testamenti"
besprochen. Sämmtliche Erörterungen zeichnen sich
durch grofse Klarheit und Bestimmtheit aus. s.
Ueber die Stilentwicklung der schwäbi-
schen Tafel-Malerei im XIV. u. XV. Jahrh. stellt
F.v. Reber in den Sitzungsberichten der philos.-philolog.
und der histor. Klasse der königl. bayer. Akademie
der Wissenschaften 1894 Heft III (Sonderabdruck bei
F. Straub in München 1895) sehr interessante Unter-
suchungen an, die an vier datirte bezw. datirbare Ge-
mälde anknüpfen, nämlich an das Tafelbild im Thür-
bogen des Sommerrefektoriums zu Bebenhausen (ca.
1335), an das Altarvverk in der St. Viluskirche zu Mühl-
hausen am Neckar (1380), an den herrlichen Magda-
lenenaltar der Kirche zu Tiefenbronn, 1431 von Lukas
Moser, an den in derselben Kirche befindlichen Hoch-
altar, 1469 von Hans Schüchlin. Der Nachweis dieses
Entwicklungsganges, des Einflusses zunächst aus der
Umgebung, dann aus Köln, den Niederlanden und
namentlich aus Böhmen, später aus Ulm, zuletzt auch aus
Nürnberg, sowie des Anschlusses zuerst an die Wand-,
dann an die Miniaturmalerei, zuletzt an die Holzplastik,
ist reich an neuen, werthvollen Gesichtspunkten, die
sich auch bei anderweitigen Untersuchungen bewähren
werden, daher volle Beachtung verdienen. H.
1894.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
384
Abrifs der Kunstgeschichte des Alterthums.
In synchronistischer vergleichender Darstellung von
Gustav Ebe. Mit 4 Tafeln und 557 Alibildungen
im Text. Düsseldorf 1895. Druck und Verlag von
L. Schwann (Preis: 26 Mk.)
Sein Lieferungswerk über „Die Schmuckformen der
Denkmalsbauten" (über welches hier Bd. VI, Sp. 286/287
berichtet wurde) hat der Verfasser vorübergehend
unterbrochen, um mit dem vorliegenden Werke vor das
Publikum zu treten. Diesem will er ein Handbuch
bieten, welches die Kunstgeschichte des Alterthums im
Lichte der grofsen neuen Entdeckungen und Funde dar-
stellen, vor Allem aber den Zusammenhang der ein-
zelnen grofsen Kunstkreise nachweisen soll. In 9 Ab-
schnitte zerlegt der Verfasser sein gewalliges, aber eng
ineinandergearbeileles Material, und der erste derselben,
der die „vorgeschichtlichen Kunstanfänge" behandelt,
hat zugleich eine grundlegende Bedeutung. Hier zeigen
sich schon die beiden grofsen Ströme der hamitischen
und semitischen Kunst einerseits, der arischen anderer-
seits; beide haben ihr eigenes Bett, weil ihre beson-
deren Gesetze, aber mannigfach berühren sie sich und
wenn zuerst der semitische Einflufs vorwiegt, dann
tritt später, und zwar in der Glanzzeit, der arische in
den Vordergrund. Aber immer behaupten sich durch
das ganze Alterthum, ja bis in's Mittelalter hinein die
Einflüsse von der einen wie von der anderen Seite,
bald mehr das Typische, bald mehr der Anschlufs an
die Natur. „Die monumentale Urkunst des Morgen-
landes", die sich auf die Aegypter beschränkt, er-
weitert sich zur „morgenländischen Kunst der Blüthe-
zeit", die schon in manche Zweige auseinandergeht.
Um dieselbe Zeit tritt die „älteste arische Monu-
mentalkunst in Kleinasien und Griechenland" auf, und
kaum hatte die abgeleitete Kunst der orientalischen
Völkergruppe sich entfaltet, als die „arische Völker-
gruppe" sich geltend macht und zuerst die vorgriechischen
Völker Kleinasiens, sodann die ältesten Hellenen und
die Elrusker auf den Schauplatz treten. Wie der
archaisch-griechische Einflufs sich aufserhalb Griechen-
lands bethätigt, bis endlich die Hellenen den Höhe-
punkt des gesammten alten Kunstschaffens erstiegen,
wird im VII. Abschnitt dargestellt. Unter dem Titel
„Hellenismus und Römerfhum" wird sodann in langer
Erörterung der Siegeszug geschildert, den die grie-
chische Kunst nach Kleinasien und Sizilien, nach
Syrien und Aegypten, in das römische Reich und alle
ihm unterworfenen Länder und Provinzen unternahm,
zuletzt nach Gallien, Britannien und Germanien. Die
Skizzirung des Nebenzweiges, den die Kunst in Persien
unter den Arsaciden darstellt, bildet den Schlufs des
Werkes.
Wie reich sein Inhalt ist, ergibt sich schon aus
dieser knappen Uebersicht. Es darf hinzugefügt werden,
dafs die Gedanken mit grofser Sorgfalt in einander
verwoben sind und in edler Sprache ihren Aus-
druck finden. Das beständige Betonen der verschie-
denen Quellen und ihrer Verzweigungen, der stetige
Nachweis der Entwicklung und Fortpflanzung der
Formen, in welche die Textilkunsterzeugnisse noch
mehr hätten hineingezogen werden können, die unauf-
hörliche Hervorkehrung der praktischen Gesichtspunkte,
die den erfahrenen Baumeister überall erkennen lassen,
sind sehr geeignet, zu belehren und zu fesseln. Das
überreiche Illustrationsmaterial aber, von dem freilich
bei einem eigentlichen Unterrichtsbuch nicht erwartet
werden kann, dafs es viel Neues enthält, erleichtert
wesentlich das Verständnifs, obwohl bei dem Zustande,
in dem einzelne Monumente sich befinden, die Deutlich-
keit Manches zu wünschen übrig läfst. Im Uebrigen
ist die Ausstattung eine glänzende, die dem Verleger
zur Ehre gereicht. Bei dem erneuten Interesse, welches
in Folge der vielen glorreichen, jedes Jahr sich wieder-
holenden und erweiternden Entdeckungen die Denk-
mäler des Alterthums gewonnen haben, kann für ein
Buch, welches ihnen so geschickt wie sorgsam Rech-
nung trägt, der Erfolg nicht zweifelhaft sein, A.
Kreuz und Kreuzigung auf der altchrist-
lichen ThU re von S. S ab i na in Rom von
H. Grisar S. J., als Separatabzug aus „Römische
Quartalschrift" Nr. VIII, S. 1—48 bei Filippo Cuggiani
in Rom 1894 erschienen, bringt von zwei Füllungen dieser
in den letzten Jahren so viel besprochenen Holzthüre
ganz zuverlässige photographische Abbil-
dungen. Sie stellen die bekannte Kreuzigung sowie
die Verherrlichung Christi und des Kreuzes
dar, an welche der Verfasser sehr sorgsame, mit grofser
Bestimmtheit vorgelegte Untersuchungen knüpft. Die
charakteristischen Eigenthümlichkeiten, z. B. die Füfse
ohne Nägel (die aber auch, nebenbei bemerkt, an
den in Deutschland entstandenen Kruzifixen bis in das
XIII. Jahrh. hinein die Regel bilden) werden genau fest-
gestellt und daraus manche bemerkenswerthen Schlüsse
gezogen. Dann wird die auffallend schön aufgefafste
und dargestellte Szene der Verherrlichung Christi und
des Kreuzes eingehender geprüft, zuletzt der Kunst-
charakter und Ursprung der Thürskulpturen (für die 435
als Entstehungszeit wohl mit Recht angenommen wird)
sowie die auf ihnen vielleicht zum ersten Male begegnende
Darstellung der „concordia veteris et novi testamenti"
besprochen. Sämmtliche Erörterungen zeichnen sich
durch grofse Klarheit und Bestimmtheit aus. s.
Ueber die Stilentwicklung der schwäbi-
schen Tafel-Malerei im XIV. u. XV. Jahrh. stellt
F.v. Reber in den Sitzungsberichten der philos.-philolog.
und der histor. Klasse der königl. bayer. Akademie
der Wissenschaften 1894 Heft III (Sonderabdruck bei
F. Straub in München 1895) sehr interessante Unter-
suchungen an, die an vier datirte bezw. datirbare Ge-
mälde anknüpfen, nämlich an das Tafelbild im Thür-
bogen des Sommerrefektoriums zu Bebenhausen (ca.
1335), an das Altarvverk in der St. Viluskirche zu Mühl-
hausen am Neckar (1380), an den herrlichen Magda-
lenenaltar der Kirche zu Tiefenbronn, 1431 von Lukas
Moser, an den in derselben Kirche befindlichen Hoch-
altar, 1469 von Hans Schüchlin. Der Nachweis dieses
Entwicklungsganges, des Einflusses zunächst aus der
Umgebung, dann aus Köln, den Niederlanden und
namentlich aus Böhmen, später aus Ulm, zuletzt auch aus
Nürnberg, sowie des Anschlusses zuerst an die Wand-,
dann an die Miniaturmalerei, zuletzt an die Holzplastik,
ist reich an neuen, werthvollen Gesichtspunkten, die
sich auch bei anderweitigen Untersuchungen bewähren
werden, daher volle Beachtung verdienen. H.