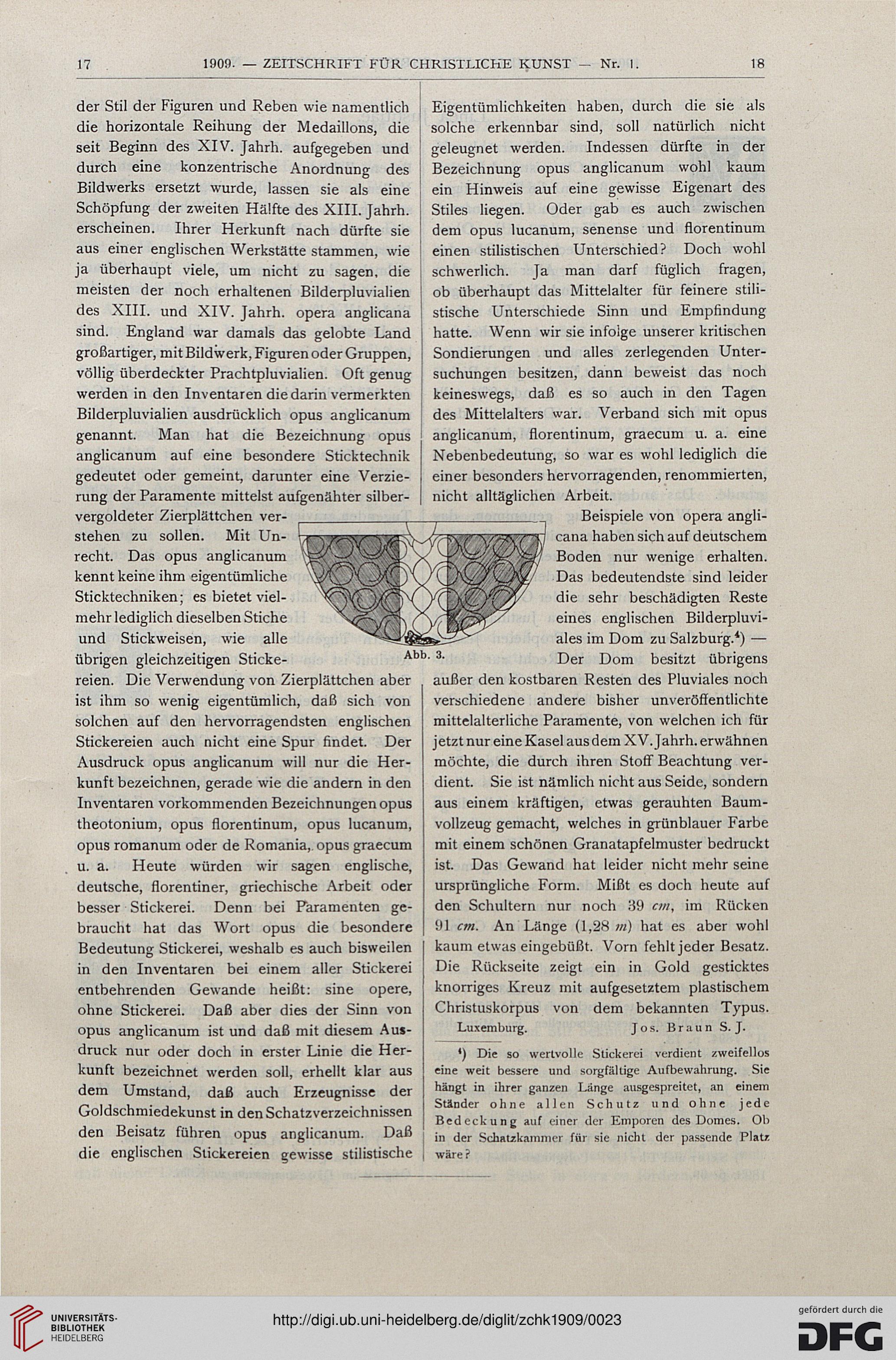17
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. I.
18
der Stil der Figuren und Reben wie namentlich
die horizontale Reihung der Medaillons, die
seit Beginn des XIV. Jahrh. aufgegeben und
durch eine konzentrische Anordnung des
Bildwerks ersetzt wurde, lassen sie als eine
Schöpfung der zweiten Hälfte des XIII. Jahrh.
erscheinen. Ihrer Herkunft nach dürfte sie
aus einer englischen Werkstätte stammen, wie
ja überhaupt viele, um nicht zu sagen, die
meisten der noch erhaltenen Bilderpluvialien
des XIII. und XIV. Jahrh. opera anglicana
sind. England war damals das gelobte Land
großartiger, mit Bildwerk, Figuren oder Gruppen,
völlig überdeckter Prachtpluvialien. Oft genug
werden in den Inventaren die darin vermerkten
Bilderpluvialien ausdrücklich opus anglicanum
genannt. Man hat die Bezeichnung opus
anglicanum auf eine besondere Sticktechnik
gedeutet oder gemeint, darunter eine Verzie-
rung der Paramente mittelst aufgenähter silber-
vergoldeter Zierplättchen ver-
stehen zu sollen. Mit Un-
recht. Das opus anglicanum
kennt keine ihm eigentümliche
Sticktechniken; es bietet viel-
mehr lediglich dieselben Stiche
und Stickweisen, wie alle
übrigen gleichzeitigen Sticke-
reien. Die Verwendung von Zierplättchen aber
ist ihm so wenig eigentümlich, daß sich von
solchen auf den hervorragendsten englischen
Stickereien auch nicht eine Spur findet. Der
Ausdruck opus anglicanum will nur die Her-
kunft bezeichnen, gerade wie die andern in den
Inventaren vorkommenden Bezeichnungen opus
theotonium, opus florentinum, opus lucanum,
opus romanum oder de Romania,. opus graecum
u. a. Heute würden wir sagen englische,
deutsche, florentiner, griechische Arbeit oder
besser Stickerei. Denn bei Paramenten ge-
braucht hat das Wort opus die besondere
Bedeutung Stickerei, weshalb es auch bisweilen
in den Inventaren bei einem aller Stickerei
entbehrenden Gewände heißt: sine opere,
ohne Stickerei. Daß aber dies der Sinn von
opus anglicanum ist und daß mit diesem Aus-
druck nur oder doch in erster Linie die Her-
kunft bezeichnet werden soll, erhellt klar aus
dem Umstand, daß auch Erzeugnisse der
Goldschmiedekunst in den Schatzverzeichnissen
den Beisatz führen opus anglicanum. Daß
die englischen Stickereien gewisse stilistische
Abb. 3
Eigentümlichkeiten haben, durch die sie als
solche erkennbar sind, soll natürlich nicht
geleugnet werden. Indessen dürfte in der
Bezeichnung opus anglicanum wohl kaum
ein Hinweis auf eine gewisse Eigenart des
Stiles liegen. Oder gab es auch zwischen
dem opus lucanum, senense und florentinum
einen stilistischen Unterschied? Doch wohl
schwerlich. Ja man darf füglich fragen,
ob überhaupt das Mittelalter für feinere stili-
stische Unterschiede Sinn und Empfindung
hatte. Wenn wir sie infolge unserer kritischen
Sondierungen und alles zerlegenden Unter-
suchungen besitzen, dann beweist das noch
keineswegs, daß es so auch in den Tagen
des Mittelalters war. Verband sich mit opus
anglicanum, florentinum, graecum u. a. eine
Nebenbedeutung, so war es wohl lediglich die
einer besonders hervorragenden, renommierten,
nicht alltäglichen Arbeit.
Beispiele von opera angli-
| cana haben sich auf deutschem
Boden nur wenige erhalten.
Das bedeutendste sind leider
die sehr beschädigten Reste
eines englischen Bilderpluvi-
ales im Dom zu Salzburg.1) —
Der Dom besitzt übrigens
außer den kostbaren Resten des Pluviales noch
verschiedene andere bisher unveröffentlichte
mittelalterliche Paramente, von welchen ich für
jetzt nur eine Kasel aus dem XV. Jahrh. erwähnen
möchte, die durch ihren Stoff Beachtung ver-
dient. Sie ist nämlich nicht aus Seide, sondern
aus einem kräftigen, etwas gerauhten Baum-
vollzeug gemacht, welches in grünblauer Farbe
mit einem schönen Granatapfelmuster bedruckt
ist. Das Gewand hat leider nicht mehr seine
ursprüngliche Form. Mißt es doch heute auf
den Schultern nur noch 39 cm, im Rücken
91 cm. An Länge (1,28 vi) hat es aber wohl
kaum etwas eingebüßt. Vorn fehlt jeder Besatz.
Die Rückseite zeigt ein in Gold gesticktes
knorriges Kreuz mit aufgesetztem plastischem
Christuskorpus von dem bekannten Typus.
Luxemburg. Jos. Braun S. J.
') Die so wertvolle Stickerei verdient zweifellos
eine weit bessere und sorgfältige Aufbewahrung. Sie
hängt in ihrer ganzen Länge ausgespreitet, an einem
Ständer ohne allen Schutz und ohne jede
Bedeckung auf einer der Emporen des Domes. Ob
in der Schatzkammer für sie nicht der passende Platz
wäre?
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. I.
18
der Stil der Figuren und Reben wie namentlich
die horizontale Reihung der Medaillons, die
seit Beginn des XIV. Jahrh. aufgegeben und
durch eine konzentrische Anordnung des
Bildwerks ersetzt wurde, lassen sie als eine
Schöpfung der zweiten Hälfte des XIII. Jahrh.
erscheinen. Ihrer Herkunft nach dürfte sie
aus einer englischen Werkstätte stammen, wie
ja überhaupt viele, um nicht zu sagen, die
meisten der noch erhaltenen Bilderpluvialien
des XIII. und XIV. Jahrh. opera anglicana
sind. England war damals das gelobte Land
großartiger, mit Bildwerk, Figuren oder Gruppen,
völlig überdeckter Prachtpluvialien. Oft genug
werden in den Inventaren die darin vermerkten
Bilderpluvialien ausdrücklich opus anglicanum
genannt. Man hat die Bezeichnung opus
anglicanum auf eine besondere Sticktechnik
gedeutet oder gemeint, darunter eine Verzie-
rung der Paramente mittelst aufgenähter silber-
vergoldeter Zierplättchen ver-
stehen zu sollen. Mit Un-
recht. Das opus anglicanum
kennt keine ihm eigentümliche
Sticktechniken; es bietet viel-
mehr lediglich dieselben Stiche
und Stickweisen, wie alle
übrigen gleichzeitigen Sticke-
reien. Die Verwendung von Zierplättchen aber
ist ihm so wenig eigentümlich, daß sich von
solchen auf den hervorragendsten englischen
Stickereien auch nicht eine Spur findet. Der
Ausdruck opus anglicanum will nur die Her-
kunft bezeichnen, gerade wie die andern in den
Inventaren vorkommenden Bezeichnungen opus
theotonium, opus florentinum, opus lucanum,
opus romanum oder de Romania,. opus graecum
u. a. Heute würden wir sagen englische,
deutsche, florentiner, griechische Arbeit oder
besser Stickerei. Denn bei Paramenten ge-
braucht hat das Wort opus die besondere
Bedeutung Stickerei, weshalb es auch bisweilen
in den Inventaren bei einem aller Stickerei
entbehrenden Gewände heißt: sine opere,
ohne Stickerei. Daß aber dies der Sinn von
opus anglicanum ist und daß mit diesem Aus-
druck nur oder doch in erster Linie die Her-
kunft bezeichnet werden soll, erhellt klar aus
dem Umstand, daß auch Erzeugnisse der
Goldschmiedekunst in den Schatzverzeichnissen
den Beisatz führen opus anglicanum. Daß
die englischen Stickereien gewisse stilistische
Abb. 3
Eigentümlichkeiten haben, durch die sie als
solche erkennbar sind, soll natürlich nicht
geleugnet werden. Indessen dürfte in der
Bezeichnung opus anglicanum wohl kaum
ein Hinweis auf eine gewisse Eigenart des
Stiles liegen. Oder gab es auch zwischen
dem opus lucanum, senense und florentinum
einen stilistischen Unterschied? Doch wohl
schwerlich. Ja man darf füglich fragen,
ob überhaupt das Mittelalter für feinere stili-
stische Unterschiede Sinn und Empfindung
hatte. Wenn wir sie infolge unserer kritischen
Sondierungen und alles zerlegenden Unter-
suchungen besitzen, dann beweist das noch
keineswegs, daß es so auch in den Tagen
des Mittelalters war. Verband sich mit opus
anglicanum, florentinum, graecum u. a. eine
Nebenbedeutung, so war es wohl lediglich die
einer besonders hervorragenden, renommierten,
nicht alltäglichen Arbeit.
Beispiele von opera angli-
| cana haben sich auf deutschem
Boden nur wenige erhalten.
Das bedeutendste sind leider
die sehr beschädigten Reste
eines englischen Bilderpluvi-
ales im Dom zu Salzburg.1) —
Der Dom besitzt übrigens
außer den kostbaren Resten des Pluviales noch
verschiedene andere bisher unveröffentlichte
mittelalterliche Paramente, von welchen ich für
jetzt nur eine Kasel aus dem XV. Jahrh. erwähnen
möchte, die durch ihren Stoff Beachtung ver-
dient. Sie ist nämlich nicht aus Seide, sondern
aus einem kräftigen, etwas gerauhten Baum-
vollzeug gemacht, welches in grünblauer Farbe
mit einem schönen Granatapfelmuster bedruckt
ist. Das Gewand hat leider nicht mehr seine
ursprüngliche Form. Mißt es doch heute auf
den Schultern nur noch 39 cm, im Rücken
91 cm. An Länge (1,28 vi) hat es aber wohl
kaum etwas eingebüßt. Vorn fehlt jeder Besatz.
Die Rückseite zeigt ein in Gold gesticktes
knorriges Kreuz mit aufgesetztem plastischem
Christuskorpus von dem bekannten Typus.
Luxemburg. Jos. Braun S. J.
') Die so wertvolle Stickerei verdient zweifellos
eine weit bessere und sorgfältige Aufbewahrung. Sie
hängt in ihrer ganzen Länge ausgespreitet, an einem
Ständer ohne allen Schutz und ohne jede
Bedeckung auf einer der Emporen des Domes. Ob
in der Schatzkammer für sie nicht der passende Platz
wäre?