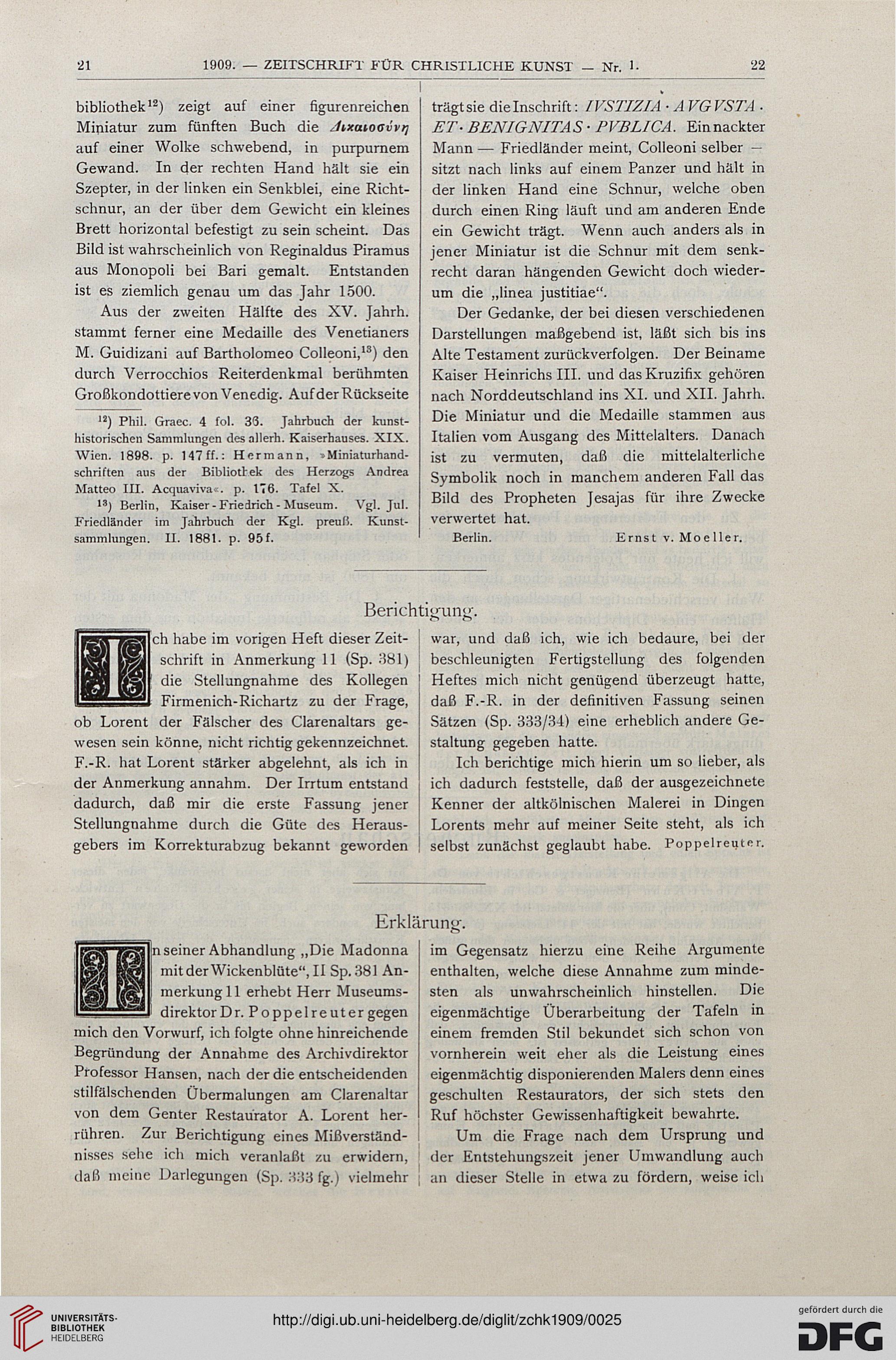n
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 1-
22
bibliothek12) zeigt auf einer figurenreichen
Miniatur zum fünften Buch die Jixouoovvq
auf einer Wolke schwebend, in purpurnem
Gewand. In der rechten Hand hält sie ein
Szepter, in der linken ein Senkblei, eine Richt-
schnur, an der über dem Gewicht ein kleines
Brett horizontal befestigt zu sein scheint. Das
Bild ist wahrscheinlich von Reginaldus Piramus
aus Monopoli bei Bari gemalt. Entstanden
ist es ziemlich genau um das Jahr 1500.
Aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrh.
stammt ferner eine Medaille des Venetianers
M. Guidizani auf Bartholomeo Colleoni,18) den
durch Verrocchios Reiterdenkmal berühmten
Großkondottiere von Venedig. Auf der Rückseite
12) Phil. Graec. 4 fol. 33. Jahrbuch der kunst-
historischen Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. XIX.
Wien. 1898. p. 147 ff.: Hermann, »Miniaturhand-
schriften aus der Bibliothek des Herzogs Andrea
Matteo III. Acquavivac p. 176. Tafel X.
13) Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum. Vgl. Jul.
Friedländer im Jahrbuch der Kgl. preuB. Kunst-
sammlungen. IL 1881. p. 95f.
trägt sie die Inschrift: IVSTIZIA ■ A VG VSTA ■
ET- BENIGNITA S • PVBLICA. Ein nackter
Mann — Friedländer meint, Colleoni selber —
sitzt nach links auf einem Panzer und hält in
der linken Hand eine Schnur, welche oben
durch einen Ring läuft und am anderen Ende
ein Gewicht trägt. Wenn auch anders als in
jener Miniatur ist die Schnur mit dem senk-
recht daran hängenden Gewicht doch wieder-
um die „linea justitiae".
Der Gedanke, der bei diesen verschiedenen
Darstellungen maßgebend ist, läßt sich bis ins
Alte Testament zurückverfolgen. Der Beiname
Kaiser Heinrichs III. und das Kruzifix gehören
nach Norddeutschland ins XI. und XII. Jahrh.
Die Miniatur und die Medaille stammen aus
Italien vom Ausgang des Mittelalters. Danach
ist zu vermuten, daß die mittelalterliche
Symbolik noch in manchem anderen Fall das
Bild des Propheten Jesajas für ihre Zwecke
verwertet hat.
Berlin. Ems t v. Mo e Her.
Berichtigung.
ch habe im vorigen Heft dieser Zeit-
schrift in Anmerkung 11 (Sp. 381)
die Stellungnahme des Kollegen
Firmenich-Richartz zu der Frage,
ob Lorent der Fälscher des Ciarenaltars ge-
wesen sein könne, nicht richtig gekennzeichnet.
F.-R. hat Lorent stärker abgelehnt, als ich in
der Anmerkung annahm. Der Irrtum entstand
dadurch, daß mir die erste Fassung jener
Stellungnahme durch die Güte des Heraus-
gebers im Korrekturabzug bekannt geworden
war, und daß ich, wie ich bedaure, bei der
beschleunigten Fertigstellung des folgenden
Heftes mich nicht genügend überzeugt hatte,
daß F.-R. in der definitiven Fassung seinen
Sätzen (Sp. 333/34) eine erheblich andere Ge-
staltung gegeben hatte.
Ich berichtige mich hierin um so lieber, als
ich dadurch feststelle, daß der ausgezeichnete
Kenner der altkölnischen Malerei in Dingen
Lorents mehr auf meiner Seite steht, als ich
selbst zunächst geglaubt habe. Poppelreuter.
Erklärum
n seiner Abhandlung „Die Madonna
mit der Wickenblüte", II Sp. 381 An-
merkung 11 erhebt Herr Museums-
direktorDr. Poppelreuter gegen
mich den Vorwurf, ich folgte ohne hinreichende
Begründung der Annahme des Archivdirektor
Professor Hansen, nach der die entscheidenden
stilfälschenden Übermalungen am Ciarenaltar
von dem Genter Restaurator A. Lorent her-
rühren. Zur Berichtigung eines Mißverständ-
nisses sehe ich mich veranlaßt zu erwidern,
daß meine Darlegungen (Sp. 333 fg.) vielmehr
im Gegensatz hierzu eine Reihe Argumente
enthalten, welche diese Annahme zum minde-
sten als unwahrscheinlich hinstellen. Die
eigenmächtige Überarbeitung der Tafeln in
einem fremden Stil bekundet sich schon von
vornherein weit eher als die Leistung eines
eigenmächtig disponierenden Malers denn eines
geschulten Restaurators, der sich stets den
Ruf höchster Gewissenhaftigkeit bewahrte.
Um die Frage nach dem Ursprung und
der Entstehungszeit jener Umwandlung auch
an dieser Stelle in etwa zu fördern, weise ich
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST - Nr. 1-
22
bibliothek12) zeigt auf einer figurenreichen
Miniatur zum fünften Buch die Jixouoovvq
auf einer Wolke schwebend, in purpurnem
Gewand. In der rechten Hand hält sie ein
Szepter, in der linken ein Senkblei, eine Richt-
schnur, an der über dem Gewicht ein kleines
Brett horizontal befestigt zu sein scheint. Das
Bild ist wahrscheinlich von Reginaldus Piramus
aus Monopoli bei Bari gemalt. Entstanden
ist es ziemlich genau um das Jahr 1500.
Aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrh.
stammt ferner eine Medaille des Venetianers
M. Guidizani auf Bartholomeo Colleoni,18) den
durch Verrocchios Reiterdenkmal berühmten
Großkondottiere von Venedig. Auf der Rückseite
12) Phil. Graec. 4 fol. 33. Jahrbuch der kunst-
historischen Sammlungen des allerh. Kaiserhauses. XIX.
Wien. 1898. p. 147 ff.: Hermann, »Miniaturhand-
schriften aus der Bibliothek des Herzogs Andrea
Matteo III. Acquavivac p. 176. Tafel X.
13) Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum. Vgl. Jul.
Friedländer im Jahrbuch der Kgl. preuB. Kunst-
sammlungen. IL 1881. p. 95f.
trägt sie die Inschrift: IVSTIZIA ■ A VG VSTA ■
ET- BENIGNITA S • PVBLICA. Ein nackter
Mann — Friedländer meint, Colleoni selber —
sitzt nach links auf einem Panzer und hält in
der linken Hand eine Schnur, welche oben
durch einen Ring läuft und am anderen Ende
ein Gewicht trägt. Wenn auch anders als in
jener Miniatur ist die Schnur mit dem senk-
recht daran hängenden Gewicht doch wieder-
um die „linea justitiae".
Der Gedanke, der bei diesen verschiedenen
Darstellungen maßgebend ist, läßt sich bis ins
Alte Testament zurückverfolgen. Der Beiname
Kaiser Heinrichs III. und das Kruzifix gehören
nach Norddeutschland ins XI. und XII. Jahrh.
Die Miniatur und die Medaille stammen aus
Italien vom Ausgang des Mittelalters. Danach
ist zu vermuten, daß die mittelalterliche
Symbolik noch in manchem anderen Fall das
Bild des Propheten Jesajas für ihre Zwecke
verwertet hat.
Berlin. Ems t v. Mo e Her.
Berichtigung.
ch habe im vorigen Heft dieser Zeit-
schrift in Anmerkung 11 (Sp. 381)
die Stellungnahme des Kollegen
Firmenich-Richartz zu der Frage,
ob Lorent der Fälscher des Ciarenaltars ge-
wesen sein könne, nicht richtig gekennzeichnet.
F.-R. hat Lorent stärker abgelehnt, als ich in
der Anmerkung annahm. Der Irrtum entstand
dadurch, daß mir die erste Fassung jener
Stellungnahme durch die Güte des Heraus-
gebers im Korrekturabzug bekannt geworden
war, und daß ich, wie ich bedaure, bei der
beschleunigten Fertigstellung des folgenden
Heftes mich nicht genügend überzeugt hatte,
daß F.-R. in der definitiven Fassung seinen
Sätzen (Sp. 333/34) eine erheblich andere Ge-
staltung gegeben hatte.
Ich berichtige mich hierin um so lieber, als
ich dadurch feststelle, daß der ausgezeichnete
Kenner der altkölnischen Malerei in Dingen
Lorents mehr auf meiner Seite steht, als ich
selbst zunächst geglaubt habe. Poppelreuter.
Erklärum
n seiner Abhandlung „Die Madonna
mit der Wickenblüte", II Sp. 381 An-
merkung 11 erhebt Herr Museums-
direktorDr. Poppelreuter gegen
mich den Vorwurf, ich folgte ohne hinreichende
Begründung der Annahme des Archivdirektor
Professor Hansen, nach der die entscheidenden
stilfälschenden Übermalungen am Ciarenaltar
von dem Genter Restaurator A. Lorent her-
rühren. Zur Berichtigung eines Mißverständ-
nisses sehe ich mich veranlaßt zu erwidern,
daß meine Darlegungen (Sp. 333 fg.) vielmehr
im Gegensatz hierzu eine Reihe Argumente
enthalten, welche diese Annahme zum minde-
sten als unwahrscheinlich hinstellen. Die
eigenmächtige Überarbeitung der Tafeln in
einem fremden Stil bekundet sich schon von
vornherein weit eher als die Leistung eines
eigenmächtig disponierenden Malers denn eines
geschulten Restaurators, der sich stets den
Ruf höchster Gewissenhaftigkeit bewahrte.
Um die Frage nach dem Ursprung und
der Entstehungszeit jener Umwandlung auch
an dieser Stelle in etwa zu fördern, weise ich