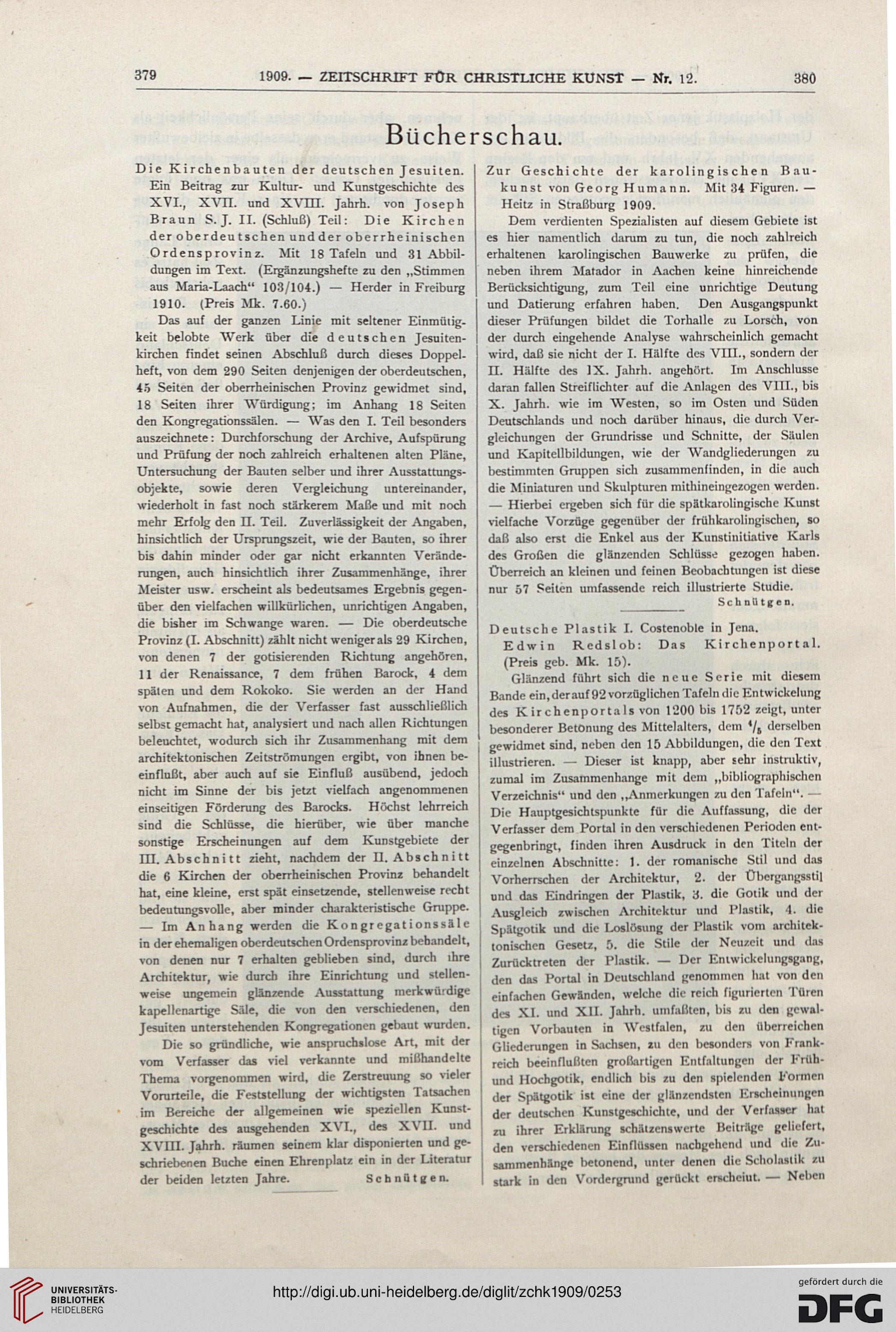379
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
380
Bücherschau.
Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten.
Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des
XVI., XVn. und XVm. Jahrh. von Joseph
Braun S. J. II. (Schluß) Teil: Die Kirchen
der oberdeutschen und der oberrheinischen
Ordensprovinz. Mit 18 Tafeln und 31 Abbil-
dungen im Text. (Ergänzungshefte zu den „Stimmen
aus Maria-Laach" 103/104.) — Herder in Freiburg
1910. (Preis Mk. 7.60.)
Das auf der ganzen Linie mit seltener Einmütig-
keit belobte "Werk über die deutschen Jesuiten-
kirchen findet seinen Abschluß durch dieses Doppel-
heft, von dem 290 Seiten denjenigen der oberdeutschen,
4ö Seiten der oberrheinischen Provinz gewidmet sind,
18 Seiten ihrer Würdigung; im Anhang 18 Seiten
den Kongregationssälen. — Was den I. Teil besonders
auszeichnete: Durchforschung der Archive, Aufspürung
und Prüfung der noch zahlreich erhaltenen alten Pläne,
Untersuchung der Bauten selber und ihrer Ausstattungs-
objekte, sowie deren Vergleichung untereinander,
wiederholt in fast noch stärkerem Maße und mit noch
mehr Erfolg den H. Teil. Zuverlässigkeit der Angaben,
hinsichtlich der Ursprungszeit, wie der Bauten, so ihrer
bis dahin minder oder gar nicht erkannten Verände-
rungen, auch hinsichtlich ihrer Zusammenhänge, ihrer
Meister usw. erscheint als bedeutsames Ergebnis gegen-
über den vielfachen willkürlichen, unrichtigen Angaben,
die bisher im Schwange waren. — Die oberdeutsche
Provinz (I. Abschnitt) zählt nicht weniger als 29 Kirchen,
von denen 7 der gotisierenden Richtung angehören,
11 der Renaissance, 7 dem frühen Barock, 4 dem
späten und dem Rokoko. Sie werden an der Hand
von Aufnahmen, die der Verfasser fast ausschließlich
selbst gemacht hat, analysiert und nach allen Richtungen
beleuchtet, wodurch sich ihr Zusammenhang mit dem
architektonischen Zeitströmungen ergibt, von ihnen be-
einflußt, aber auch auf sie Einfluß ausübend, jedoch
nicht im Sinne der bis jetzt vielfach angenommenen
einseitigen Förderung des Barocks. Höchst lehrreich
sind die Schlüsse, die hierüber, wie über manche
sonstige Erscheinungen auf dem Kunstgebiete der
ni. Abschnitt zieht, nachdem der II. Abschnitt
die 6 Kirchen der oberrheinischen Provinz behandelt
hat, eine kleine, erst spät einsetzende, stellenweise recht
bedeutungsvolle, aber minder charakteristische Gruppe.
— Im Anhang werden die Kongregationssäle
in der ehemaligen oberdeutschen Ordensprovinz behandelt,
von denen nur 7 erhalten geblieben sind, durch ihre
Architektur, wie durch ihre Einrichtung und stellen-
weise ungemein glänzende Ausstattung merkwmdige
kapellenartige Säle, die von den verschiedenen, den
Jesuiten unterstehenden Kongregationen gebaut wurden.
Die so gründliche, wie anspruchslose Art, mit der
vom Verfasser das viel verkannte und mißhandelte
Thema vorgenommen wird, die Zerstreuung so vieler
Vorurteile, die Feststellung der wichtigsten Tatsachen
im Bereiche der allgemeinen wie speziellen Kun-t-
geschichte des ausgehenden XVI., des XVII. und
XVHI. Jahrh. räumen seinem klar disponierten und ge-
schriebenen Buche einen Ehrenplatz ein in der Literatur
der beiden letzten Jahre. Schnütgen.
Zur Geschichte der karoling is che n Bau-
kunst von Georg Humann. Mit 34 Figuren. —
Hcitz in Straßburg 1909.
Dem verdienten Spezialisten auf diesem Gebiete ist
es hier namentlich darum zu tun, die noch zahlreich
erhaltenen karolingischen Bauwerke zu prüfen, die
neben ihrem Matador in Aachen keine hinreichende
Berücksichtigung, zum Teil eine unrichtige Deutung
und Datierung erfahren haben. Den Ausgangspunkt
dieser Prüfungen bildet die Torhalle zu Lorsch, von
der durch eingehende Analyse wahrscheinlich gemacht
wird, daß sie nicht der I. Hälfte des VIII., sondern der
II. Hälfte des IX. Jahrh. angehört. Im Anschlüsse
daran fallen Streiflichter auf die Anlagen des VIII., bis
X. Jahrh. wie im Westen, so im Osten und Süden
Deutschlands und noch darüber hinaus, die durch Ver-
gleichungen der Grundrisse und Schnitte, der Säulen
und Kapitellbildungen, wie der Wandgliedcrungen zu
bestimmten Gruppen sich zusammenfinden, in die auch
die Miniaturen und Skulpturen mithineingezogen werden.
— Hierbei ergeben sich für die spätkarolingische Kunst
vielfache Vorzüge gegenüber der frühkarolingischen, so
daß also erst die Enkel aus der Kunstinitiative Karls
des Großen die glänzenden Schlüsse gezogen haben.
Überreich an kleinen und feinen Beobachtungen ist diese
nur 57 Seiten umfassende reich illustrierte Studie.
SchnUtgen.
Deutsche Plastik I. Costenoble in Jena.
Edwin Redslob: Das Kirchen portal.
(Preis geb. Mk. 15).
Glänzend führt sich die neue Serie mit diesem
Bande ein,derauf 92 vorzüglichen Tafeln die Entwickelung
des Kirchenportals von 1200 bis 1752 zeigt, unter
besonderer Betonung des Mittelalters, dem '/, derselben
gewidmet sind, neben den 15 Abbildungen, die den Text
illustrieren. — Dieser ist knapp, aber sehr instruktiv,
zumal im Zusammenhange mit dem „bibliographischen
Verzeichnis" und den .Anmerkungen zu den Tafeln". —
Die Hauptgesichtspunkte für die Auffassung, die der
Verfasser dem Portal in den verschiedenen Perioden ent-
gegenbringt, finden ihren Ausdruck in den Titeln der
einzelnen Abschnitte: 1. der romanische Stil und das
Vorherrschen der Architektur, 2. der Übergangsstil
und das Eindringen der Plastik, 3. die Gotik und der
Ausgleich zwischen Architektur und Plastik, 1. die
Spätgotik und die Loslösung der Plastik vom architek-
tonischen Gesetz, 5. die Stile der Neuzeit und das
Zurücktreten der Plastik. — Der Emwickclungsgang,
den das Portal in Deutschland genommen hat von den
einfachen Gewänden, welche die reich figurierten Türen
des XI. und XII. Jahrh. umfaßten, bis zu den gewal-
tigen Vorbauten in Westfalen, zu den überreichen
Gliederungen in Sachsen, zu den besonders von Frank-
reich beeinflußten großartigen Entfaltungen der Früh-
uml Hochgotik, endlich bis zu den spielenden Formen
der Spätgotik ist eine der glänzendsten Erscheinungen
der deutschen Kunstgeschichte, und der Verfasser hal
zu ihrer Erklärung schätzenswerte Beiträge geliefert,
den verschiedenen Einflüssen nachgehend und die Zu-
sammenhänge betonend, unter denen die Scholastik zu
stark in den Vordergrund gerückt erscheiut. — Neben
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.
380
Bücherschau.
Die Kirchenbauten der deutschen Jesuiten.
Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte des
XVI., XVn. und XVm. Jahrh. von Joseph
Braun S. J. II. (Schluß) Teil: Die Kirchen
der oberdeutschen und der oberrheinischen
Ordensprovinz. Mit 18 Tafeln und 31 Abbil-
dungen im Text. (Ergänzungshefte zu den „Stimmen
aus Maria-Laach" 103/104.) — Herder in Freiburg
1910. (Preis Mk. 7.60.)
Das auf der ganzen Linie mit seltener Einmütig-
keit belobte "Werk über die deutschen Jesuiten-
kirchen findet seinen Abschluß durch dieses Doppel-
heft, von dem 290 Seiten denjenigen der oberdeutschen,
4ö Seiten der oberrheinischen Provinz gewidmet sind,
18 Seiten ihrer Würdigung; im Anhang 18 Seiten
den Kongregationssälen. — Was den I. Teil besonders
auszeichnete: Durchforschung der Archive, Aufspürung
und Prüfung der noch zahlreich erhaltenen alten Pläne,
Untersuchung der Bauten selber und ihrer Ausstattungs-
objekte, sowie deren Vergleichung untereinander,
wiederholt in fast noch stärkerem Maße und mit noch
mehr Erfolg den H. Teil. Zuverlässigkeit der Angaben,
hinsichtlich der Ursprungszeit, wie der Bauten, so ihrer
bis dahin minder oder gar nicht erkannten Verände-
rungen, auch hinsichtlich ihrer Zusammenhänge, ihrer
Meister usw. erscheint als bedeutsames Ergebnis gegen-
über den vielfachen willkürlichen, unrichtigen Angaben,
die bisher im Schwange waren. — Die oberdeutsche
Provinz (I. Abschnitt) zählt nicht weniger als 29 Kirchen,
von denen 7 der gotisierenden Richtung angehören,
11 der Renaissance, 7 dem frühen Barock, 4 dem
späten und dem Rokoko. Sie werden an der Hand
von Aufnahmen, die der Verfasser fast ausschließlich
selbst gemacht hat, analysiert und nach allen Richtungen
beleuchtet, wodurch sich ihr Zusammenhang mit dem
architektonischen Zeitströmungen ergibt, von ihnen be-
einflußt, aber auch auf sie Einfluß ausübend, jedoch
nicht im Sinne der bis jetzt vielfach angenommenen
einseitigen Förderung des Barocks. Höchst lehrreich
sind die Schlüsse, die hierüber, wie über manche
sonstige Erscheinungen auf dem Kunstgebiete der
ni. Abschnitt zieht, nachdem der II. Abschnitt
die 6 Kirchen der oberrheinischen Provinz behandelt
hat, eine kleine, erst spät einsetzende, stellenweise recht
bedeutungsvolle, aber minder charakteristische Gruppe.
— Im Anhang werden die Kongregationssäle
in der ehemaligen oberdeutschen Ordensprovinz behandelt,
von denen nur 7 erhalten geblieben sind, durch ihre
Architektur, wie durch ihre Einrichtung und stellen-
weise ungemein glänzende Ausstattung merkwmdige
kapellenartige Säle, die von den verschiedenen, den
Jesuiten unterstehenden Kongregationen gebaut wurden.
Die so gründliche, wie anspruchslose Art, mit der
vom Verfasser das viel verkannte und mißhandelte
Thema vorgenommen wird, die Zerstreuung so vieler
Vorurteile, die Feststellung der wichtigsten Tatsachen
im Bereiche der allgemeinen wie speziellen Kun-t-
geschichte des ausgehenden XVI., des XVII. und
XVHI. Jahrh. räumen seinem klar disponierten und ge-
schriebenen Buche einen Ehrenplatz ein in der Literatur
der beiden letzten Jahre. Schnütgen.
Zur Geschichte der karoling is che n Bau-
kunst von Georg Humann. Mit 34 Figuren. —
Hcitz in Straßburg 1909.
Dem verdienten Spezialisten auf diesem Gebiete ist
es hier namentlich darum zu tun, die noch zahlreich
erhaltenen karolingischen Bauwerke zu prüfen, die
neben ihrem Matador in Aachen keine hinreichende
Berücksichtigung, zum Teil eine unrichtige Deutung
und Datierung erfahren haben. Den Ausgangspunkt
dieser Prüfungen bildet die Torhalle zu Lorsch, von
der durch eingehende Analyse wahrscheinlich gemacht
wird, daß sie nicht der I. Hälfte des VIII., sondern der
II. Hälfte des IX. Jahrh. angehört. Im Anschlüsse
daran fallen Streiflichter auf die Anlagen des VIII., bis
X. Jahrh. wie im Westen, so im Osten und Süden
Deutschlands und noch darüber hinaus, die durch Ver-
gleichungen der Grundrisse und Schnitte, der Säulen
und Kapitellbildungen, wie der Wandgliedcrungen zu
bestimmten Gruppen sich zusammenfinden, in die auch
die Miniaturen und Skulpturen mithineingezogen werden.
— Hierbei ergeben sich für die spätkarolingische Kunst
vielfache Vorzüge gegenüber der frühkarolingischen, so
daß also erst die Enkel aus der Kunstinitiative Karls
des Großen die glänzenden Schlüsse gezogen haben.
Überreich an kleinen und feinen Beobachtungen ist diese
nur 57 Seiten umfassende reich illustrierte Studie.
SchnUtgen.
Deutsche Plastik I. Costenoble in Jena.
Edwin Redslob: Das Kirchen portal.
(Preis geb. Mk. 15).
Glänzend führt sich die neue Serie mit diesem
Bande ein,derauf 92 vorzüglichen Tafeln die Entwickelung
des Kirchenportals von 1200 bis 1752 zeigt, unter
besonderer Betonung des Mittelalters, dem '/, derselben
gewidmet sind, neben den 15 Abbildungen, die den Text
illustrieren. — Dieser ist knapp, aber sehr instruktiv,
zumal im Zusammenhange mit dem „bibliographischen
Verzeichnis" und den .Anmerkungen zu den Tafeln". —
Die Hauptgesichtspunkte für die Auffassung, die der
Verfasser dem Portal in den verschiedenen Perioden ent-
gegenbringt, finden ihren Ausdruck in den Titeln der
einzelnen Abschnitte: 1. der romanische Stil und das
Vorherrschen der Architektur, 2. der Übergangsstil
und das Eindringen der Plastik, 3. die Gotik und der
Ausgleich zwischen Architektur und Plastik, 1. die
Spätgotik und die Loslösung der Plastik vom architek-
tonischen Gesetz, 5. die Stile der Neuzeit und das
Zurücktreten der Plastik. — Der Emwickclungsgang,
den das Portal in Deutschland genommen hat von den
einfachen Gewänden, welche die reich figurierten Türen
des XI. und XII. Jahrh. umfaßten, bis zu den gewal-
tigen Vorbauten in Westfalen, zu den überreichen
Gliederungen in Sachsen, zu den besonders von Frank-
reich beeinflußten großartigen Entfaltungen der Früh-
uml Hochgotik, endlich bis zu den spielenden Formen
der Spätgotik ist eine der glänzendsten Erscheinungen
der deutschen Kunstgeschichte, und der Verfasser hal
zu ihrer Erklärung schätzenswerte Beiträge geliefert,
den verschiedenen Einflüssen nachgehend und die Zu-
sammenhänge betonend, unter denen die Scholastik zu
stark in den Vordergrund gerückt erscheiut. — Neben