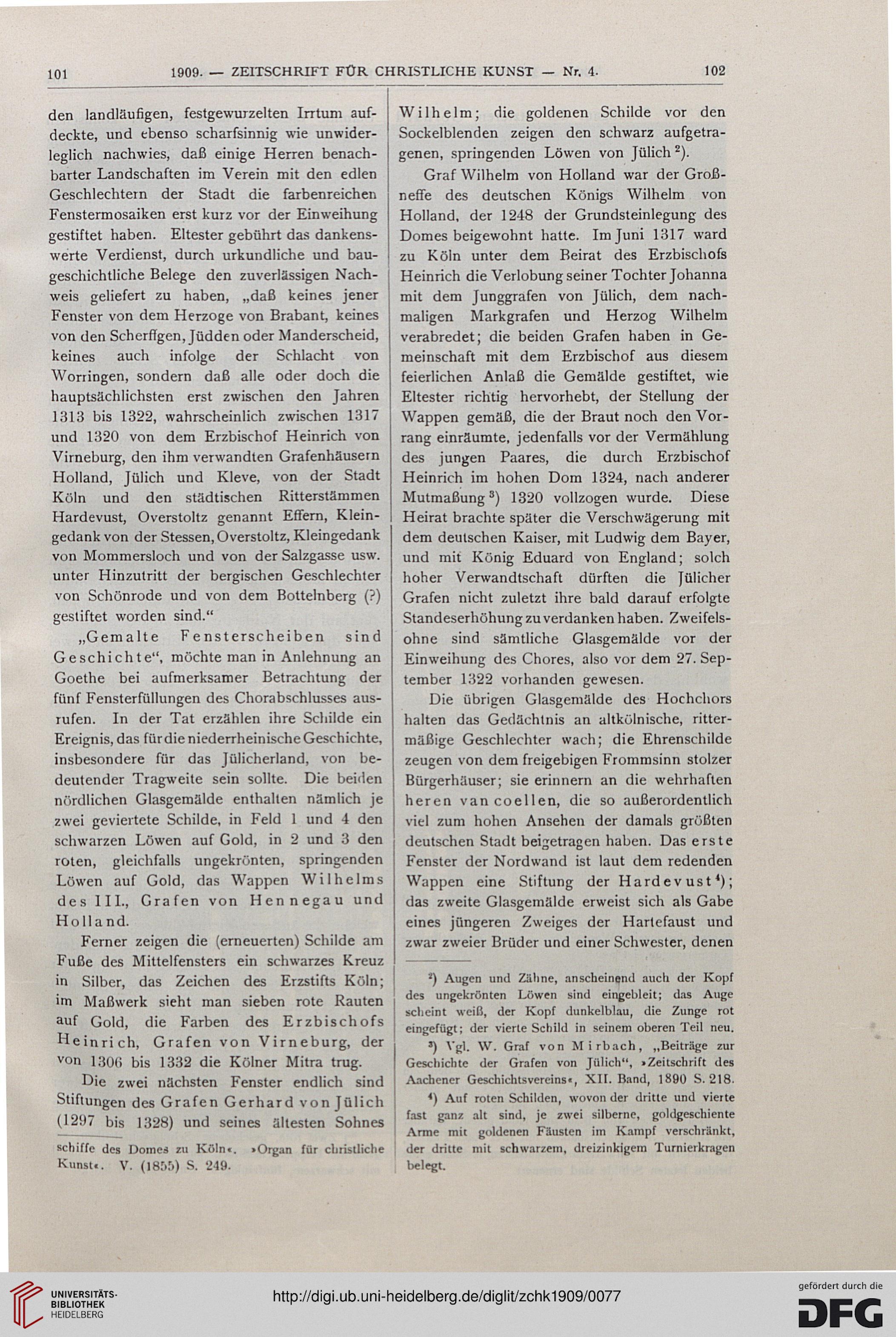101
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
102
den landläufigen, festgewurzelten Irrtum auf-
deckte, und ebenso scharfsinnig wie unwider-
leglich nachwies, daß einige Herren benach-
barter Landschaften im Verein mit den edlen
Geschlechtern der Stadt die farbenreichen
Fenstermosaiken erst kurz vor der Einweihung
gestiftet haben. Eltester gebührt das dankens-
werte Verdienst, durch urkundliche und bau-
geschichtliche Belege den zuverlässigen Nach-
weis geliefert zu haben, „daß keines jener
Fenster von dem Herzoge von Brabant, keines
von den Scherffgen, Jüdden oder Manderscheid,
keines auch infolge der Schlacht von
Worringen, sondern daß alle oder doch die
hauptsächlichsten erst zwischen den Jahren
1313 bis 1322, wahrscheinlich zwischen 1317
und 1320 von dem Erzbischof Heinrich von
Virneburg, den ihm verwandten Grafenhäusern
Holland, Jülich und Kleve, von der Stadt
Köln und den städtischen Ritterstämmen
Hardevust, Overstoltz genannt EfTern, Klein-
gedank von der Stessen, Overstoltz, Kleingedank
von Mommersloch und von der Salzgasse usw.
unter Hinzutritt der bergischen Geschlechter
von Schönrode und von dem Bottelnberg (?)
gestiftet worden sind."
„Gemalte Fensterscheiben sind
Geschichte", möchte man in Anlehnung an
Goethe bei aufmerksamer Betrachtung der
fünf Fensterfüllungen des Chorabschlusses aus-
rufen. In der Tat erzählen ihre Schilde ein
Ereignis, das fürdie niederrheinische Geschichte,
insbesondere für das Jülicherland, von be-
deutender Tragweite sein sollte. Die beiden
nördlichen Glasgemälde enthalten nämlich je
zwei geviertete Schilde, in Feld 1 und 4 den
schwarzen Löwen auf Gold, in 2 und 3 den
roten, gleichfalls ungekrönten, springenden
Löwen auf Gold, das Wappen Wilhelms
des III., Crafen von Hennegau und
Holland.
Ferner zeigen die (erneuerten) Schilde am
Fuße des Mittelfensters ein schwarzes Kreuz
in Silber, das Zeichen des Erzstifts Köln;
im Maßwerk sieht man sieben rote Rauten
auf Gold, die Farben des Erzbischofs
"einrich, Grafen von Virneburg, der
von 1306 bis 1332 die Kölner Mitra trug.
Die zwei nächsten Fenster endlich sind
Stiftungen des Grafen Gerhard von Jülich
(1^97 bis 1328) und seines ältesten Sohnes
schiffe des Domes zu Kölm. »Organ für christliche
Kunst«. V. (18,r>f>) S. 249.
Wilhelm; die goldenen Schilde vor den
Sockelblenden zeigen den schwarz aufgetra-
genen, springenden Löwen von Jülich2).
Graf Wilhelm von Holland war der Groß-
neffe des deutschen Königs Wilhelm von
Holland, der 1248 der Grundsteinlegung des
Domes beigewohnt hatte. Im Juni 1317 ward
zu Köln unter dem Beirat des Erzbischofs
Heinrich die Verlobung seiner Tochter Johanna
mit dem Junggrafen von Jülich, dem nach-
maligen Markgrafen und Herzog Wilhelm
verabredet; die beiden Grafen haben in Ge-
meinschaft mit dem Erzbischof aus diesem
feierlichen Anlaß die Gemälde gestiftet, wie
Eltester richtig hervorhebt, der Stellung der
Wappen gemäß, die der Braut noch den Vor-
rang einräumte, jedenfalls vor der Vermählung
des jungen Paares, die durch Erzbischof
Heinrich im hohen Dom 1324, nach anderer
Mutmaßung3) 1320 vollzogen wurde. Diese
Heirat brachte später die Verschwägerung mit
dem deutschen Kaiser, mit Ludwig dem Bayer,
und mit König Eduard von England; solch
hoher Verwandtschaft dürften die Jülicher
Grafen nicht zuletzt ihre bald darauf erfolgte
Standeserhöhung zu verdanken haben. Zweifels-
ohne sind sämtliche Glasgemälde vor der
Einweihung des Chores, also vor dem 27. Sep-
tember 1322 vorhanden gewesen.
Die übrigen Glasgemälde des Hochchors
halten das Gedächtnis an altkölnische, ritter-
mäßige Geschlechter wach; die Ehrenschilde
zeugen von dem freigebigen Frommsinn stolzer
Bürgerhäuser; sie erinnern an die wehrhaften
heren vancoellen, die so außerordentlich
viel zum hohen Ansehen der damals größten
deutschen Stadt beigetragen haben. Das erste
Fenster der Nordwand ist laut dem redenden
Wappen eine Stiftung der Hardevust4);
das zweite Glasgemälde erweist sich als Gabe
eines jüngeren Zweiges der Hartefaust und
zwar zweier Brüder und einer Schwester, denen
a) Augen und Zähne, anscheinend auch der Kopf
des ungekrönten Löwen sind eingcbleit; das Auge
scheint weiß, der Kopf dunkelblau, die Zunge rot
eingefügt; der vierte Schild in seinem oberen Teil neu.
') ^ S'- W- Graf von Mirbach, „Beiträge zur
Geschichte der Grafen von Jülich", »Zeitschrift des
Aachener Geschichtsvereins«, XII. Band, 1890 S. 218.
4) Auf roten Schilden, wovon der dritte und vierte
fast ganz alt sind, je zwei silberne, goldgeschiente
Arme mit goldenen Fäusten im Kampf verschränkt,
der dritte mit schwarzem, dreizinkigem Turnierkragen
belegt.
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.
102
den landläufigen, festgewurzelten Irrtum auf-
deckte, und ebenso scharfsinnig wie unwider-
leglich nachwies, daß einige Herren benach-
barter Landschaften im Verein mit den edlen
Geschlechtern der Stadt die farbenreichen
Fenstermosaiken erst kurz vor der Einweihung
gestiftet haben. Eltester gebührt das dankens-
werte Verdienst, durch urkundliche und bau-
geschichtliche Belege den zuverlässigen Nach-
weis geliefert zu haben, „daß keines jener
Fenster von dem Herzoge von Brabant, keines
von den Scherffgen, Jüdden oder Manderscheid,
keines auch infolge der Schlacht von
Worringen, sondern daß alle oder doch die
hauptsächlichsten erst zwischen den Jahren
1313 bis 1322, wahrscheinlich zwischen 1317
und 1320 von dem Erzbischof Heinrich von
Virneburg, den ihm verwandten Grafenhäusern
Holland, Jülich und Kleve, von der Stadt
Köln und den städtischen Ritterstämmen
Hardevust, Overstoltz genannt EfTern, Klein-
gedank von der Stessen, Overstoltz, Kleingedank
von Mommersloch und von der Salzgasse usw.
unter Hinzutritt der bergischen Geschlechter
von Schönrode und von dem Bottelnberg (?)
gestiftet worden sind."
„Gemalte Fensterscheiben sind
Geschichte", möchte man in Anlehnung an
Goethe bei aufmerksamer Betrachtung der
fünf Fensterfüllungen des Chorabschlusses aus-
rufen. In der Tat erzählen ihre Schilde ein
Ereignis, das fürdie niederrheinische Geschichte,
insbesondere für das Jülicherland, von be-
deutender Tragweite sein sollte. Die beiden
nördlichen Glasgemälde enthalten nämlich je
zwei geviertete Schilde, in Feld 1 und 4 den
schwarzen Löwen auf Gold, in 2 und 3 den
roten, gleichfalls ungekrönten, springenden
Löwen auf Gold, das Wappen Wilhelms
des III., Crafen von Hennegau und
Holland.
Ferner zeigen die (erneuerten) Schilde am
Fuße des Mittelfensters ein schwarzes Kreuz
in Silber, das Zeichen des Erzstifts Köln;
im Maßwerk sieht man sieben rote Rauten
auf Gold, die Farben des Erzbischofs
"einrich, Grafen von Virneburg, der
von 1306 bis 1332 die Kölner Mitra trug.
Die zwei nächsten Fenster endlich sind
Stiftungen des Grafen Gerhard von Jülich
(1^97 bis 1328) und seines ältesten Sohnes
schiffe des Domes zu Kölm. »Organ für christliche
Kunst«. V. (18,r>f>) S. 249.
Wilhelm; die goldenen Schilde vor den
Sockelblenden zeigen den schwarz aufgetra-
genen, springenden Löwen von Jülich2).
Graf Wilhelm von Holland war der Groß-
neffe des deutschen Königs Wilhelm von
Holland, der 1248 der Grundsteinlegung des
Domes beigewohnt hatte. Im Juni 1317 ward
zu Köln unter dem Beirat des Erzbischofs
Heinrich die Verlobung seiner Tochter Johanna
mit dem Junggrafen von Jülich, dem nach-
maligen Markgrafen und Herzog Wilhelm
verabredet; die beiden Grafen haben in Ge-
meinschaft mit dem Erzbischof aus diesem
feierlichen Anlaß die Gemälde gestiftet, wie
Eltester richtig hervorhebt, der Stellung der
Wappen gemäß, die der Braut noch den Vor-
rang einräumte, jedenfalls vor der Vermählung
des jungen Paares, die durch Erzbischof
Heinrich im hohen Dom 1324, nach anderer
Mutmaßung3) 1320 vollzogen wurde. Diese
Heirat brachte später die Verschwägerung mit
dem deutschen Kaiser, mit Ludwig dem Bayer,
und mit König Eduard von England; solch
hoher Verwandtschaft dürften die Jülicher
Grafen nicht zuletzt ihre bald darauf erfolgte
Standeserhöhung zu verdanken haben. Zweifels-
ohne sind sämtliche Glasgemälde vor der
Einweihung des Chores, also vor dem 27. Sep-
tember 1322 vorhanden gewesen.
Die übrigen Glasgemälde des Hochchors
halten das Gedächtnis an altkölnische, ritter-
mäßige Geschlechter wach; die Ehrenschilde
zeugen von dem freigebigen Frommsinn stolzer
Bürgerhäuser; sie erinnern an die wehrhaften
heren vancoellen, die so außerordentlich
viel zum hohen Ansehen der damals größten
deutschen Stadt beigetragen haben. Das erste
Fenster der Nordwand ist laut dem redenden
Wappen eine Stiftung der Hardevust4);
das zweite Glasgemälde erweist sich als Gabe
eines jüngeren Zweiges der Hartefaust und
zwar zweier Brüder und einer Schwester, denen
a) Augen und Zähne, anscheinend auch der Kopf
des ungekrönten Löwen sind eingcbleit; das Auge
scheint weiß, der Kopf dunkelblau, die Zunge rot
eingefügt; der vierte Schild in seinem oberen Teil neu.
') ^ S'- W- Graf von Mirbach, „Beiträge zur
Geschichte der Grafen von Jülich", »Zeitschrift des
Aachener Geschichtsvereins«, XII. Band, 1890 S. 218.
4) Auf roten Schilden, wovon der dritte und vierte
fast ganz alt sind, je zwei silberne, goldgeschiente
Arme mit goldenen Fäusten im Kampf verschränkt,
der dritte mit schwarzem, dreizinkigem Turnierkragen
belegt.