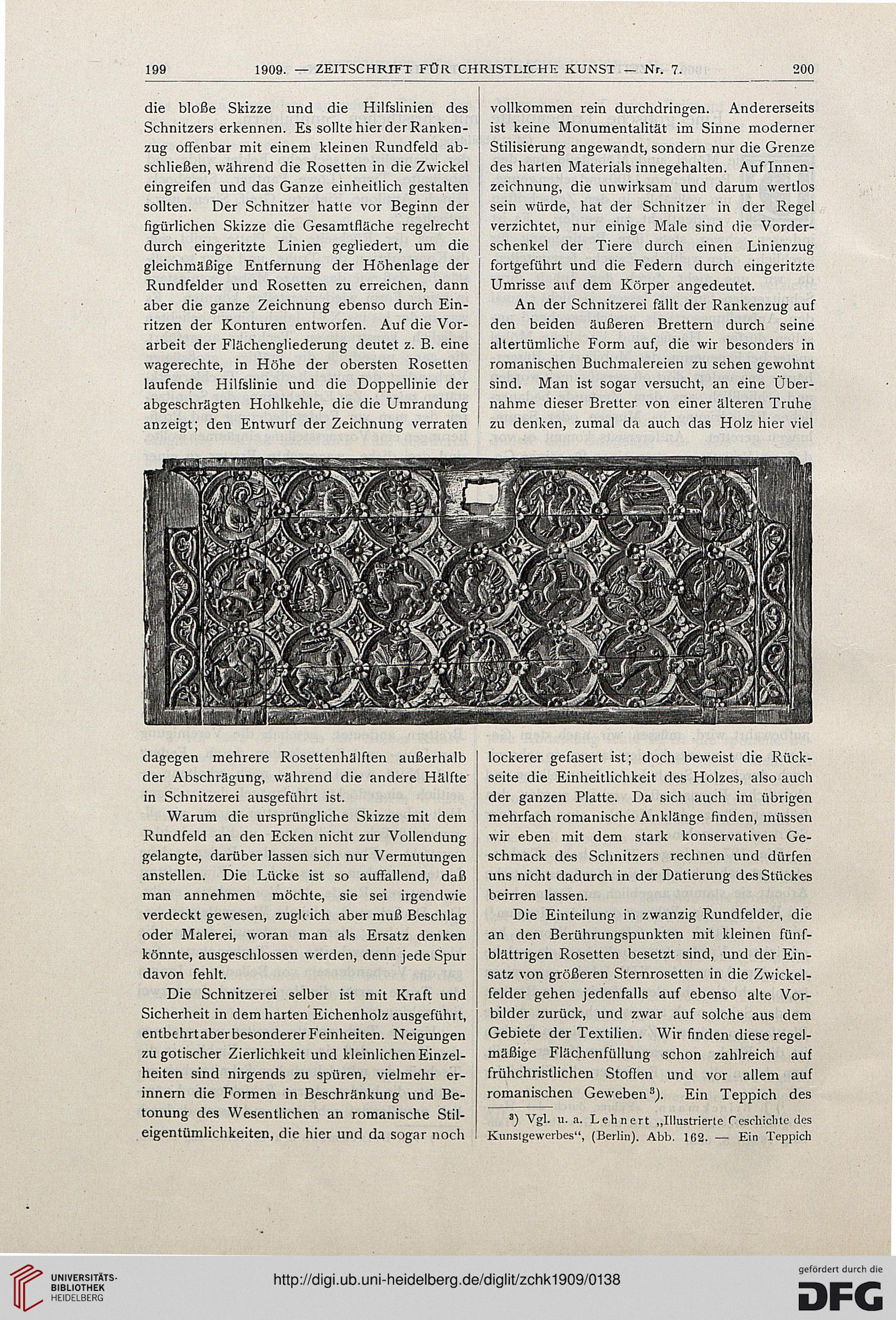199
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
200
die bloße Skizze und die Hilfslinien des
Schnitzers erkennen. Es sollte hier der Ranken-
zug offenbar mit einem kleinen Rundfeld ab-
schließen, während die Rosetten in die Zwickel
eingreifen und das Ganze einheitlich gestalten
sollten. Der Schnitzer hatte vor Beginn der
figürlichen Skizze die Gesamtfläche regelrecht
durch eingeritzte Linien gegliedert, um die
gleichmäßige Entfernung der Höhenlage der
Rundfelder und Rosetten zu erreichen, dann
aber die ganze Zeichnung ebenso durch Ein-
ritzen der Konturen entworfen. Auf die Vor-
arbeit der Flächengliederung deutet z. B. eine
wagerechte, in Höhe der obersten Rosetten
laufende Hilfslinie und die Doppellinie der
abgeschrägten Hohlkehle, die die Umrandung
anzeigt; den Entwurf der Zeichnung verraten
vollkommen rein durchdringen. Andererseits
ist keine Monumentalität im Sinne moderner
Stilisierung angewandt, sondern nur die Grenze
des harten Materials innegehalten. Auf Innen-
zeichnung, die unwirksam und darum wertlos
sein würde, hat der Schnitzer in der Regel
verzichtet, nur einige Male sind die Vorder-
schenkel der Tiere durch einen Linienzug
fortgeführt und die Federn durch eingeritzte
Umrisse auf dem Körper angedeutet.
An der Schnitzerei fällt der Rankenzug auf
den beiden äußeren Brettern durch seine
altertümliche Form auf, die wir besonders in
romanischen Buchmalereien zu sehen gewohnt
sind. Man ist sogar versucht, an eine Über-
nahme dieser Bretter von einer älteren Truhe
zu denken, zumal da auch das Holz hier viel
dagegen mehrere Rosettenhälften außerhalb
der Abschrägung, während die andere Hälfte
in Schnitzerei ausgeführt ist.
Warum die ursprüngliche Skizze mit dem
Rundfeld an den Ecken nicht zur Vollendung
gelangte, darüber lassen sich nur Vermutungen
anstellen. Die Lücke ist so auffallend, daß
man annehmen möchte, sie sei irgendwie
verdeckt gewesen, zuglc ich aber muß Beschlag
oder Malerei, woran man als Ersatz denken
könnte, ausgeschlossen werden, denn jede Spur
davon fehlt.
Die Schnitzerei selber ist mit Kraft und
Sicherheit in dem harten Eichenholz ausgeführt,
entbehrt aber besonderer Feinheiten. Neigungen
zu gotischer Zierlichkeit und kleinlichen Einzel-
heiten sind nirgends zu spüren, vielmehr er-
innern die Formen in Beschränkung und Be-
tonung des Wesentlichen an romanische Stil-
eigentümlichkeiten, die hier und da sogar noch
lockerer gefasert ist; doch beweist die Rück-
seite die Einheitlichkeit des Holzes, also auch
der ganzen Platte. Da sich auch im übrigen
mehrfach romanische Anklänge finden, müssen
wir eben mit dem stark konservativen Ge-
schmack des Schnitzers rechnen und dürfen
uns nicht dadurch in der Datierung des Stückes
beirren lassen.
Die Einteilung in zwanzig Rundfelder, die
an den Berührungspunkten mit kleinen fünf-
blättrigen Rosetten besetzt sind, und der Ein-
satz von größeren Sternrosetten in die Zwickel-
felder gehen jedenfalls auf ebenso alte Vor-
bilder zurück, und zwar auf solche aus dem
Gebiete der Textilien. Wir finden diese regel-
mäßige Flächenfüllung schon zahlreich auf
frühchristlichen Stoffen und vor allem auf
romanischen Geweben3). Ein Teppich des
3) vgl- u- a- Lehnert „Illustrierte Geschichte des
Kunstgewerbes", (Berlin). Abb. 162. — Ein Teppich
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
200
die bloße Skizze und die Hilfslinien des
Schnitzers erkennen. Es sollte hier der Ranken-
zug offenbar mit einem kleinen Rundfeld ab-
schließen, während die Rosetten in die Zwickel
eingreifen und das Ganze einheitlich gestalten
sollten. Der Schnitzer hatte vor Beginn der
figürlichen Skizze die Gesamtfläche regelrecht
durch eingeritzte Linien gegliedert, um die
gleichmäßige Entfernung der Höhenlage der
Rundfelder und Rosetten zu erreichen, dann
aber die ganze Zeichnung ebenso durch Ein-
ritzen der Konturen entworfen. Auf die Vor-
arbeit der Flächengliederung deutet z. B. eine
wagerechte, in Höhe der obersten Rosetten
laufende Hilfslinie und die Doppellinie der
abgeschrägten Hohlkehle, die die Umrandung
anzeigt; den Entwurf der Zeichnung verraten
vollkommen rein durchdringen. Andererseits
ist keine Monumentalität im Sinne moderner
Stilisierung angewandt, sondern nur die Grenze
des harten Materials innegehalten. Auf Innen-
zeichnung, die unwirksam und darum wertlos
sein würde, hat der Schnitzer in der Regel
verzichtet, nur einige Male sind die Vorder-
schenkel der Tiere durch einen Linienzug
fortgeführt und die Federn durch eingeritzte
Umrisse auf dem Körper angedeutet.
An der Schnitzerei fällt der Rankenzug auf
den beiden äußeren Brettern durch seine
altertümliche Form auf, die wir besonders in
romanischen Buchmalereien zu sehen gewohnt
sind. Man ist sogar versucht, an eine Über-
nahme dieser Bretter von einer älteren Truhe
zu denken, zumal da auch das Holz hier viel
dagegen mehrere Rosettenhälften außerhalb
der Abschrägung, während die andere Hälfte
in Schnitzerei ausgeführt ist.
Warum die ursprüngliche Skizze mit dem
Rundfeld an den Ecken nicht zur Vollendung
gelangte, darüber lassen sich nur Vermutungen
anstellen. Die Lücke ist so auffallend, daß
man annehmen möchte, sie sei irgendwie
verdeckt gewesen, zuglc ich aber muß Beschlag
oder Malerei, woran man als Ersatz denken
könnte, ausgeschlossen werden, denn jede Spur
davon fehlt.
Die Schnitzerei selber ist mit Kraft und
Sicherheit in dem harten Eichenholz ausgeführt,
entbehrt aber besonderer Feinheiten. Neigungen
zu gotischer Zierlichkeit und kleinlichen Einzel-
heiten sind nirgends zu spüren, vielmehr er-
innern die Formen in Beschränkung und Be-
tonung des Wesentlichen an romanische Stil-
eigentümlichkeiten, die hier und da sogar noch
lockerer gefasert ist; doch beweist die Rück-
seite die Einheitlichkeit des Holzes, also auch
der ganzen Platte. Da sich auch im übrigen
mehrfach romanische Anklänge finden, müssen
wir eben mit dem stark konservativen Ge-
schmack des Schnitzers rechnen und dürfen
uns nicht dadurch in der Datierung des Stückes
beirren lassen.
Die Einteilung in zwanzig Rundfelder, die
an den Berührungspunkten mit kleinen fünf-
blättrigen Rosetten besetzt sind, und der Ein-
satz von größeren Sternrosetten in die Zwickel-
felder gehen jedenfalls auf ebenso alte Vor-
bilder zurück, und zwar auf solche aus dem
Gebiete der Textilien. Wir finden diese regel-
mäßige Flächenfüllung schon zahlreich auf
frühchristlichen Stoffen und vor allem auf
romanischen Geweben3). Ein Teppich des
3) vgl- u- a- Lehnert „Illustrierte Geschichte des
Kunstgewerbes", (Berlin). Abb. 162. — Ein Teppich