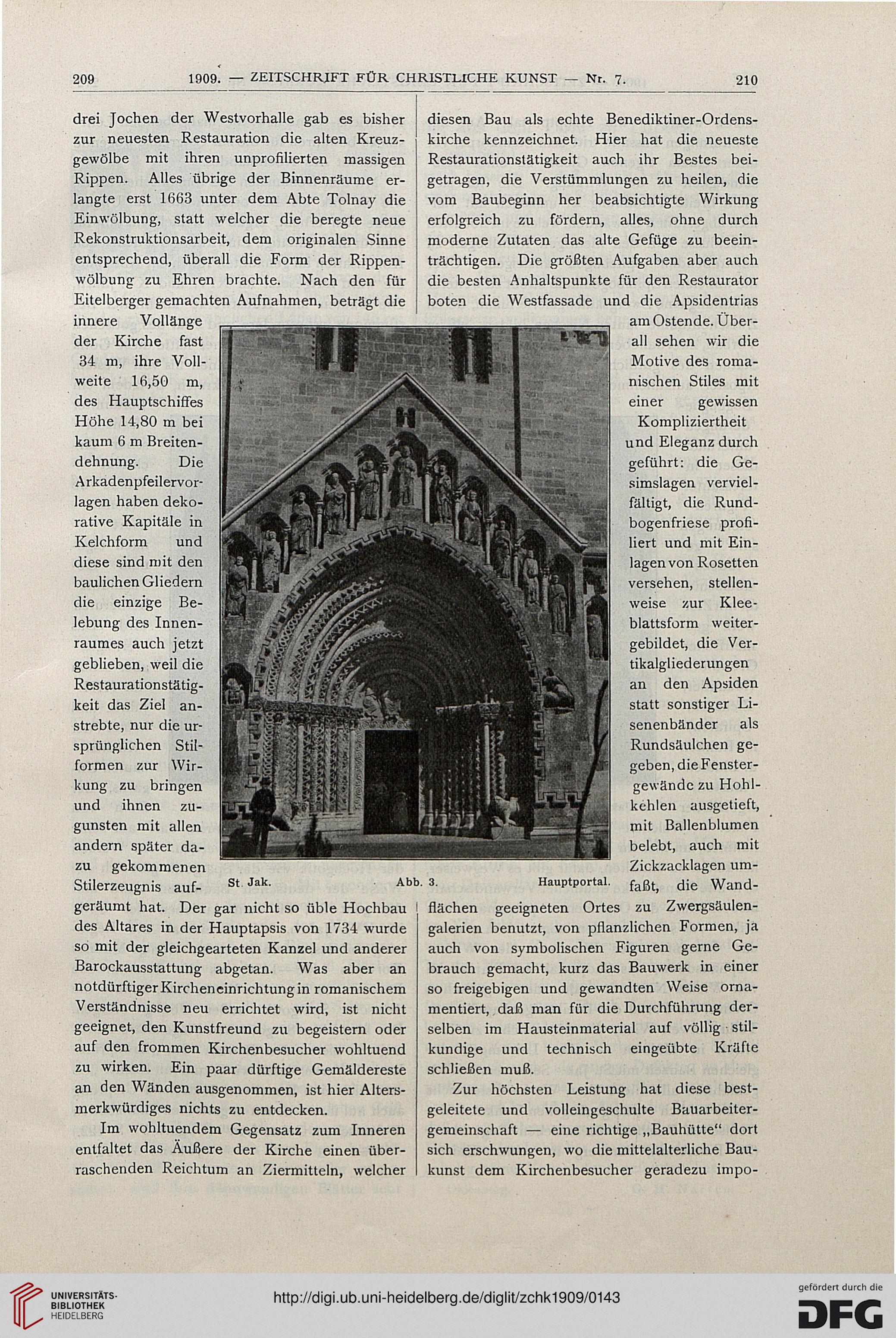209
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 7.
210
drei Jochen der Westvorhalle gab es bisher
zur neuesten Restauration die alten Kreuz-
gewölbe mit ihren unprofilierten massigen
Rippen. Alles übrige der Binnenräume er-
langte erst 1663 unter dem Abte Tolnay die
Einwölbung, statt welcher die beregte neue
Rekonstruktionsarbeit, dem originalen Sinne
entsprechend, überall die Form der Rippen-
wölbung zu Ehren brachte. Nach den für
Eitelberger gemachten Aufnahmen, beträgt die
innere Vollänge
der Kirche fast
34 m, ihre Voll-
weite 16,50 m,
des Hauptschiffes
Höhe 14,80 m bei
kaum 6 m Breiten-
dehnung. Die
Arkadenpfeilervor-
lagen haben deko-
rative Kapitale in
Kelchform und
diese sind mit den
baulichen Gliedern
die einzige Be-
lebung des Innen-
raumes auch jetzt
geblieben, weil die
Restaurationstätig-
keit das Ziel an-
strebte, nur die ur-
sprünglichen Stil-
formen zur Wir-
kung zu bringen
und ihnen zu-
gunsten mit allen
andern später da-
zu gekommenen
Stilerzeugnis auf-
St Jak.
diesen Bau als echte Benediktiner-Ordens-
kirche kennzeichnet. Hier hat die neueste
Restaurationstätigkeit auch ihr Bestes bei-
getragen, die Verstümmlungen zu heilen, die
vom Baubeginn her beabsichtigte Wirkung
erfolgreich zu fördern, alles, ohne durch
moderne Zutaten das alte Gefüge zu beein-
trächtigen. Die größten Aufgaben aber auch
die besten Anhaltspunkte für den Restaurator
boten die Westfassade und die Apsidentrias
am Ostende. Über-
all sehen wir die
Motive des roma-
nischen Stiles mit
einer gewissen
Kompliziertheit
und Eleganz durch
geführt: die Ge-
simslagen verviel-
fältigt, die Rund-
bogenfriese profi-
liert und mit Ein-
lagen von Rosetten
versehen, stellen-
weise zur Klee-
blattsform weiter-
gebildet, die Ver-
tikalgliederungen
an den Apsiden
statt sonstiger Li-
senenbänder als
Rundsäulchen ge-
geben, die Fenster-
gewände zu Hohl-
kehlen ausgetieft,
mit Ballenblumen
belebt, auch mit
Zickzacklagen um-
faßt, die Wand-
geräumt hat. Der gar nicht so üble Hochbau
des Altares in der Hauptapsis von 1734 wurde
so mit der gleichgearteten Kanzel und anderer
Barockausstattung abgetan. Was aber an
notdürftiger Kirchen einrichtung in romanischem
Verständnisse neu errichtet wird, ist nicht
geeignet, den Kunstfreund zu begeistern oder
auf den frommen Kirchenbesucher wohltuend
zu wirken. Ein paar dürftige Gemäldereste
an den Wänden ausgenommen, ist hier Alters-
merkwürdiges nichts zu entdecken.
Im wohltuendem Gegensatz zum Inneren
entfaltet das Äußere der Kirche einen über-
raschenden Reichtum an Ziermitteln, welcher
Abb. 3. Hauptportal
flächen geeigneten Ortes zu Zwergsäulen-
galerien benutzt, von pflanzlichen Formen, ja
auch von symbolischen Figuren gerne Ge-
brauch gemacht, kurz das Bauwerk in einer
so freigebigen und gewandten Weise orna-
mentiert, daß man für die Durchführung der-
selben im Hausteinmaterial auf völlig stil-
kundige und technisch eingeübte Kräfte
schließen muß.
Zur höchsten Leistung hat diese best-
geleitete und volleingeschulte Bauarbeiter-
gemeinschaft — eine richtige „Bauhütte" dort
sich erschwungen, wo die mittelalterliche Bau-
kunst dem Kirchenbesucher geradezu impo-
1909. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nt. 7.
210
drei Jochen der Westvorhalle gab es bisher
zur neuesten Restauration die alten Kreuz-
gewölbe mit ihren unprofilierten massigen
Rippen. Alles übrige der Binnenräume er-
langte erst 1663 unter dem Abte Tolnay die
Einwölbung, statt welcher die beregte neue
Rekonstruktionsarbeit, dem originalen Sinne
entsprechend, überall die Form der Rippen-
wölbung zu Ehren brachte. Nach den für
Eitelberger gemachten Aufnahmen, beträgt die
innere Vollänge
der Kirche fast
34 m, ihre Voll-
weite 16,50 m,
des Hauptschiffes
Höhe 14,80 m bei
kaum 6 m Breiten-
dehnung. Die
Arkadenpfeilervor-
lagen haben deko-
rative Kapitale in
Kelchform und
diese sind mit den
baulichen Gliedern
die einzige Be-
lebung des Innen-
raumes auch jetzt
geblieben, weil die
Restaurationstätig-
keit das Ziel an-
strebte, nur die ur-
sprünglichen Stil-
formen zur Wir-
kung zu bringen
und ihnen zu-
gunsten mit allen
andern später da-
zu gekommenen
Stilerzeugnis auf-
St Jak.
diesen Bau als echte Benediktiner-Ordens-
kirche kennzeichnet. Hier hat die neueste
Restaurationstätigkeit auch ihr Bestes bei-
getragen, die Verstümmlungen zu heilen, die
vom Baubeginn her beabsichtigte Wirkung
erfolgreich zu fördern, alles, ohne durch
moderne Zutaten das alte Gefüge zu beein-
trächtigen. Die größten Aufgaben aber auch
die besten Anhaltspunkte für den Restaurator
boten die Westfassade und die Apsidentrias
am Ostende. Über-
all sehen wir die
Motive des roma-
nischen Stiles mit
einer gewissen
Kompliziertheit
und Eleganz durch
geführt: die Ge-
simslagen verviel-
fältigt, die Rund-
bogenfriese profi-
liert und mit Ein-
lagen von Rosetten
versehen, stellen-
weise zur Klee-
blattsform weiter-
gebildet, die Ver-
tikalgliederungen
an den Apsiden
statt sonstiger Li-
senenbänder als
Rundsäulchen ge-
geben, die Fenster-
gewände zu Hohl-
kehlen ausgetieft,
mit Ballenblumen
belebt, auch mit
Zickzacklagen um-
faßt, die Wand-
geräumt hat. Der gar nicht so üble Hochbau
des Altares in der Hauptapsis von 1734 wurde
so mit der gleichgearteten Kanzel und anderer
Barockausstattung abgetan. Was aber an
notdürftiger Kirchen einrichtung in romanischem
Verständnisse neu errichtet wird, ist nicht
geeignet, den Kunstfreund zu begeistern oder
auf den frommen Kirchenbesucher wohltuend
zu wirken. Ein paar dürftige Gemäldereste
an den Wänden ausgenommen, ist hier Alters-
merkwürdiges nichts zu entdecken.
Im wohltuendem Gegensatz zum Inneren
entfaltet das Äußere der Kirche einen über-
raschenden Reichtum an Ziermitteln, welcher
Abb. 3. Hauptportal
flächen geeigneten Ortes zu Zwergsäulen-
galerien benutzt, von pflanzlichen Formen, ja
auch von symbolischen Figuren gerne Ge-
brauch gemacht, kurz das Bauwerk in einer
so freigebigen und gewandten Weise orna-
mentiert, daß man für die Durchführung der-
selben im Hausteinmaterial auf völlig stil-
kundige und technisch eingeübte Kräfte
schließen muß.
Zur höchsten Leistung hat diese best-
geleitete und volleingeschulte Bauarbeiter-
gemeinschaft — eine richtige „Bauhütte" dort
sich erschwungen, wo die mittelalterliche Bau-
kunst dem Kirchenbesucher geradezu impo-