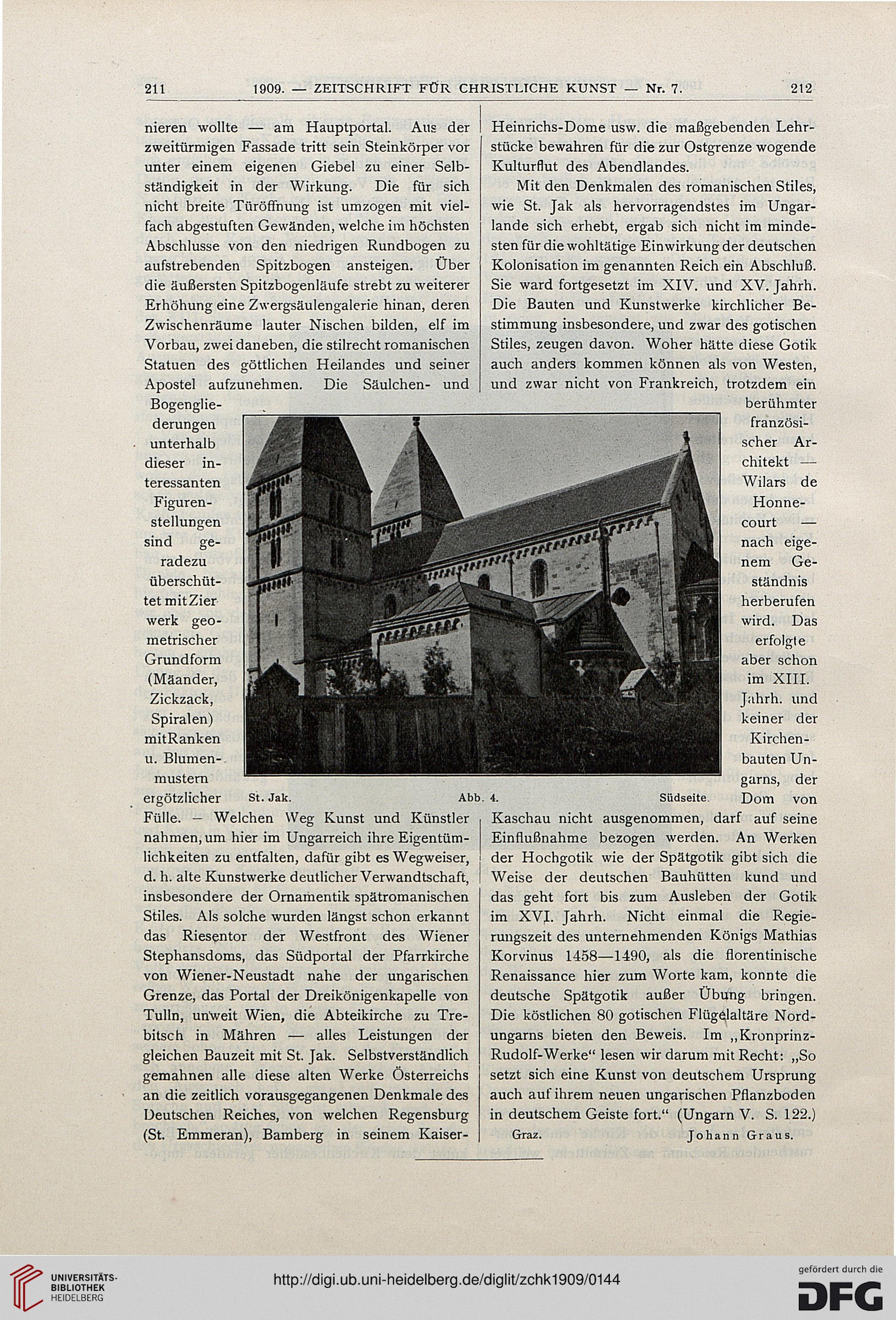211
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
212
nieren wollte — am Hauptportal. Aus der
zweitürmigen Fassade tritt sein Steinkörper vor
unter einem eigenen Giebel zu einer Selb-
ständigkeit in der Wirkung. Die für sich
nicht breite Türöffnung ist umzogen mit viel-
fach abgestuften Gewänden, welche im höchsten
Abschlüsse von den niedrigen Rundbogen zu
aufstrebenden Spitzbogen ansteigen. Über
die äußersten Spitzbogenläufe strebt zu weiterer
Erhöhung eine Zwergsäulengalerie hinan, deren
Zwischenräume lauter Nischen bilden, elf im
Vorbau, zwei daneben, die stilrecht romanischen
Statuen des göttlichen Heilandes und seiner
Apostel aufzunehmen. Die Säulchen- und
Bogenglie-
derungen
unterhalb
dieser in-
teressanten
Figuren-
stellungen
sind ge-
radezu
überschüt-
tet mitZier
werk geo-
metrischer
Grundform
(Mäander,
Zickzack,
Spiralen)
mitRanken
u. Blumen-
mustern
ergötzlicher st. Jak. Abb
Fülle. — Welchen Weg Kunst und Künstler
nahmen, um hier im Ungarreich ihre Eigentüm-
lichkeiten zu entfalten, dafür gibt es Wegweiser,
d. h. alte Kunstwerke deutlicher Verwandtschaft,
insbesondere der Ornamentik spätromanischen
Stiles. Als solche wurden längst schon erkannt
das Riesentor der Westfront des Wiener
Stephansdoms, das Südportal der Pfarrkirche
von Wiener-Neustadt nahe der ungarischen
Grenze, das Portal der Dreikönigenkapelle von
Tulln, unweit Wien, die Abteikirche zu Tre-
bitsch in Mähren — alles Leistungen der
gleichen Bauzeit mit St. Jak. Selbstverständlich
gemahnen alle diese alten Werke Österreichs
an die zeitlich vorausgegangenen Denkmale des
Deutschen Reiches, von welchen Regensburg
(St. Emmeran), Bamberg in seinem Kaiser-
Heinrichs-Dome usw. die maßgebenden Lehr-
stücke bewahren für die zur Ostgrenze wogende
Kulturflut des Abendlandes.
Mit den Denkmalen des romanischen Stiles,
wie St. Jak als hervorragendstes im Ungar-
lande sich erhebt, ergab sich nicht im minde-
sten für die wohltätige Einwirkung der deutschen
Kolonisation im genannten Reich ein Abschluß.
Sie ward fortgesetzt im XIV. und XV. Jahrh.
Die Bauten und Kunstwerke kirchlicher Be-
stimmung insbesondere, und zwar des gotischen
Stiles, zeugen davon. Woher hätte diese Gotik
auch anders kommen können als von Westen,
und zwar nicht von Frankreich, trotzdem ein
berühmter
französi-
scher Ar-
chitekt —
Wilars de
Honne-
court —
nach eige-
nem Ge-
ständnis
herberufen
wird. Das
erfolgte
aber schon
im XIII.
Jahrh. und
keiner der
Kirchen-
bauten Un-
garns, der
4. Südseite Dom von
Kaschau nicht ausgenommen, darf auf seine
Einflußnahme bezogen werden. An Werken
der Hochgotik wie der Spätgotik gibt sich die
Weise der deutschen Bauhütten kund und
das geht fort bis zum Ausleben der Gotik
im XVI. Jahrh. Nicht einmal die Regie-
rungszeit des unternehmenden Königs Mathias
Korvinus 1458—1490, als die florentinische
Renaissance hier zum Worte kam, konnte die
deutsche Spätgotik außer Übung bringen.
Die köstlichen 80 gotischen Flügelaltäre Nord-
ungarns bieten den Beweis. Im „Kronprinz-
Rudolf-Werke" lesen wir darum mit Recht: „So
setzt sich eine Kunst von deutschem Ursprung
auch auf ihrem neuen ungarischen Pflanzboden
in deutschem Geiste fort." (Ungarn V. S. 122.)
Graz. Johann Graus.
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
212
nieren wollte — am Hauptportal. Aus der
zweitürmigen Fassade tritt sein Steinkörper vor
unter einem eigenen Giebel zu einer Selb-
ständigkeit in der Wirkung. Die für sich
nicht breite Türöffnung ist umzogen mit viel-
fach abgestuften Gewänden, welche im höchsten
Abschlüsse von den niedrigen Rundbogen zu
aufstrebenden Spitzbogen ansteigen. Über
die äußersten Spitzbogenläufe strebt zu weiterer
Erhöhung eine Zwergsäulengalerie hinan, deren
Zwischenräume lauter Nischen bilden, elf im
Vorbau, zwei daneben, die stilrecht romanischen
Statuen des göttlichen Heilandes und seiner
Apostel aufzunehmen. Die Säulchen- und
Bogenglie-
derungen
unterhalb
dieser in-
teressanten
Figuren-
stellungen
sind ge-
radezu
überschüt-
tet mitZier
werk geo-
metrischer
Grundform
(Mäander,
Zickzack,
Spiralen)
mitRanken
u. Blumen-
mustern
ergötzlicher st. Jak. Abb
Fülle. — Welchen Weg Kunst und Künstler
nahmen, um hier im Ungarreich ihre Eigentüm-
lichkeiten zu entfalten, dafür gibt es Wegweiser,
d. h. alte Kunstwerke deutlicher Verwandtschaft,
insbesondere der Ornamentik spätromanischen
Stiles. Als solche wurden längst schon erkannt
das Riesentor der Westfront des Wiener
Stephansdoms, das Südportal der Pfarrkirche
von Wiener-Neustadt nahe der ungarischen
Grenze, das Portal der Dreikönigenkapelle von
Tulln, unweit Wien, die Abteikirche zu Tre-
bitsch in Mähren — alles Leistungen der
gleichen Bauzeit mit St. Jak. Selbstverständlich
gemahnen alle diese alten Werke Österreichs
an die zeitlich vorausgegangenen Denkmale des
Deutschen Reiches, von welchen Regensburg
(St. Emmeran), Bamberg in seinem Kaiser-
Heinrichs-Dome usw. die maßgebenden Lehr-
stücke bewahren für die zur Ostgrenze wogende
Kulturflut des Abendlandes.
Mit den Denkmalen des romanischen Stiles,
wie St. Jak als hervorragendstes im Ungar-
lande sich erhebt, ergab sich nicht im minde-
sten für die wohltätige Einwirkung der deutschen
Kolonisation im genannten Reich ein Abschluß.
Sie ward fortgesetzt im XIV. und XV. Jahrh.
Die Bauten und Kunstwerke kirchlicher Be-
stimmung insbesondere, und zwar des gotischen
Stiles, zeugen davon. Woher hätte diese Gotik
auch anders kommen können als von Westen,
und zwar nicht von Frankreich, trotzdem ein
berühmter
französi-
scher Ar-
chitekt —
Wilars de
Honne-
court —
nach eige-
nem Ge-
ständnis
herberufen
wird. Das
erfolgte
aber schon
im XIII.
Jahrh. und
keiner der
Kirchen-
bauten Un-
garns, der
4. Südseite Dom von
Kaschau nicht ausgenommen, darf auf seine
Einflußnahme bezogen werden. An Werken
der Hochgotik wie der Spätgotik gibt sich die
Weise der deutschen Bauhütten kund und
das geht fort bis zum Ausleben der Gotik
im XVI. Jahrh. Nicht einmal die Regie-
rungszeit des unternehmenden Königs Mathias
Korvinus 1458—1490, als die florentinische
Renaissance hier zum Worte kam, konnte die
deutsche Spätgotik außer Übung bringen.
Die köstlichen 80 gotischen Flügelaltäre Nord-
ungarns bieten den Beweis. Im „Kronprinz-
Rudolf-Werke" lesen wir darum mit Recht: „So
setzt sich eine Kunst von deutschem Ursprung
auch auf ihrem neuen ungarischen Pflanzboden
in deutschem Geiste fort." (Ungarn V. S. 122.)
Graz. Johann Graus.