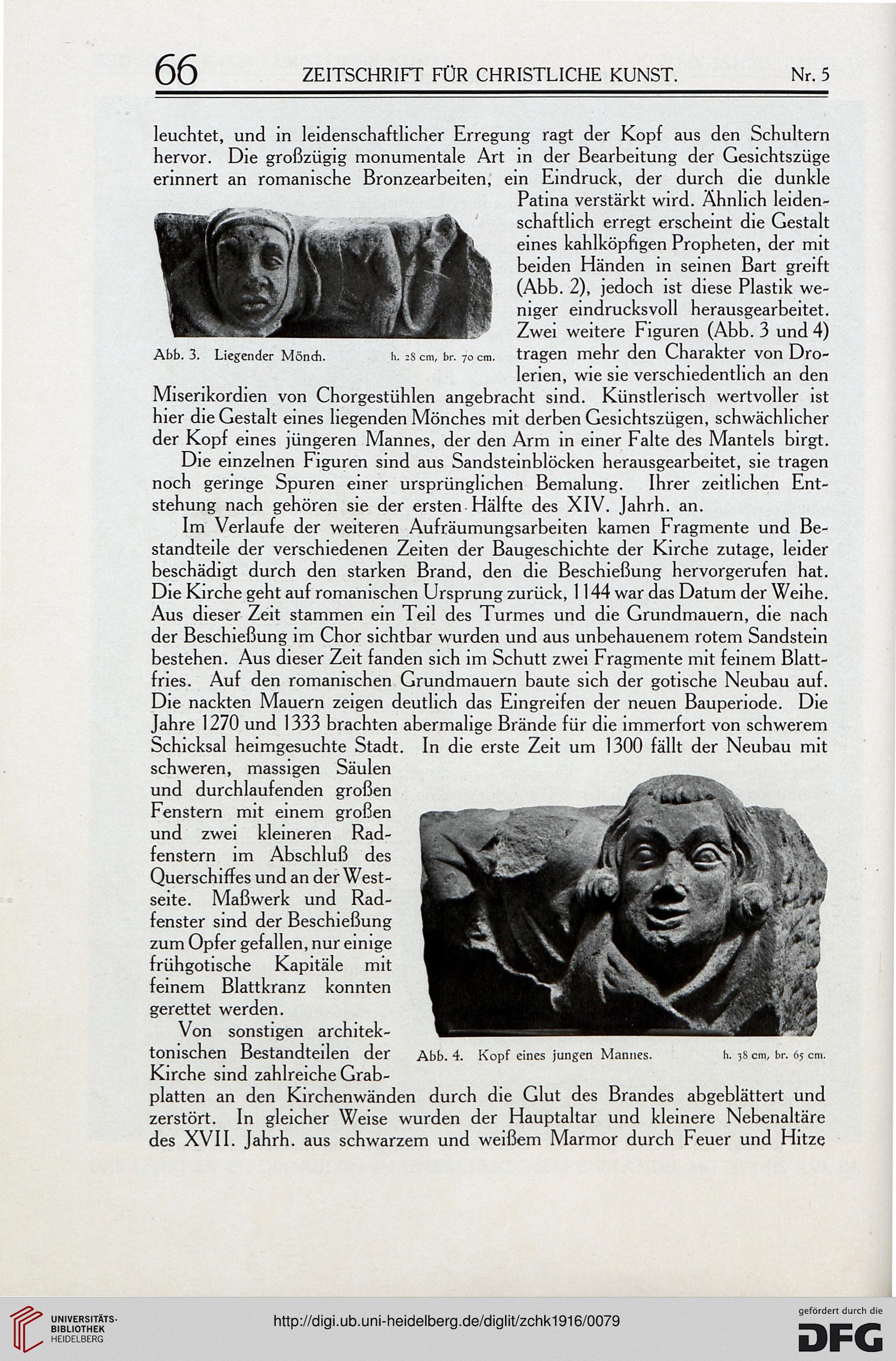66
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 5
Abb. 3. Liegender Mönch.
h. 28 cm, br. 70 cm.
leuchtet, und in leidenschaftlicher Erregung ragt der Kopf aus den Schultern
hervor. Die großzügig monumentale Art in der Bearbeitung der Gesichtszüge
erinnert an romanische Bronzearbeiten, ein Eindruck, der durch die dunkle
Patina verstärkt wird. Ähnlich leiden-
schaftlich erregt erscheint die Gestalt
eines kahlköpfigen Propheten, der mit
beiden Händen in seinen Bart greift
(Abb. 2), jedoch ist diese Plastik we-
niger eindrucksvoll herausgearbeitet.
Zwei weitere Figuren (Abb. 3 und 4)
tragen mehr den Charakter von Dro-
lerien, wie sie verschiedentlich an den
Misenkordien von Chorgestühlen angebracht sind. Künstlerisch wertvoller ist
hier die Gestalt eines liegenden Mönches mit derben Gesichtszügen, schwächlicher
der Kopf eines jüngeren Mannes, der den Arm in einer Falte des Mantels birgt.
Die einzelnen Figuren sind aus Sandsteinblöcken herausgearbeitet, sie tragen
noch geringe Spuren einer ursprünglichen Bemalung. Ihrer zeitlichen Ent-
stehung nach gehören sie der ersten Hälfte des XIV. Jahrh. an.
Im Verlaufe der weiteren Aufräumungsarbeiten kamen Fragmente und Be-
standteile der verschiedenen Zeiten der Baugeschichte der Kirche zutage, leider
beschädigt durch den starken Brand, den die Beschießung hervorgerufen hat.
Die Kirche geht auf romanischen Ursprung zurück, 1144 war das Datum der Weihe.
Aus dieser Zeit stammen ein Teil des Turmes und die Grundmauern, die nach
der Beschießung im Chor sichtbar wurden und aus unbehauenem rotem Sandstein
bestehen. Aus dieser Zeit fanden sich im Schutt zwei Fragmente mit feinem Blatt-
fries. Auf den romanischen Grundmauern baute sich der gotische Neubau auf.
Die nackten Mauern zeigen deutlich das Eingreifen der neuen Bauperiode. Die
Jahre 1270 und 1333 brachten abermalige Brände für die immerfort von schwerem
Schicksal heimgesuchte Stadt. In die erste Zeit um 1300 fällt der Neubau mit
schweren, massigen Säulen
und durchlaufenden großen
Fenstern mit einem großen
und zwei kleineren Rad-
fenstern im Abschluß des
Querschiffes und an der West-
seite. Maßwerk und Rad-
fenster sind der Beschießung
zum Opfer gefallen, nur einige
frühgotische Kapitale mit
feinem Blattkranz konnten
gerettet werden.
Von sonstigen architek-
tonischen Bestandteilen der
Kirche sind zahlreiche Grab-
platten an den Kirchenwänden durch die Glut des Brandes abgeblättert und
zerstört. In gleicher Weise wurden der Hauptaltar und kleinere Nebenaltäre
des XVII. Jahrh. aus schwarzem und weißem Marmor durch Feuer und Hitze
Abb. 4. Kopf eines jungen Mannes.
h. 38 cm, br. 65 cm.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
Nr. 5
Abb. 3. Liegender Mönch.
h. 28 cm, br. 70 cm.
leuchtet, und in leidenschaftlicher Erregung ragt der Kopf aus den Schultern
hervor. Die großzügig monumentale Art in der Bearbeitung der Gesichtszüge
erinnert an romanische Bronzearbeiten, ein Eindruck, der durch die dunkle
Patina verstärkt wird. Ähnlich leiden-
schaftlich erregt erscheint die Gestalt
eines kahlköpfigen Propheten, der mit
beiden Händen in seinen Bart greift
(Abb. 2), jedoch ist diese Plastik we-
niger eindrucksvoll herausgearbeitet.
Zwei weitere Figuren (Abb. 3 und 4)
tragen mehr den Charakter von Dro-
lerien, wie sie verschiedentlich an den
Misenkordien von Chorgestühlen angebracht sind. Künstlerisch wertvoller ist
hier die Gestalt eines liegenden Mönches mit derben Gesichtszügen, schwächlicher
der Kopf eines jüngeren Mannes, der den Arm in einer Falte des Mantels birgt.
Die einzelnen Figuren sind aus Sandsteinblöcken herausgearbeitet, sie tragen
noch geringe Spuren einer ursprünglichen Bemalung. Ihrer zeitlichen Ent-
stehung nach gehören sie der ersten Hälfte des XIV. Jahrh. an.
Im Verlaufe der weiteren Aufräumungsarbeiten kamen Fragmente und Be-
standteile der verschiedenen Zeiten der Baugeschichte der Kirche zutage, leider
beschädigt durch den starken Brand, den die Beschießung hervorgerufen hat.
Die Kirche geht auf romanischen Ursprung zurück, 1144 war das Datum der Weihe.
Aus dieser Zeit stammen ein Teil des Turmes und die Grundmauern, die nach
der Beschießung im Chor sichtbar wurden und aus unbehauenem rotem Sandstein
bestehen. Aus dieser Zeit fanden sich im Schutt zwei Fragmente mit feinem Blatt-
fries. Auf den romanischen Grundmauern baute sich der gotische Neubau auf.
Die nackten Mauern zeigen deutlich das Eingreifen der neuen Bauperiode. Die
Jahre 1270 und 1333 brachten abermalige Brände für die immerfort von schwerem
Schicksal heimgesuchte Stadt. In die erste Zeit um 1300 fällt der Neubau mit
schweren, massigen Säulen
und durchlaufenden großen
Fenstern mit einem großen
und zwei kleineren Rad-
fenstern im Abschluß des
Querschiffes und an der West-
seite. Maßwerk und Rad-
fenster sind der Beschießung
zum Opfer gefallen, nur einige
frühgotische Kapitale mit
feinem Blattkranz konnten
gerettet werden.
Von sonstigen architek-
tonischen Bestandteilen der
Kirche sind zahlreiche Grab-
platten an den Kirchenwänden durch die Glut des Brandes abgeblättert und
zerstört. In gleicher Weise wurden der Hauptaltar und kleinere Nebenaltäre
des XVII. Jahrh. aus schwarzem und weißem Marmor durch Feuer und Hitze
Abb. 4. Kopf eines jungen Mannes.
h. 38 cm, br. 65 cm.