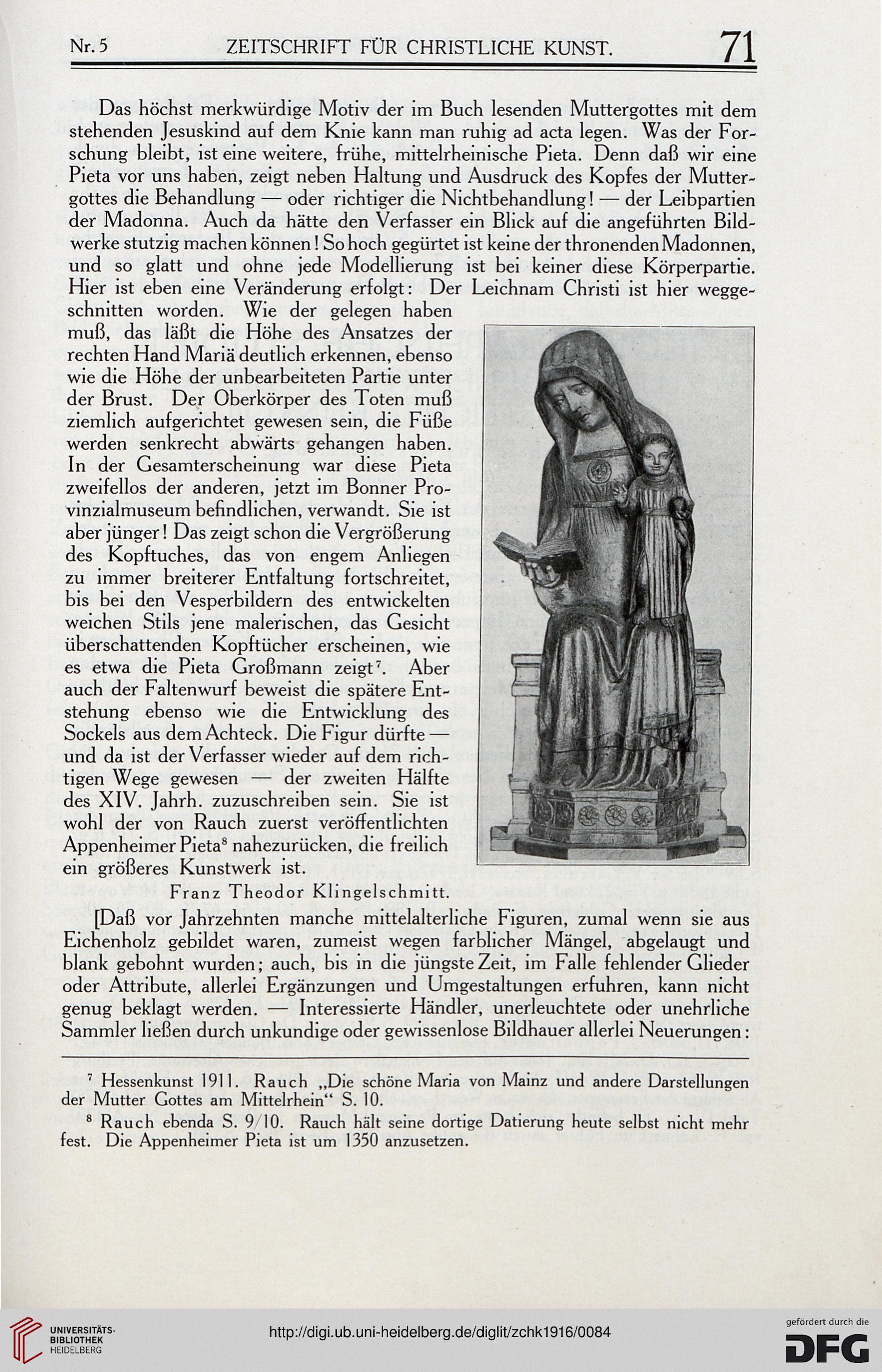Nr. 5
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
71
Das höchst merkwürdige Motiv der im Buch lesenden Muttergottes mit dem
stehenden Jesuskind auf dem Knie kann man ruhig ad acta legen. Was der For-
schung bleibt, ist eine weitere, frühe, mittelrheinische Pieta. Denn daß wir eine
Pieta vor uns haben, zeigt neben Haltung und Ausdruck des Kopfes der Mutter-
gottes die Behandlung — oder richtiger die Nichtbehandlung! — der Leibpartien
der Madonna. Auch da hätte den Verfasser ein Blick auf die angeführten Bild-
werke stutzig machen können! So hoch gegürtet ist keine der thronenden Madonnen,
und so glatt und ohne jede Modellierung ist bei keiner diese Körperpartie.
Hier ist eben eine Veränderung erfolgt: Der Leichnam Christi ist hier wegge-
schnitten worden. Wie der gelegen haben
muß, das läßt die Höhe des Ansatzes der
rechten Hand Maria deutlich erkennen, ebenso
wie die Höhe der unbearbeiteten Partie unter
der Brust. Der Oberkörper des Toten muß
ziemlich aufgerichtet gewesen sein, die Füße
werden senkrecht abwärts gehangen haben.
In der Gesamterschemung war diese Pieta
zweifellos der anderen, jetzt im Bonner Pro-
vinzialmuseum befindlichen, verwandt. Sie ist
aber jünger! Das zeigt schon die Vergrößerung
des Kopftuches, das von engem Anliegen
zu immer breiterer Entfaltung fortschreitet,
bis bei den Vesperbildern des entwickelten
weichen Stils jene malerischen, das Gesicht
überschattenden Kopftücher erscheinen, wie
es etwa die Pieta Großmann zeigt7. Aber
auch der Faltenwurf beweist die spätere Ent-
stehung ebenso wie die Entwicklung des
Sockels aus dem Achteck. Die Figur dürfte —
und da ist der Verfasser wieder auf dem rich-
tigen Wege gewesen — der zweiten Hälfte
des XIV. Jahrh. zuzuschreiben sein. Sie ist
wohl der von Rauch zuerst veröffentlichten
Appenheimer Pieta8 nahezurücken, die freilich
ein größeres Kunstwerk ist.
Franz Theodor Klingelschmitt.
[Daß vor Jahrzehnten manche mittelalterliche Figuren, zumal wenn sie aus
Eichenholz gebildet waren, zumeist wegen farblicher Mängel, abgelaugt und
blank gebohnt wurden; auch, bis in die jüngste Zeit, im Falle fehlender Glieder
oder Attribute, allerlei Ergänzungen und Umgestaltungen erfuhren, kann nicht
genug beklagt werden. — Interessierte Händler, unerleuchtete oder unehrliche
Sammler ließen durch unkundige oder gewissenlose Bildhauer allerlei Neuerungen:
7 Hessenkunst 1911. Rauch „Die schöne Maria von Mainz und andere Darstellungen
der Mutter Gottes am Mittelrhein" S. 10.
8 Rauch ebenda S. 9 10. Rauch hält seine dortige Datierung heute selbst nicht mehr
fest. Die Appenheimer Pieta ist um 1350 anzusetzen.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.
71
Das höchst merkwürdige Motiv der im Buch lesenden Muttergottes mit dem
stehenden Jesuskind auf dem Knie kann man ruhig ad acta legen. Was der For-
schung bleibt, ist eine weitere, frühe, mittelrheinische Pieta. Denn daß wir eine
Pieta vor uns haben, zeigt neben Haltung und Ausdruck des Kopfes der Mutter-
gottes die Behandlung — oder richtiger die Nichtbehandlung! — der Leibpartien
der Madonna. Auch da hätte den Verfasser ein Blick auf die angeführten Bild-
werke stutzig machen können! So hoch gegürtet ist keine der thronenden Madonnen,
und so glatt und ohne jede Modellierung ist bei keiner diese Körperpartie.
Hier ist eben eine Veränderung erfolgt: Der Leichnam Christi ist hier wegge-
schnitten worden. Wie der gelegen haben
muß, das läßt die Höhe des Ansatzes der
rechten Hand Maria deutlich erkennen, ebenso
wie die Höhe der unbearbeiteten Partie unter
der Brust. Der Oberkörper des Toten muß
ziemlich aufgerichtet gewesen sein, die Füße
werden senkrecht abwärts gehangen haben.
In der Gesamterschemung war diese Pieta
zweifellos der anderen, jetzt im Bonner Pro-
vinzialmuseum befindlichen, verwandt. Sie ist
aber jünger! Das zeigt schon die Vergrößerung
des Kopftuches, das von engem Anliegen
zu immer breiterer Entfaltung fortschreitet,
bis bei den Vesperbildern des entwickelten
weichen Stils jene malerischen, das Gesicht
überschattenden Kopftücher erscheinen, wie
es etwa die Pieta Großmann zeigt7. Aber
auch der Faltenwurf beweist die spätere Ent-
stehung ebenso wie die Entwicklung des
Sockels aus dem Achteck. Die Figur dürfte —
und da ist der Verfasser wieder auf dem rich-
tigen Wege gewesen — der zweiten Hälfte
des XIV. Jahrh. zuzuschreiben sein. Sie ist
wohl der von Rauch zuerst veröffentlichten
Appenheimer Pieta8 nahezurücken, die freilich
ein größeres Kunstwerk ist.
Franz Theodor Klingelschmitt.
[Daß vor Jahrzehnten manche mittelalterliche Figuren, zumal wenn sie aus
Eichenholz gebildet waren, zumeist wegen farblicher Mängel, abgelaugt und
blank gebohnt wurden; auch, bis in die jüngste Zeit, im Falle fehlender Glieder
oder Attribute, allerlei Ergänzungen und Umgestaltungen erfuhren, kann nicht
genug beklagt werden. — Interessierte Händler, unerleuchtete oder unehrliche
Sammler ließen durch unkundige oder gewissenlose Bildhauer allerlei Neuerungen:
7 Hessenkunst 1911. Rauch „Die schöne Maria von Mainz und andere Darstellungen
der Mutter Gottes am Mittelrhein" S. 10.
8 Rauch ebenda S. 9 10. Rauch hält seine dortige Datierung heute selbst nicht mehr
fest. Die Appenheimer Pieta ist um 1350 anzusetzen.