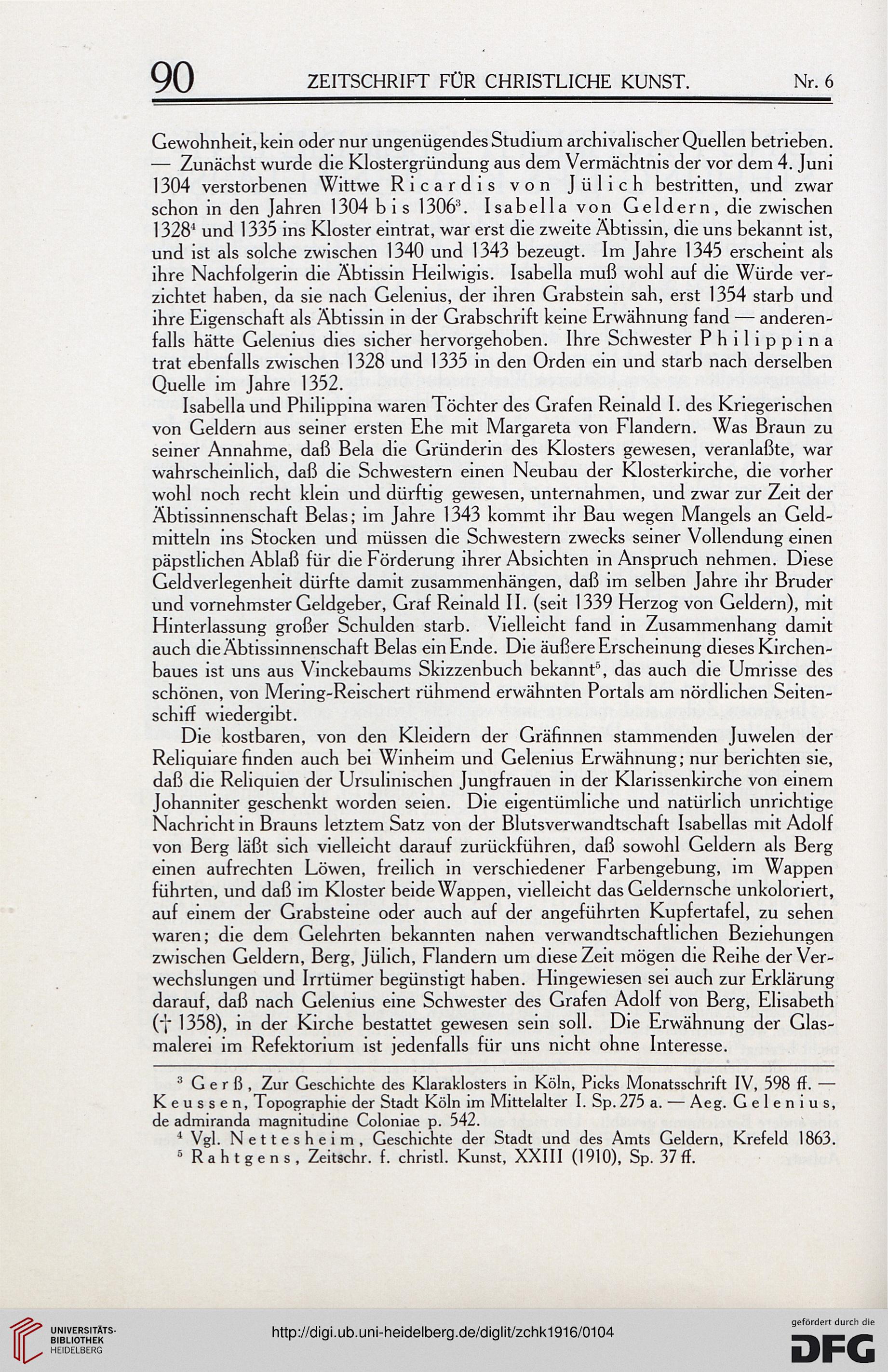90
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 6
Gewohnheit, kein oder nur ungenügendes Studium archivahscher Quellen betrieben.
— Zunächst wurde die Klostergründung aus dem Vermächtnis der vor dem 4. Juni
1304 verstorbenen Wittwe Ricardis von Jülich bestritten, und zwar
schon in den Jahren 1304 bis 13063. Isabella von Geldern, die zwischen
13284 und 1335 ins Kloster eintrat, war erst die zweite Äbtissin, die uns bekannt ist,
und ist als solche zwischen 1340 und 1343 bezeugt. Im Jahre 1345 erscheint als
ihre Nachfolgerin die Äbtissin Heilwigis. Isabella muß wohl auf die Würde ver-
zichtet haben, da sie nach Gelenius, der ihren Grabstein sah, erst 1354 starb und
ihre Eigenschaft als Äbtissin in der Grabschrift keine Erwähnung fand — anderen-
falls hätte Gelenius dies sicher hervorgehoben. Ihre Schwester P h i 1 i p p i n a
trat ebenfalls zwischen 1328 und 1335 in den Orden ein und starb nach derselben
Quelle im Jahre 1352.
Isabella und Philippina waren Töchter des Grafen Reinald I. des Kriegerischen
von Geldern aus seiner ersten Ehe mit Margareta von Flandern. Was Braun zu
seiner Annahme, daß Bela die Gründerin des Klosters gewesen, veranlaßte, war
wahrscheinlich, daß die Schwestern einen Neubau der Klosterkirche, die vorher
wohl noch recht klein und dürftig gewesen, unternahmen, und zwar zur Zeit der
Äbtissinnenschaft Belas; im Jahre 1343 kommt ihr Bau wegen Mangels an Geld-
mitteln ins Stocken und müssen die Schwestern zwecks seiner Vollendung einen
päpstlichen Ablaß für die Förderung ihrer Absichten in Anspruch nehmen. Diese
Geldverlegenheit dürfte damit zusammenhängen, daß im selben Jahre ihr Bruder
und vornehmster Geldgeber, Graf Reinald II. (seit 1339 Herzog von Geldern), mit
Hinterlassung großer Schulden starb. Vielleicht fand in Zusammenhang damit
auch die Äbtissinnenschaft Belas ein Ende. Die äußere Erscheinung dieses Kirchen-
baues ist uns aus Vinckebaums Skizzenbuch bekannt5, das auch die Umrisse des
schönen, von Mering-Reischert rühmend erwähnten Portals am nördlichen Seiten-
schiff wiedergibt.
Die kostbaren, von den Kleidern der Gräfinnen stammenden Juwelen der
Rehquiare finden auch bei Winheim und Gelenius Erwähnung; nur berichten sie,
daß die Reliquien der Ursulinischen Jungfrauen in der Klarissenkirche von einem
Johanniter geschenkt worden seien. Die eigentümliche und natürlich unrichtige
Nachricht in Brauns letztem Satz von der Blutsverwandtschaft Isabellas mit Adolf
von Berg läßt sich vielleicht darauf zurückführen, daß sowohl Geldern als Berg
einen aufrechten Löwen, freilich in verschiedener Farbengebung, im Wappen
führten, und daß im Kloster beide Wappen, vielleicht das Geldernsche unkoloriert,
auf einem der Grabsteine oder auch auf der angeführten Kupfertafel, zu sehen
waren; die dem Gelehrten bekannten nahen verwandtschaftlichen Beziehungen
zwischen Geldern, Berg, Jülich, Flandern um diese Zeit mögen die Reihe der Ver-
wechslungen und Irrtümer begünstigt haben. Hingewiesen sei auch zur Erklärung
darauf, daß nach Gelenius eine Schwester des Grafen Adolf von Berg, Elisabeth
("l" 1358), in der Kirche bestattet gewesen sein soll. Die Erwähnung der Glas-
malerei im Refektorium ist jedenfalls für uns nicht ohne Interesse.
3 G e r ß , Zur Geschichte des Klaraklosters in Köln, Picks Monatsschrift IV, 598 ff. —
K e u s s e n, Topographie der Stadt Köln im Mittelalter I. Sp. 275 a. — Aeg. Gelenius,
de admiranda magnitudine Coloniae p. 542.
4 Vgl. Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amts Geldern, Krefeld 1863.
5 Rahtgens, Zeitschr. f. christl. Kunst, XXIII (1910), Sp. 37 ff.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 6
Gewohnheit, kein oder nur ungenügendes Studium archivahscher Quellen betrieben.
— Zunächst wurde die Klostergründung aus dem Vermächtnis der vor dem 4. Juni
1304 verstorbenen Wittwe Ricardis von Jülich bestritten, und zwar
schon in den Jahren 1304 bis 13063. Isabella von Geldern, die zwischen
13284 und 1335 ins Kloster eintrat, war erst die zweite Äbtissin, die uns bekannt ist,
und ist als solche zwischen 1340 und 1343 bezeugt. Im Jahre 1345 erscheint als
ihre Nachfolgerin die Äbtissin Heilwigis. Isabella muß wohl auf die Würde ver-
zichtet haben, da sie nach Gelenius, der ihren Grabstein sah, erst 1354 starb und
ihre Eigenschaft als Äbtissin in der Grabschrift keine Erwähnung fand — anderen-
falls hätte Gelenius dies sicher hervorgehoben. Ihre Schwester P h i 1 i p p i n a
trat ebenfalls zwischen 1328 und 1335 in den Orden ein und starb nach derselben
Quelle im Jahre 1352.
Isabella und Philippina waren Töchter des Grafen Reinald I. des Kriegerischen
von Geldern aus seiner ersten Ehe mit Margareta von Flandern. Was Braun zu
seiner Annahme, daß Bela die Gründerin des Klosters gewesen, veranlaßte, war
wahrscheinlich, daß die Schwestern einen Neubau der Klosterkirche, die vorher
wohl noch recht klein und dürftig gewesen, unternahmen, und zwar zur Zeit der
Äbtissinnenschaft Belas; im Jahre 1343 kommt ihr Bau wegen Mangels an Geld-
mitteln ins Stocken und müssen die Schwestern zwecks seiner Vollendung einen
päpstlichen Ablaß für die Förderung ihrer Absichten in Anspruch nehmen. Diese
Geldverlegenheit dürfte damit zusammenhängen, daß im selben Jahre ihr Bruder
und vornehmster Geldgeber, Graf Reinald II. (seit 1339 Herzog von Geldern), mit
Hinterlassung großer Schulden starb. Vielleicht fand in Zusammenhang damit
auch die Äbtissinnenschaft Belas ein Ende. Die äußere Erscheinung dieses Kirchen-
baues ist uns aus Vinckebaums Skizzenbuch bekannt5, das auch die Umrisse des
schönen, von Mering-Reischert rühmend erwähnten Portals am nördlichen Seiten-
schiff wiedergibt.
Die kostbaren, von den Kleidern der Gräfinnen stammenden Juwelen der
Rehquiare finden auch bei Winheim und Gelenius Erwähnung; nur berichten sie,
daß die Reliquien der Ursulinischen Jungfrauen in der Klarissenkirche von einem
Johanniter geschenkt worden seien. Die eigentümliche und natürlich unrichtige
Nachricht in Brauns letztem Satz von der Blutsverwandtschaft Isabellas mit Adolf
von Berg läßt sich vielleicht darauf zurückführen, daß sowohl Geldern als Berg
einen aufrechten Löwen, freilich in verschiedener Farbengebung, im Wappen
führten, und daß im Kloster beide Wappen, vielleicht das Geldernsche unkoloriert,
auf einem der Grabsteine oder auch auf der angeführten Kupfertafel, zu sehen
waren; die dem Gelehrten bekannten nahen verwandtschaftlichen Beziehungen
zwischen Geldern, Berg, Jülich, Flandern um diese Zeit mögen die Reihe der Ver-
wechslungen und Irrtümer begünstigt haben. Hingewiesen sei auch zur Erklärung
darauf, daß nach Gelenius eine Schwester des Grafen Adolf von Berg, Elisabeth
("l" 1358), in der Kirche bestattet gewesen sein soll. Die Erwähnung der Glas-
malerei im Refektorium ist jedenfalls für uns nicht ohne Interesse.
3 G e r ß , Zur Geschichte des Klaraklosters in Köln, Picks Monatsschrift IV, 598 ff. —
K e u s s e n, Topographie der Stadt Köln im Mittelalter I. Sp. 275 a. — Aeg. Gelenius,
de admiranda magnitudine Coloniae p. 542.
4 Vgl. Nettesheim, Geschichte der Stadt und des Amts Geldern, Krefeld 1863.
5 Rahtgens, Zeitschr. f. christl. Kunst, XXIII (1910), Sp. 37 ff.