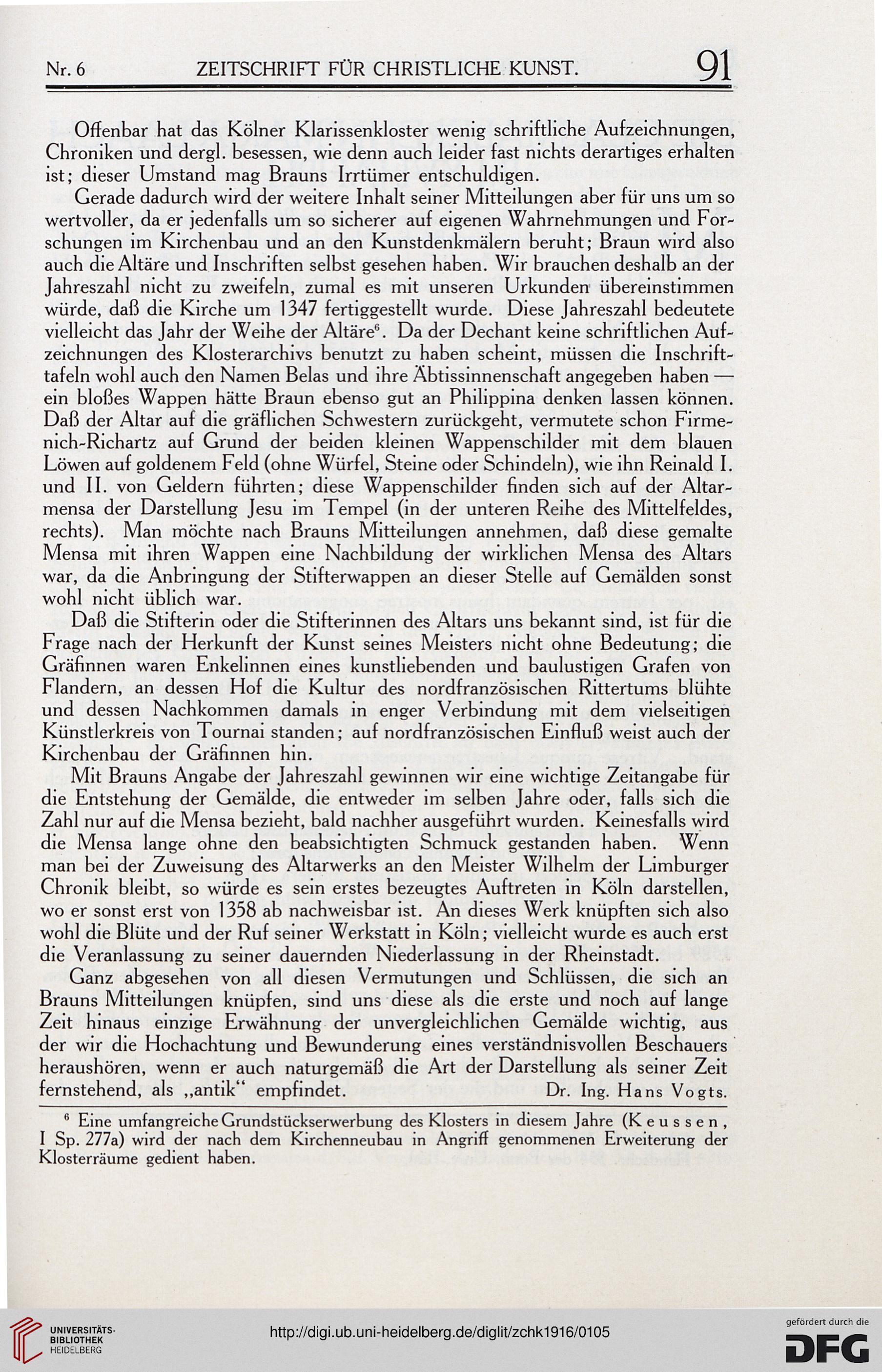Nr. 6 ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. 91
Offenbar hat das Kölner Klarissenkloster wenig schriftliche Aufzeichnungen,
Chroniken und dergl. besessen, wie denn auch leider fast nichts derartiges erhalten
ist; dieser Umstand mag Brauns Irrtümer entschuldigen.
Gerade dadurch wird der weitere Inhalt seiner Mitteilungen aber für uns um so
wertvoller, da er jedenfalls um so sicherer auf eigenen Wahrnehmungen und For-
schungen im Kirchenbau und an den Kunstdenkmälern beruht; Braun wird also
auch die Altäre und Inschriften selbst gesehen haben. Wir brauchen deshalb an der
Jahreszahl nicht zu zweifeln, zumal es mit unseren Urkunden übereinstimmen
würde, daß die Kirche um 1347 fertiggestellt wurde. Diese Jahreszahl bedeutete
vielleicht das Jahr der Weihe der Altäre6. Da der Dechant keine schriftlichen Auf-
zeichnungen des Klosterarchivs benutzt zu haben scheint, müssen die Inschrift-
tafeln wohl auch den Namen Belas und ihre Äbtissinnenschaft angegeben haben —
ein bloßes Wappen hätte Braun ebenso gut an Philippina denken lassen können.
Daß der Altar auf die gräflichen Schwestern zurückgeht, vermutete schon Firme-
nich-Richartz auf Grund der beiden kleinen Wappenschilder mit dem blauen
Löwen auf goldenem Feld (ohne Würfel, Steine oder Schindeln), wie ihn Reinald I.
und II. von Geldern führten; diese Wappenschilder finden sich auf der Altar-
mensa der Darstellung Jesu im Tempel (in der unteren Reihe des Mittelfeldes,
rechts). Man möchte nach Brauns Mitteilungen annehmen, daß diese gemalte
Mensa mit ihren Wappen eine Nachbildung der wirklichen Mensa des Altars
war, da die Anbringung der Stifterwappen an dieser Stelle auf Gemälden sonst
wohl nicht üblich war.
Daß die Stifterin oder die Stifterinnen des Altars uns bekannt sind, ist für die
Frage nach der Herkunft der Kunst seines Meisters nicht ohne Bedeutung; die
Gräfinnen waren Enkelinnen eines kunstliebenden und baulustigen Grafen von
Flandern, an dessen Hof die Kultur des nordfranzösischen Rittertums blühte
und dessen Nachkommen damals in enger Verbindung mit dem vielseitigen
Künstlerkreis von Tournai standen; auf nordfranzösischen Einfluß weist auch der
Kirchenbau der Gräfinnen hin.
Mit Brauns Angabe der Jahreszahl gewinnen wir eine wichtige Zeitangabe für
die Entstehung der Gemälde, die entweder im selben Jahre oder, falls sich die
Zahl nur auf die Mensa bezieht, bald nachher ausgeführt wurden. Keinesfalls wird
die Mensa lange ohne den beabsichtigten Schmuck gestanden haben. Wenn
man bei der Zuweisung des Altarwerks an den Meister Wilhelm der Limburger
Chronik bleibt, so würde es sein erstes bezeugtes Auftreten in Köln darstellen,
wo er sonst erst von 1358 ab nachweisbar ist. An dieses Werk knüpften sich also
wohl die Blüte und der Ruf seiner Werkstatt in Köln; vielleicht wurde es auch erst
die Veranlassung zu seiner dauernden Niederlassung in der Rheinstadt.
Ganz abgesehen von all diesen Vermutungen und Schlüssen, die sich an
Brauns Mitteilungen knüpfen, sind uns diese als die erste und noch auf lange
Zeit hinaus einzige Erwähnung der unvergleichlichen Gemälde wichtig, aus
der wir die Hochachtung und Bewunderung eines verständnisvollen Beschauers
heraushören, wenn er auch naturgemäß die Art der Darstellung als seiner Zeit
fernstehend, als „antik" empfindet. Dr. Ing. Hans Vogts.
6 Eine umfangreiche Grundstückserwerbung des Klosters in diesem Jahre (K e u s s e n ,
I Sp. 277a) wird der nach dem Kirchenneubau in Angriff genommenen Erweiterung der
Klosterräume gedient haben.
Offenbar hat das Kölner Klarissenkloster wenig schriftliche Aufzeichnungen,
Chroniken und dergl. besessen, wie denn auch leider fast nichts derartiges erhalten
ist; dieser Umstand mag Brauns Irrtümer entschuldigen.
Gerade dadurch wird der weitere Inhalt seiner Mitteilungen aber für uns um so
wertvoller, da er jedenfalls um so sicherer auf eigenen Wahrnehmungen und For-
schungen im Kirchenbau und an den Kunstdenkmälern beruht; Braun wird also
auch die Altäre und Inschriften selbst gesehen haben. Wir brauchen deshalb an der
Jahreszahl nicht zu zweifeln, zumal es mit unseren Urkunden übereinstimmen
würde, daß die Kirche um 1347 fertiggestellt wurde. Diese Jahreszahl bedeutete
vielleicht das Jahr der Weihe der Altäre6. Da der Dechant keine schriftlichen Auf-
zeichnungen des Klosterarchivs benutzt zu haben scheint, müssen die Inschrift-
tafeln wohl auch den Namen Belas und ihre Äbtissinnenschaft angegeben haben —
ein bloßes Wappen hätte Braun ebenso gut an Philippina denken lassen können.
Daß der Altar auf die gräflichen Schwestern zurückgeht, vermutete schon Firme-
nich-Richartz auf Grund der beiden kleinen Wappenschilder mit dem blauen
Löwen auf goldenem Feld (ohne Würfel, Steine oder Schindeln), wie ihn Reinald I.
und II. von Geldern führten; diese Wappenschilder finden sich auf der Altar-
mensa der Darstellung Jesu im Tempel (in der unteren Reihe des Mittelfeldes,
rechts). Man möchte nach Brauns Mitteilungen annehmen, daß diese gemalte
Mensa mit ihren Wappen eine Nachbildung der wirklichen Mensa des Altars
war, da die Anbringung der Stifterwappen an dieser Stelle auf Gemälden sonst
wohl nicht üblich war.
Daß die Stifterin oder die Stifterinnen des Altars uns bekannt sind, ist für die
Frage nach der Herkunft der Kunst seines Meisters nicht ohne Bedeutung; die
Gräfinnen waren Enkelinnen eines kunstliebenden und baulustigen Grafen von
Flandern, an dessen Hof die Kultur des nordfranzösischen Rittertums blühte
und dessen Nachkommen damals in enger Verbindung mit dem vielseitigen
Künstlerkreis von Tournai standen; auf nordfranzösischen Einfluß weist auch der
Kirchenbau der Gräfinnen hin.
Mit Brauns Angabe der Jahreszahl gewinnen wir eine wichtige Zeitangabe für
die Entstehung der Gemälde, die entweder im selben Jahre oder, falls sich die
Zahl nur auf die Mensa bezieht, bald nachher ausgeführt wurden. Keinesfalls wird
die Mensa lange ohne den beabsichtigten Schmuck gestanden haben. Wenn
man bei der Zuweisung des Altarwerks an den Meister Wilhelm der Limburger
Chronik bleibt, so würde es sein erstes bezeugtes Auftreten in Köln darstellen,
wo er sonst erst von 1358 ab nachweisbar ist. An dieses Werk knüpften sich also
wohl die Blüte und der Ruf seiner Werkstatt in Köln; vielleicht wurde es auch erst
die Veranlassung zu seiner dauernden Niederlassung in der Rheinstadt.
Ganz abgesehen von all diesen Vermutungen und Schlüssen, die sich an
Brauns Mitteilungen knüpfen, sind uns diese als die erste und noch auf lange
Zeit hinaus einzige Erwähnung der unvergleichlichen Gemälde wichtig, aus
der wir die Hochachtung und Bewunderung eines verständnisvollen Beschauers
heraushören, wenn er auch naturgemäß die Art der Darstellung als seiner Zeit
fernstehend, als „antik" empfindet. Dr. Ing. Hans Vogts.
6 Eine umfangreiche Grundstückserwerbung des Klosters in diesem Jahre (K e u s s e n ,
I Sp. 277a) wird der nach dem Kirchenneubau in Angriff genommenen Erweiterung der
Klosterräume gedient haben.