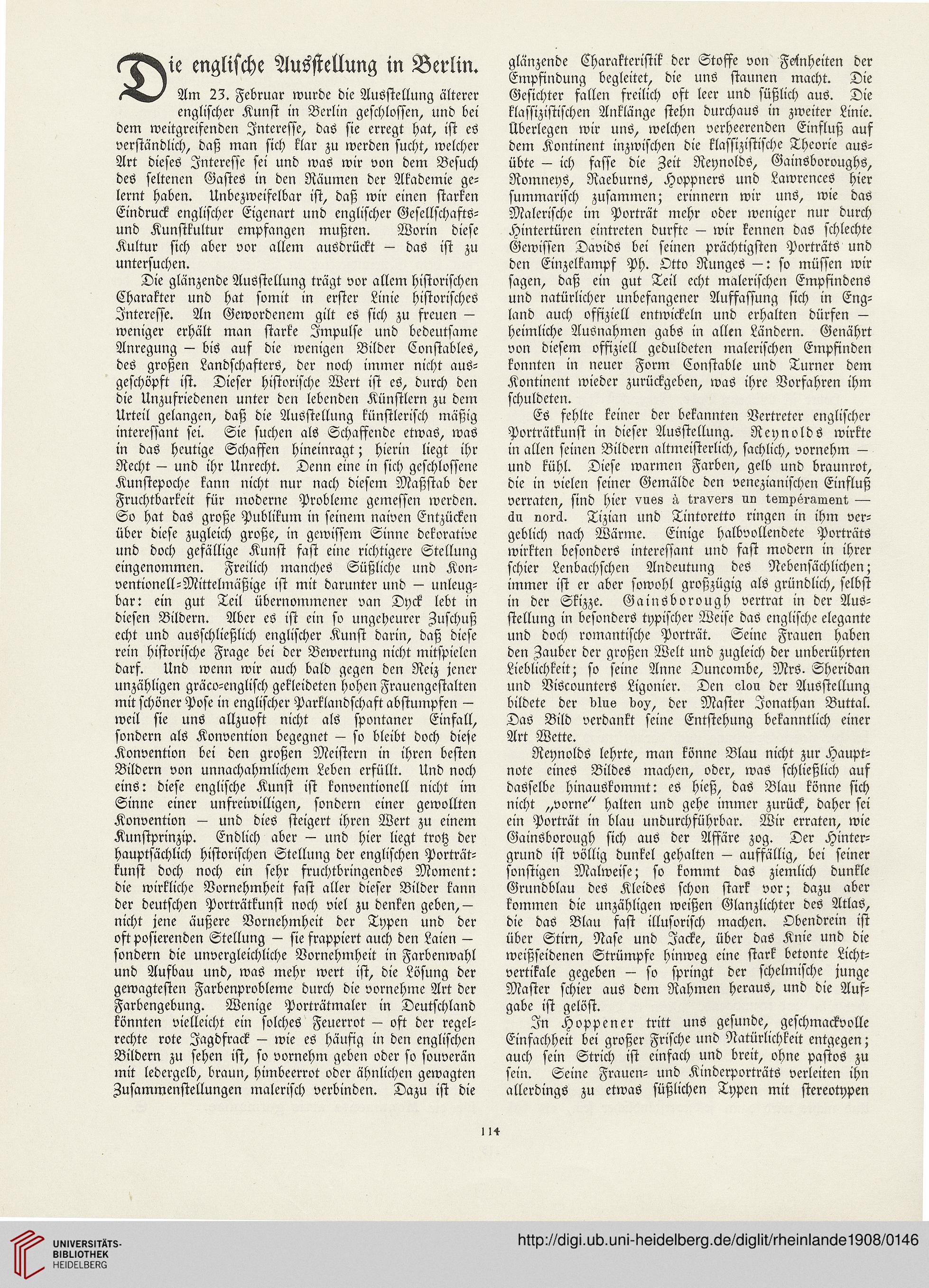ie englische Ausstellung in Berlin.
Am 2Z. Februar wurde die Ausstellung älterer
englischer Kunst in Berlin geschlossen, und bei
dem weitgreisenden Interesse, das sie erregt hat, ist eö
verständlich, daß man sich klar zu werden sucht, welcher
Art dieses Interesse sei und was wir von dem Besuch
des seltenen Gastes in den Räumen der Akademie ge-
lernt haben. Unbezweiselbar ist, daß wir einen starken
Eindruck englischer Eigenart und englischer GesellschaftS-
und Kunstkultur empfangen mußten. Worin diese
Kultur sich aber vor allem ausdrückt — das ist zu
untersuchen.
Die glänzende Ausstellung trägt vor allem historischen
Charakter und hat somit in erster Linie historisches
Interesse. An Gewordenem gilt es sich zu freuen —
weniger erhält man starke Impulse und bedeutsame
Anregung — bis aus die wenigen Bilder Constables,
des großen Landschafters, der noch immer nicht aus-
geschöpft ist. Dieser historische Wert ist es, durch den
die Unzufriedene» unter den lebenden Künstlern zu dem
Urteil gelangen, daß die Ausstellung künstlerisch mäßig
interessant sei. Sie suchen als Schaffende etwas, was
in das heutige Schaffen hineinragt; hierin liegt ihr
Recht — und ihr Unrecht. Denn eine in sich geschlossene
Kunstepoche kann nicht nur nach diesem Maßstab der
Fruchtbarkeit für moderne Probleme gemessen werden.
So hat das große Publikum in seinem naiven Entzücken
über diese zugleich große, in gewissem Sinne dekorative
und doch gefällige Kunst fast eine richtigere Stellung
eingenommen. Freilich manches Süßliche und Kon-
ventionell-Mittelmäßige ist mit darunter und — unleug-
bar: ein gut Teil übernommener van Dyck lebt in
diesen Bildern. Aber es ist ein so ungeheurer Zuschuß
echt und ausschließlich englischer Kunst darin, daß diese
rein historische Frage bei der Bewertung nicht mitspielcn
darf. Und wenn wir auch bald gegen den Reiz jener
unzähligen gräco-englisch gekleideten hohen Frauengestalten
mit schöner Pose in englischer Parklandschaft abstumpfcn —
weil sie uns allzuoft nicht als spontaner Einfall,
sondern als Konvention begegnet — so bleibt doch diese
Konvention bei den großen Meistern in ihren besten
Bildern von unnachahmlichem Leben erfüllt. Und noch
eins: diese englische Kunst ist konventionell nicht im
Sinne einer unfreiwilligen, sondern einer gewollten
Konvention — und dies steigert ihren Wert zu einem
Kunstprinzip. Endlich aber - und hier liegt trotz der
hauptsächlich historischen Stellung der englischen Porträt-
kunft doch noch ein sehr fruchtbringendes Moment:
die wirkliche Vornehmheit fast aller dieser Bilder kann
der deutschen Porträtkunst noch viel zu denken geben,—
nicht jene äußere Vornehmheit der Typen und der
oft posierenden Stellung - sie frappiert auch den Laien -
sondern die unvergleichliche Vornehmheit in Farbenwahl
und Aufbau und, was mehr wert ist, die Lösung der
gewagtesten Farbenprobleme durch die vornehme Art der
Farbengebung. Wenige Porträtmaler in Deutschland
könnten vielleicht ein solches Feuerrot — oft der regel-
rechte rote Jagdfrack — wie es häufig in den englischen
Bildern zu sehen ist, so vornehm geben oder so souverän
mit ledergelb, braun, himbeerrot oder ähnlichen gewagten
Zusammenstellungen malerisch verbinden. Dazu ist die
glänzende Charakteristik der Stoffe von Feinheiten der
Empfindung begleitet, die uns staunen macht. Die
Gesichter fallen freilich oft leer und süßlich aus. Die
klassizistischen Anklänge stehn durchaus in zweiter Linie.
Überlegen wir uns, welchen verheerenden Einfluß auf
dem Kontinent inzwischen die klassizistische Theorie aus-
übte — ich fasse die Zeit Reynolds, Gainöboroughs,
Romneys, Raeburns, Hoppners und Lawrences hier
summarisch zusammen; erinnern wir uns, wie das
Malerische im Porträt mehr oder weniger nur durch
Hintertüren eintreten durfte — wir kennen das schlechte
Gewissen Davids bei seinen prächtigsten Porträts und
den Einzelkampf PH. Otto Runges —: so müssen wir
sagen, daß ein gut Teil echt malerischen Empfindens
und natürlicher unbefangener Auffassung sich in Eng-
land auch offiziell entwickeln und erhalten dürfen —
heimliche Ausnahmen gabs in allen Ländern. Genährt
von diesem offiziell geduldeten malerischen Empfinden
konnten in neuer Form Constable und Turner dem
Kontinent wieder zurückgeben, was ihre Vorfahren ihm
schuldeten.
Es fehlte keiner der bekannten Vertreter englischer
Porträtkunst in dieser Ausstellung. Reynolds wirkte
in allen seinen Bildern altmeisterlich, sachlich, vornehm —
und kühl. Diese warmen Farben, gelb und braunrot,
die in vielen seiner Gemälde den venezianischen Einfluß
verraten, find hier VV6S L travers UV tsrnxöraivsvt —
<iu vorä. Tizian und Tintoretto ringen in ihm ver-
geblich nach Wärme. Einige halbvollendete Porträts
wirkten besonders interessant und fast modern in ihrer
schier Lenbachschen Andeutung des Nebensächlichen;
immer ist er aber sowohl großzügig als gründlich, selbst
in der Skizze. Gainöborough vertrat in der Aus-
stellung in besonders typischer Weise das englische elegante
und doch romantische Porträt. Seine Frauen haben
den Zauber der großen Welt und zugleich der unberührten
Lieblichkeit; so seine Anne Duncombe, Mrs. Sheridan
und Viöcounters Ligonier. Den dou der Ausstellung
bildete der bin« boz^, der Master Jonathan Buttal.
Das Bild verdankt seine Entstehung bekanntlich einer
Art Wette.
Reynolds lehrte, man könne Blau nicht zur Haupt-
note eines Bildes machen, oder, was schließlich auf
dasselbe hinauskommt: es hieß, das Blau könne sich
nicht „vorne" halten und gehe immer zurück, daher sei
ein Porträt in blau undurchführbar. Wir erraten, wie
Gainöborough sich aus der Affäre zog. Der Hinter-
grund ist völlig dunkel gehalten — auffällig, bei seiner
sonstigen Malweise; so kommt das ziemlich dunkle
Grundblau des Kleides schon stark vor; dazu aber
kommen die unzähligen weißen Glanzlichter des Atlas,
die das Blau fast illusorisch machen. Obendrein ist
über Stirn, Nase und Jacke, über das Knie und die
weißseidenen Strümpfe hinweg eine stark betonte Licht-
vertikale gegeben — so springt der schelmische junge
Master schier aus dem Rahmen heraus, und die Auf-
gabe ist gelöst.
In Hoppener tritt uns gesunde, geschmackvolle
Einfachheit bei großer Frische und Natürlichkeit entgegen;
auch sein Strich ist einfach und breit, ohne pastös zu
sein. Seine Frauen- und Kinderporträts verleiten ihn
allerdings zu etwas süßlichen Typen mit stereotypen
Am 2Z. Februar wurde die Ausstellung älterer
englischer Kunst in Berlin geschlossen, und bei
dem weitgreisenden Interesse, das sie erregt hat, ist eö
verständlich, daß man sich klar zu werden sucht, welcher
Art dieses Interesse sei und was wir von dem Besuch
des seltenen Gastes in den Räumen der Akademie ge-
lernt haben. Unbezweiselbar ist, daß wir einen starken
Eindruck englischer Eigenart und englischer GesellschaftS-
und Kunstkultur empfangen mußten. Worin diese
Kultur sich aber vor allem ausdrückt — das ist zu
untersuchen.
Die glänzende Ausstellung trägt vor allem historischen
Charakter und hat somit in erster Linie historisches
Interesse. An Gewordenem gilt es sich zu freuen —
weniger erhält man starke Impulse und bedeutsame
Anregung — bis aus die wenigen Bilder Constables,
des großen Landschafters, der noch immer nicht aus-
geschöpft ist. Dieser historische Wert ist es, durch den
die Unzufriedene» unter den lebenden Künstlern zu dem
Urteil gelangen, daß die Ausstellung künstlerisch mäßig
interessant sei. Sie suchen als Schaffende etwas, was
in das heutige Schaffen hineinragt; hierin liegt ihr
Recht — und ihr Unrecht. Denn eine in sich geschlossene
Kunstepoche kann nicht nur nach diesem Maßstab der
Fruchtbarkeit für moderne Probleme gemessen werden.
So hat das große Publikum in seinem naiven Entzücken
über diese zugleich große, in gewissem Sinne dekorative
und doch gefällige Kunst fast eine richtigere Stellung
eingenommen. Freilich manches Süßliche und Kon-
ventionell-Mittelmäßige ist mit darunter und — unleug-
bar: ein gut Teil übernommener van Dyck lebt in
diesen Bildern. Aber es ist ein so ungeheurer Zuschuß
echt und ausschließlich englischer Kunst darin, daß diese
rein historische Frage bei der Bewertung nicht mitspielcn
darf. Und wenn wir auch bald gegen den Reiz jener
unzähligen gräco-englisch gekleideten hohen Frauengestalten
mit schöner Pose in englischer Parklandschaft abstumpfcn —
weil sie uns allzuoft nicht als spontaner Einfall,
sondern als Konvention begegnet — so bleibt doch diese
Konvention bei den großen Meistern in ihren besten
Bildern von unnachahmlichem Leben erfüllt. Und noch
eins: diese englische Kunst ist konventionell nicht im
Sinne einer unfreiwilligen, sondern einer gewollten
Konvention — und dies steigert ihren Wert zu einem
Kunstprinzip. Endlich aber - und hier liegt trotz der
hauptsächlich historischen Stellung der englischen Porträt-
kunft doch noch ein sehr fruchtbringendes Moment:
die wirkliche Vornehmheit fast aller dieser Bilder kann
der deutschen Porträtkunst noch viel zu denken geben,—
nicht jene äußere Vornehmheit der Typen und der
oft posierenden Stellung - sie frappiert auch den Laien -
sondern die unvergleichliche Vornehmheit in Farbenwahl
und Aufbau und, was mehr wert ist, die Lösung der
gewagtesten Farbenprobleme durch die vornehme Art der
Farbengebung. Wenige Porträtmaler in Deutschland
könnten vielleicht ein solches Feuerrot — oft der regel-
rechte rote Jagdfrack — wie es häufig in den englischen
Bildern zu sehen ist, so vornehm geben oder so souverän
mit ledergelb, braun, himbeerrot oder ähnlichen gewagten
Zusammenstellungen malerisch verbinden. Dazu ist die
glänzende Charakteristik der Stoffe von Feinheiten der
Empfindung begleitet, die uns staunen macht. Die
Gesichter fallen freilich oft leer und süßlich aus. Die
klassizistischen Anklänge stehn durchaus in zweiter Linie.
Überlegen wir uns, welchen verheerenden Einfluß auf
dem Kontinent inzwischen die klassizistische Theorie aus-
übte — ich fasse die Zeit Reynolds, Gainöboroughs,
Romneys, Raeburns, Hoppners und Lawrences hier
summarisch zusammen; erinnern wir uns, wie das
Malerische im Porträt mehr oder weniger nur durch
Hintertüren eintreten durfte — wir kennen das schlechte
Gewissen Davids bei seinen prächtigsten Porträts und
den Einzelkampf PH. Otto Runges —: so müssen wir
sagen, daß ein gut Teil echt malerischen Empfindens
und natürlicher unbefangener Auffassung sich in Eng-
land auch offiziell entwickeln und erhalten dürfen —
heimliche Ausnahmen gabs in allen Ländern. Genährt
von diesem offiziell geduldeten malerischen Empfinden
konnten in neuer Form Constable und Turner dem
Kontinent wieder zurückgeben, was ihre Vorfahren ihm
schuldeten.
Es fehlte keiner der bekannten Vertreter englischer
Porträtkunst in dieser Ausstellung. Reynolds wirkte
in allen seinen Bildern altmeisterlich, sachlich, vornehm —
und kühl. Diese warmen Farben, gelb und braunrot,
die in vielen seiner Gemälde den venezianischen Einfluß
verraten, find hier VV6S L travers UV tsrnxöraivsvt —
<iu vorä. Tizian und Tintoretto ringen in ihm ver-
geblich nach Wärme. Einige halbvollendete Porträts
wirkten besonders interessant und fast modern in ihrer
schier Lenbachschen Andeutung des Nebensächlichen;
immer ist er aber sowohl großzügig als gründlich, selbst
in der Skizze. Gainöborough vertrat in der Aus-
stellung in besonders typischer Weise das englische elegante
und doch romantische Porträt. Seine Frauen haben
den Zauber der großen Welt und zugleich der unberührten
Lieblichkeit; so seine Anne Duncombe, Mrs. Sheridan
und Viöcounters Ligonier. Den dou der Ausstellung
bildete der bin« boz^, der Master Jonathan Buttal.
Das Bild verdankt seine Entstehung bekanntlich einer
Art Wette.
Reynolds lehrte, man könne Blau nicht zur Haupt-
note eines Bildes machen, oder, was schließlich auf
dasselbe hinauskommt: es hieß, das Blau könne sich
nicht „vorne" halten und gehe immer zurück, daher sei
ein Porträt in blau undurchführbar. Wir erraten, wie
Gainöborough sich aus der Affäre zog. Der Hinter-
grund ist völlig dunkel gehalten — auffällig, bei seiner
sonstigen Malweise; so kommt das ziemlich dunkle
Grundblau des Kleides schon stark vor; dazu aber
kommen die unzähligen weißen Glanzlichter des Atlas,
die das Blau fast illusorisch machen. Obendrein ist
über Stirn, Nase und Jacke, über das Knie und die
weißseidenen Strümpfe hinweg eine stark betonte Licht-
vertikale gegeben — so springt der schelmische junge
Master schier aus dem Rahmen heraus, und die Auf-
gabe ist gelöst.
In Hoppener tritt uns gesunde, geschmackvolle
Einfachheit bei großer Frische und Natürlichkeit entgegen;
auch sein Strich ist einfach und breit, ohne pastös zu
sein. Seine Frauen- und Kinderporträts verleiten ihn
allerdings zu etwas süßlichen Typen mit stereotypen