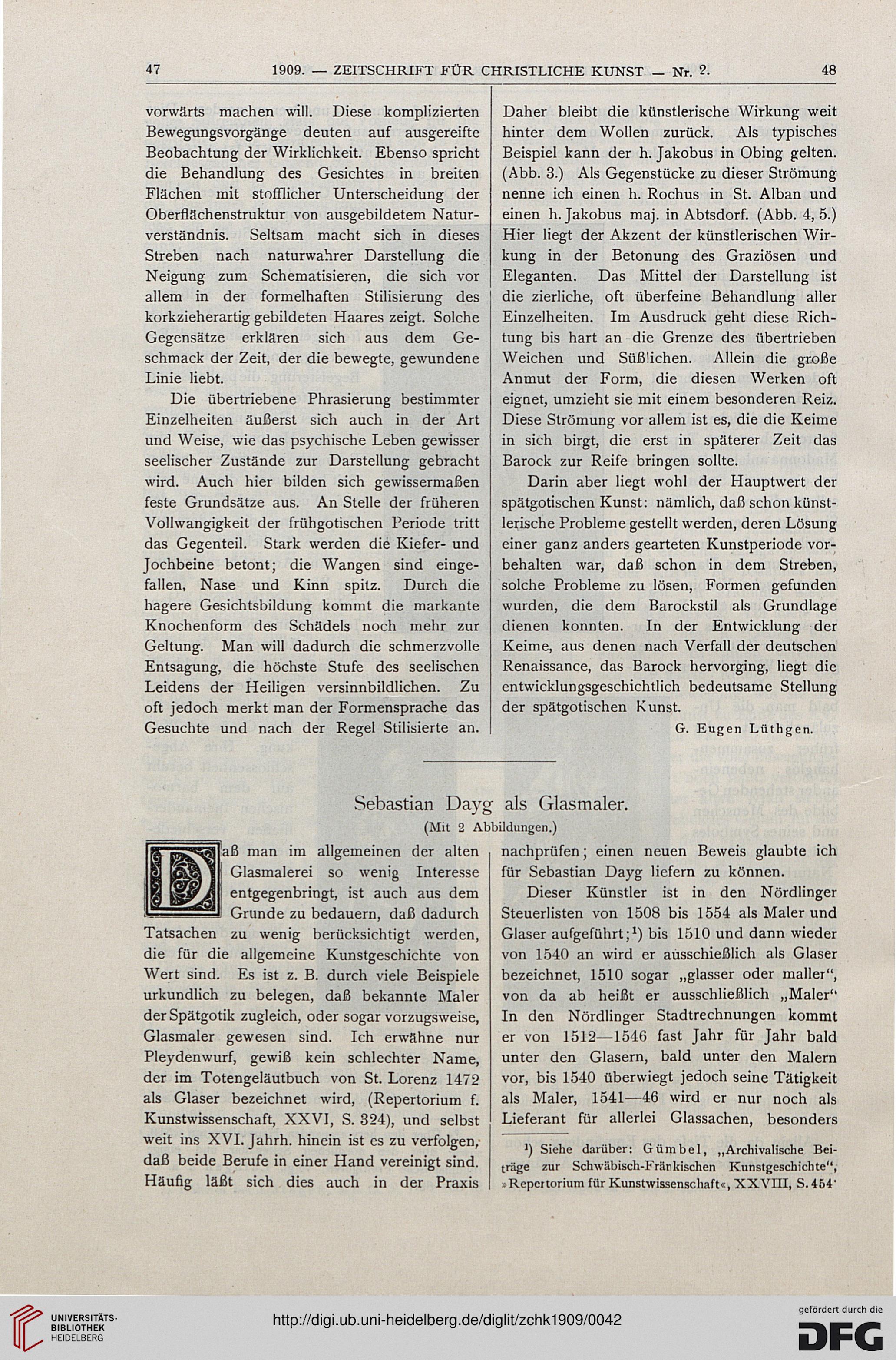47
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. ?•
48
vorwärts machen will. Diese komplizierten
Bewegungsvorgänge deuten auf ausgereifte
Beobachtung der Wirklichkeit. Ebenso spricht
die Behandlung des Gesichtes in breiten
Flächen mit stofflicher Unterscheidung der
Oberflächenstruktur von ausgebildetem Natur-
verständnis. Seltsam macht sich in dieses
Streben nach naturwahrer Darstellung die
Neigung zum Schematisieren, die sich vor
allem in der formelhaften Stilisierung des
korkzieherartig gebildeten Haares zeigt. Solche
Gegensätze erklären sich aus dem Ge-
schmack der Zeit, der die bewegte, gewundene
Linie liebt.
Die übertriebene Phrasierung bestimmter
Einzelheiten äußerst sich auch in der Art
und Weise, wie das psychische Leben gewisser
seelischer Zustände zur Darstellung gebracht
wird. Auch hier bilden sich gewissermaßen
feste Grundsätze aus. An Stelle der früheren
Vollwangigkeit der frühgotischen Periode tritt
das Gegenteil. Stark werden die Kiefer- und
Jochbeine betont; die Wangen sind einge-
fallen, Nase und Kinn spitz. Durch die
hagere Gesichtsbildung kommt die markante
Knochenform des Schädels noch mehr zur
Geltung. Man will dadurch die schmerzvolle
Entsagung, die höchste Stufe des seelischen
Leidens der Heiligen versinnbildlichen. Zu
oft jedoch merkt man der Formensprache das
Gesuchte und nach der Regel Stilisierte an.
Daher bleibt die künstlerische Wirkung weit
hinter dem Wollen zurück. Als typisches
Beispiel kann der h. Jakobus in Obing gelten.
(Abb. 3.) Als Gegenstücke zu dieser Strömung
nenne ich einen h. Rochus in St. Alban und
einen h. Jakobus maj. in Abtsdorf. (Abb. 4, 5.)
Hier liegt der Akzent der künstlerischen Wir-
kung in der Betonung des Graziösen und
Eleganten. Das Mittel der Darstellung ist
die zierliche, oft überfeine Behandlung aller
Einzelheiten. Im Ausdruck geht diese Rich-
tung bis hart an die Grenze des übertrieben
Weichen und Süßlichen. Allein die große
Anmut der Form, die diesen Werken oft
eignet, umzieht sie mit einem besonderen Reiz.
Diese Strömung vor allem ist es, die die Keime
in sich birgt, die erst in späterer Zeit das
Barock zur Reife bringen sollte.
Darin aber liegt wohl der Hauptwert der
spätgotischen Kunst: nämlich, daß schon künst-
lerische Probleme gestellt werden, deren Lösung
einer ganz anders gearteten Kunstperiode vor-
behalten war, daß schon in dem Streben,
solche Probleme zu lösen, Formen gefunden
wurden, die dem Barockstil als Grundlage
dienen konnten. In der Entwicklung der
Keime, aus denen nach Verfall der deutschen
Renaissance, das Barock hervorging, liegt die
entwicklungsgeschichtlich bedeutsame Stellung
der spätgotischen Kunst.
G. Eugen Lüthgen.
Sebastian Dayg als Glasmaler.
(Mit 2 Abbildungen.)
aß man im allgemeinen der alten
I Glasmalerei so wenig Interesse
entgegenbringt, ist auch aus dem
Grunde zu bedauern, daß dadurch
Tatsachen zu wenig berücksichtigt werden,
die für die allgemeine Kunstgeschichte von
Wert sind. Es ist z. B. durch viele Beispiele
urkundlich zu belegen, daß bekannte Maler
der Spätgotik zugleich, oder sogar vorzugsweise,
Glasmaler gewesen sind. Ich erwähne nur
Pleydenwurf, gewiß kein schlechter Name,
der im Totengeläutbuch von St. Lorenz 1472
als Glaser bezeichnet wird, (Repertorium f.
Kunstwissenschaft, XXVI, S. 324), und selbst
weit ins XVI. Jahrh. hinein ist es zu verfolgen,
daß beide Berufe in einer Hand vereinigt sind.
Häufig läßt sich dies auch in der Praxis
nachprüfen; einen neuen Beweis glaubte ich
für Sebastian Dayg liefern zu können.
Dieser Künstler ist in den Nördlinger
Steuerlisten von 1508 bis 1554 als Maler und
Glaser aufgeführt;1) bis 1510 und dann wieder
von 1540 an wird er ausschießlich als Glaser
bezeichnet, 1510 sogar „glasser oder maller",
von da ab heißt er ausschließlich „Maler"
In den Nördlinger Stadtrechnungen kommt
er von 1512—1546 fast Jahr für Jahr bald
unter den Glasern, bald unter den Malern
vor, bis 1540 überwiegt jedoch seine Tätigkeit
als Maler, 1541—46 wird er nur noch als
Lieferant für allerlei Glassachen, besonders
]) Siehe darüber: G um bei, „Archivalische Bei-
träge zur Schwäbisch-Frärkischen Kunstgeschichte",
»Repcrtorium für Kunstwissenschaft«, XXVIII, S. 454"
1909.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. ?•
48
vorwärts machen will. Diese komplizierten
Bewegungsvorgänge deuten auf ausgereifte
Beobachtung der Wirklichkeit. Ebenso spricht
die Behandlung des Gesichtes in breiten
Flächen mit stofflicher Unterscheidung der
Oberflächenstruktur von ausgebildetem Natur-
verständnis. Seltsam macht sich in dieses
Streben nach naturwahrer Darstellung die
Neigung zum Schematisieren, die sich vor
allem in der formelhaften Stilisierung des
korkzieherartig gebildeten Haares zeigt. Solche
Gegensätze erklären sich aus dem Ge-
schmack der Zeit, der die bewegte, gewundene
Linie liebt.
Die übertriebene Phrasierung bestimmter
Einzelheiten äußerst sich auch in der Art
und Weise, wie das psychische Leben gewisser
seelischer Zustände zur Darstellung gebracht
wird. Auch hier bilden sich gewissermaßen
feste Grundsätze aus. An Stelle der früheren
Vollwangigkeit der frühgotischen Periode tritt
das Gegenteil. Stark werden die Kiefer- und
Jochbeine betont; die Wangen sind einge-
fallen, Nase und Kinn spitz. Durch die
hagere Gesichtsbildung kommt die markante
Knochenform des Schädels noch mehr zur
Geltung. Man will dadurch die schmerzvolle
Entsagung, die höchste Stufe des seelischen
Leidens der Heiligen versinnbildlichen. Zu
oft jedoch merkt man der Formensprache das
Gesuchte und nach der Regel Stilisierte an.
Daher bleibt die künstlerische Wirkung weit
hinter dem Wollen zurück. Als typisches
Beispiel kann der h. Jakobus in Obing gelten.
(Abb. 3.) Als Gegenstücke zu dieser Strömung
nenne ich einen h. Rochus in St. Alban und
einen h. Jakobus maj. in Abtsdorf. (Abb. 4, 5.)
Hier liegt der Akzent der künstlerischen Wir-
kung in der Betonung des Graziösen und
Eleganten. Das Mittel der Darstellung ist
die zierliche, oft überfeine Behandlung aller
Einzelheiten. Im Ausdruck geht diese Rich-
tung bis hart an die Grenze des übertrieben
Weichen und Süßlichen. Allein die große
Anmut der Form, die diesen Werken oft
eignet, umzieht sie mit einem besonderen Reiz.
Diese Strömung vor allem ist es, die die Keime
in sich birgt, die erst in späterer Zeit das
Barock zur Reife bringen sollte.
Darin aber liegt wohl der Hauptwert der
spätgotischen Kunst: nämlich, daß schon künst-
lerische Probleme gestellt werden, deren Lösung
einer ganz anders gearteten Kunstperiode vor-
behalten war, daß schon in dem Streben,
solche Probleme zu lösen, Formen gefunden
wurden, die dem Barockstil als Grundlage
dienen konnten. In der Entwicklung der
Keime, aus denen nach Verfall der deutschen
Renaissance, das Barock hervorging, liegt die
entwicklungsgeschichtlich bedeutsame Stellung
der spätgotischen Kunst.
G. Eugen Lüthgen.
Sebastian Dayg als Glasmaler.
(Mit 2 Abbildungen.)
aß man im allgemeinen der alten
I Glasmalerei so wenig Interesse
entgegenbringt, ist auch aus dem
Grunde zu bedauern, daß dadurch
Tatsachen zu wenig berücksichtigt werden,
die für die allgemeine Kunstgeschichte von
Wert sind. Es ist z. B. durch viele Beispiele
urkundlich zu belegen, daß bekannte Maler
der Spätgotik zugleich, oder sogar vorzugsweise,
Glasmaler gewesen sind. Ich erwähne nur
Pleydenwurf, gewiß kein schlechter Name,
der im Totengeläutbuch von St. Lorenz 1472
als Glaser bezeichnet wird, (Repertorium f.
Kunstwissenschaft, XXVI, S. 324), und selbst
weit ins XVI. Jahrh. hinein ist es zu verfolgen,
daß beide Berufe in einer Hand vereinigt sind.
Häufig läßt sich dies auch in der Praxis
nachprüfen; einen neuen Beweis glaubte ich
für Sebastian Dayg liefern zu können.
Dieser Künstler ist in den Nördlinger
Steuerlisten von 1508 bis 1554 als Maler und
Glaser aufgeführt;1) bis 1510 und dann wieder
von 1540 an wird er ausschießlich als Glaser
bezeichnet, 1510 sogar „glasser oder maller",
von da ab heißt er ausschließlich „Maler"
In den Nördlinger Stadtrechnungen kommt
er von 1512—1546 fast Jahr für Jahr bald
unter den Glasern, bald unter den Malern
vor, bis 1540 überwiegt jedoch seine Tätigkeit
als Maler, 1541—46 wird er nur noch als
Lieferant für allerlei Glassachen, besonders
]) Siehe darüber: G um bei, „Archivalische Bei-
träge zur Schwäbisch-Frärkischen Kunstgeschichte",
»Repcrtorium für Kunstwissenschaft«, XXVIII, S. 454"