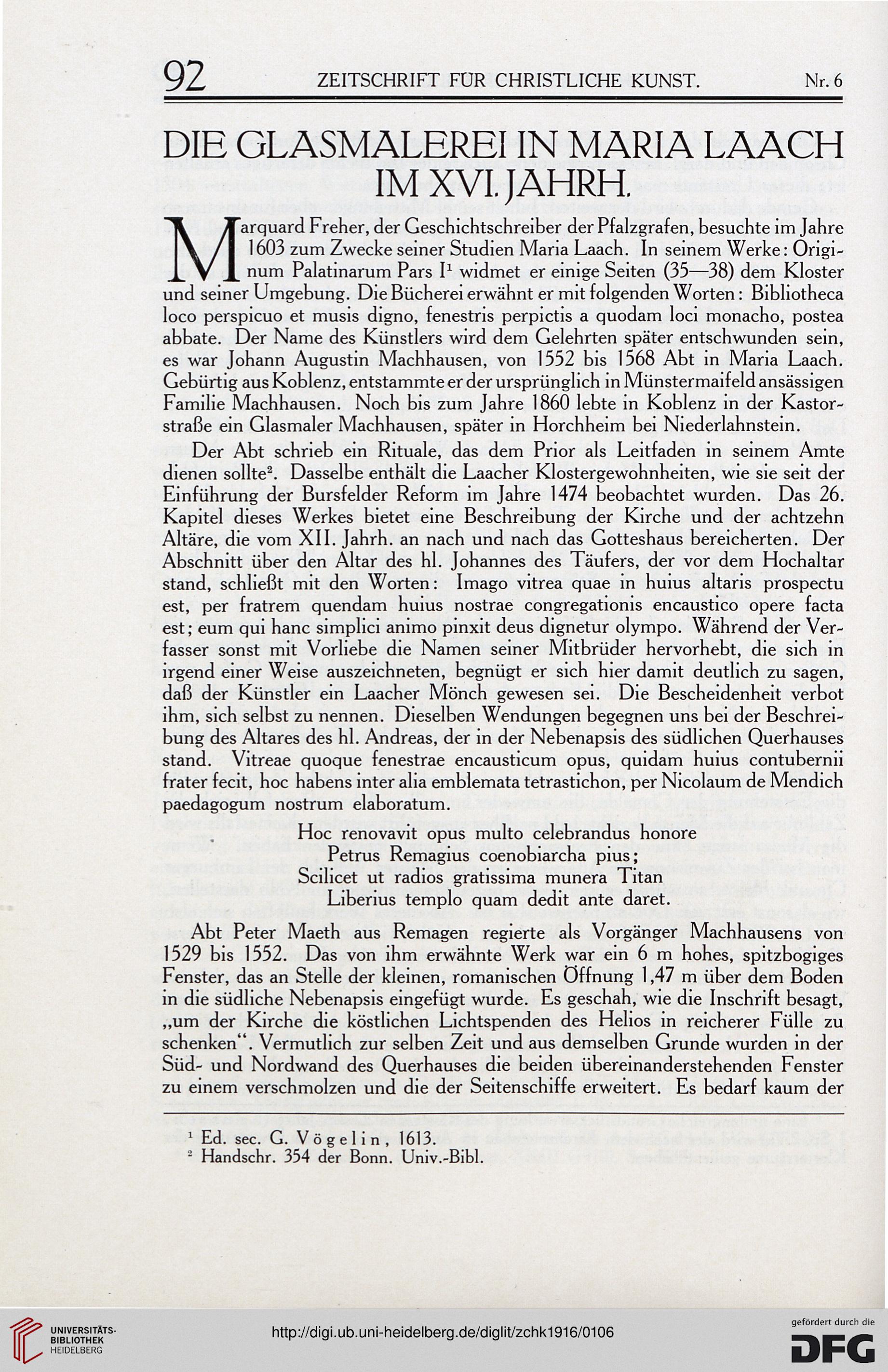92
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 6
DIE GLASMALEREI IN MARIA LAACH
IMXVI.JAHRH.
Marquard Freher, der Geschichtschreiber der Pfalzgrafen, besuchte im Jahre
1603 zum Zwecke seiner Studien Maria Laach. In seinem Werke: Origi-
num Palatmarum Pars I1 widmet er einige Seiten (35—38) dem Kloster
und seiner Umgebung. Die Bücherei erwähnt er mit folgenden Worten: Bibliotheca
loco perspicuo et musis digno, fenestris perpictis a quodam loci monacho, postea
abbate. Der Name des Künstlers wird dem Gelehrten später entschwunden sein,
es war Johann Augustin Machhausen, von 1552 bis 1568 Abt in Maria Laach.
Gebürtig aus Koblenz, entstammte er der ursprünglich in Münstermalfeld ansässigen
Familie Machhausen. Noch bis zum Jahre 1860 lebte in Koblenz in der Kastor-
straße ein Glasmaler Machhausen, später in Horchheim bei Niederlahnstein.
Der Abt schrieb ein Rituale, das dem Prior als Leitfaden in seinem Amte
dienen sollte2. Dasselbe enthält die Laacher Klostergewohnheiten, wie sie seit der
Einführung der Bursfelder Reform im Jahre 1474 beobachtet wurden. Das 26.
Kapitel dieses Werkes bietet eine Beschreibung der Kirche und der achtzehn
Altäre, die vom XII. Jahrh. an nach und nach das Gotteshaus bereicherten. Der
Abschnitt über den Altar des hl. Johannes des Täufers, der vor dem Hochaltar
stand, schließt mit den Worten: Imago vitrea quae in huius altaris prospectu
est, per fratrem quendam huius nostrae congregatioms encaustico opere facta
est; eum qui hanc simplici animo pmxit deus dignetur olympo. Während der Ver-
fasser sonst mit Vorliebe die Namen seiner Mitbrüder hervorhebt, die sich in
irgend einer Weise auszeichneten, begnügt er sich hier damit deutlich zu sagen,
daß der Künstler ein Laacher Mönch gewesen sei. Die Bescheidenheit verbot
ihm, sich selbst zu nennen. Dieselben Wendungen begegnen uns bei der Beschrei-
bung des Altares des hl. Andreas, der in der Nebenapsis des südlichen Querhauses
stand. Vitreae quoque fenestrae encausticum opus, quidam huius contubernn
frater fecit, hoc habens inter alia emblemata tetrastichon, per Nicolaum de Mendich
paedagogum nostrum elaboratum.
Hoc renovavit opus multo celebrandus honore
Petrus Remagius coenobiarcha pius;
Scilicet ut radios gratissima munera Titan
Libenus templo quam dedit ante daret.
Abt Peter Maeth aus Remagen regierte als Vorgänger Machhausens von
1529 bis 1552. Das von ihm erwähnte Werk war ein 6 m hohes, spitzbogiges
Fenster, das an Stelle der kleinen, romanischen Öffnung 1,47 m über dem Boden
in die südliche Nebenapsis eingefügt wurde. Es geschah, wie die Inschrift besagt,
„um der Kirche die köstlichen Lichtspenden des Helios in reicherer Fülle zu
schenken". Vermutlich zur selben Zeit und aus demselben Grunde wurden in der
Süd- und Nordwand des Querhauses die beiden übereinanderstehenden Fenster
zu einem verschmolzen und die der Seitenschiffe erweitert. Es bedarf kaum der
1 Ed. sec. G. Vögel in, 1613.
2 Handschr. 354 der Bonn. Univ.-Bibl.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST. Nr. 6
DIE GLASMALEREI IN MARIA LAACH
IMXVI.JAHRH.
Marquard Freher, der Geschichtschreiber der Pfalzgrafen, besuchte im Jahre
1603 zum Zwecke seiner Studien Maria Laach. In seinem Werke: Origi-
num Palatmarum Pars I1 widmet er einige Seiten (35—38) dem Kloster
und seiner Umgebung. Die Bücherei erwähnt er mit folgenden Worten: Bibliotheca
loco perspicuo et musis digno, fenestris perpictis a quodam loci monacho, postea
abbate. Der Name des Künstlers wird dem Gelehrten später entschwunden sein,
es war Johann Augustin Machhausen, von 1552 bis 1568 Abt in Maria Laach.
Gebürtig aus Koblenz, entstammte er der ursprünglich in Münstermalfeld ansässigen
Familie Machhausen. Noch bis zum Jahre 1860 lebte in Koblenz in der Kastor-
straße ein Glasmaler Machhausen, später in Horchheim bei Niederlahnstein.
Der Abt schrieb ein Rituale, das dem Prior als Leitfaden in seinem Amte
dienen sollte2. Dasselbe enthält die Laacher Klostergewohnheiten, wie sie seit der
Einführung der Bursfelder Reform im Jahre 1474 beobachtet wurden. Das 26.
Kapitel dieses Werkes bietet eine Beschreibung der Kirche und der achtzehn
Altäre, die vom XII. Jahrh. an nach und nach das Gotteshaus bereicherten. Der
Abschnitt über den Altar des hl. Johannes des Täufers, der vor dem Hochaltar
stand, schließt mit den Worten: Imago vitrea quae in huius altaris prospectu
est, per fratrem quendam huius nostrae congregatioms encaustico opere facta
est; eum qui hanc simplici animo pmxit deus dignetur olympo. Während der Ver-
fasser sonst mit Vorliebe die Namen seiner Mitbrüder hervorhebt, die sich in
irgend einer Weise auszeichneten, begnügt er sich hier damit deutlich zu sagen,
daß der Künstler ein Laacher Mönch gewesen sei. Die Bescheidenheit verbot
ihm, sich selbst zu nennen. Dieselben Wendungen begegnen uns bei der Beschrei-
bung des Altares des hl. Andreas, der in der Nebenapsis des südlichen Querhauses
stand. Vitreae quoque fenestrae encausticum opus, quidam huius contubernn
frater fecit, hoc habens inter alia emblemata tetrastichon, per Nicolaum de Mendich
paedagogum nostrum elaboratum.
Hoc renovavit opus multo celebrandus honore
Petrus Remagius coenobiarcha pius;
Scilicet ut radios gratissima munera Titan
Libenus templo quam dedit ante daret.
Abt Peter Maeth aus Remagen regierte als Vorgänger Machhausens von
1529 bis 1552. Das von ihm erwähnte Werk war ein 6 m hohes, spitzbogiges
Fenster, das an Stelle der kleinen, romanischen Öffnung 1,47 m über dem Boden
in die südliche Nebenapsis eingefügt wurde. Es geschah, wie die Inschrift besagt,
„um der Kirche die köstlichen Lichtspenden des Helios in reicherer Fülle zu
schenken". Vermutlich zur selben Zeit und aus demselben Grunde wurden in der
Süd- und Nordwand des Querhauses die beiden übereinanderstehenden Fenster
zu einem verschmolzen und die der Seitenschiffe erweitert. Es bedarf kaum der
1 Ed. sec. G. Vögel in, 1613.
2 Handschr. 354 der Bonn. Univ.-Bibl.