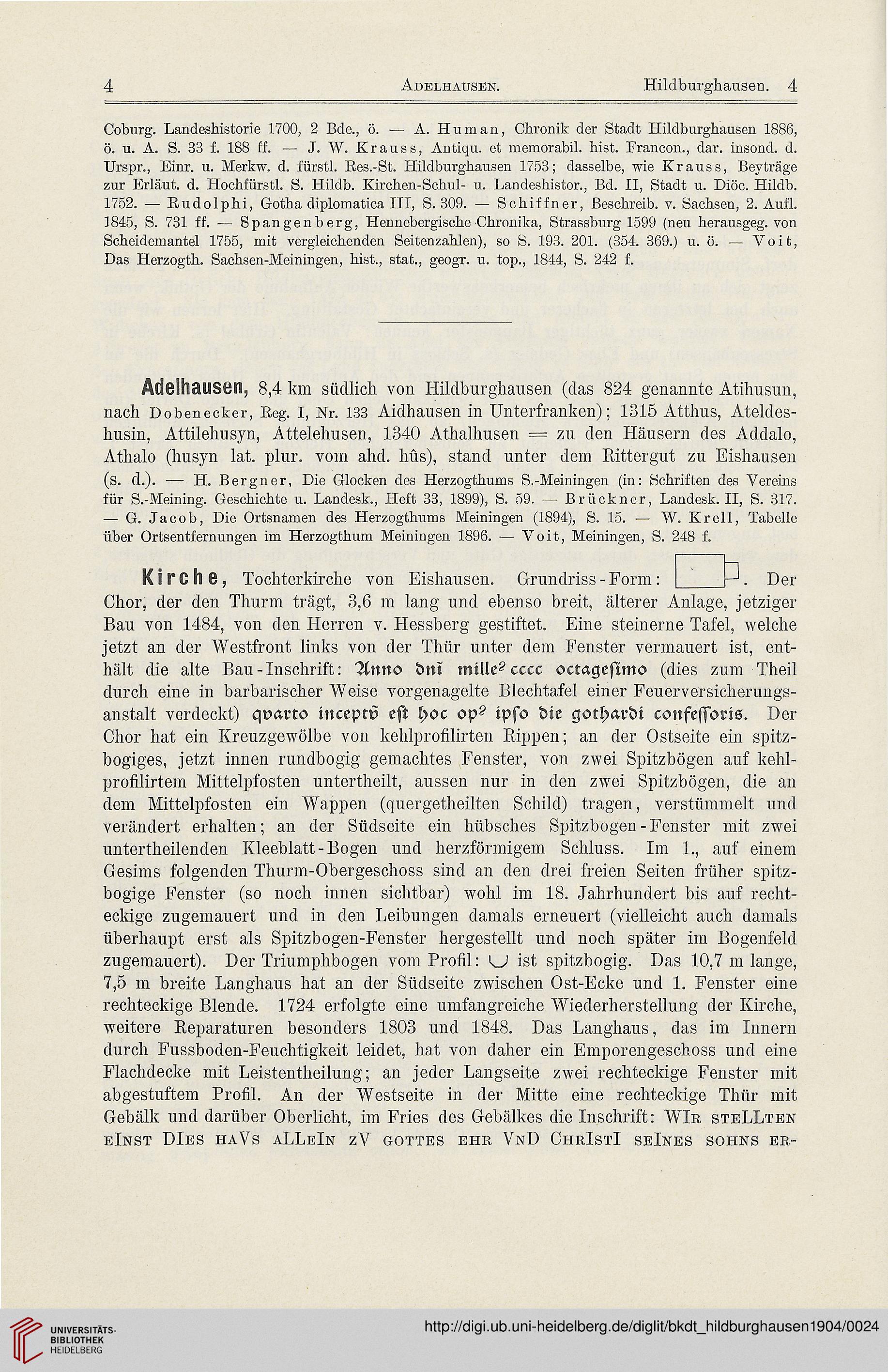4
Adblhausen.
Hildburghausen. 4
Coburg. Landeshistorie 1700, 2 Bde., ö. — A. Human, Chronik der Stadt Hildburghausen 1886,
ö. u. A. S. 33 f. 188 £f. — J. W. Krauss, Antiqu. et memorabil. hist. Francon., dar. insond. d.
Urspr., Einr. u. Merkw. d. fürstl. Bes.-St. Hildburghausen 1753; dasselbe, wie Krauss, Beyträge
zur Erläut. d. Hochfürstl. S. Hildb. Kirchen-Schul- u. Landcshistor., Bd. II, Stadt u. Diöc. Hildb.
1752. — Kudolphi, Gotha diplomatica III, S. 309. — Schiffner, Beschreib, v. Sachsen, 2. Aufl.
1845, S. 731 ff. — Spangenberg, Hennebergische Chronika, Strassburg 1599 (neu herausgeg. von
Scheidemantel 1755, mit vergleichenden Seitenzahlen), so S. 193. 201. (354. 369.) u. ö. — Voit,
Das Herzogth. Sachsen-Meiningen, hist., stat., geogr. u. top., 1844, S. 242 f.
Adelhausen, 8,4 km südlich von Hilclburghausen (das 824 genannte Atihusun,
nach Dobenecker, Beg. I, Nr. 133 Aidhausen in Unterfranken); 1315 Atthus, Ateldes-
husin, Attilehusyn, Attelehusen, 1340 Athalhusen = zu den Häusern des Addalo,
Athalo (husyn lat. plur. vom ahd. hüs), stand unter dem Rittergut zu Eishausen
(s. d.). — H. Bergner, Die Glocken des Herzogthums S.-Meiningen (in: Schriften des Vereins
für S.-Meining. Geschichte u. Landest, Heft 33, 1899), S. 59. — Brückner, Landest II, S. 317.
— G. Jacob, Die Ortsnamen des Herzogthums Meiningen (1894), S. 15. — W. Krell, Tabelle
über Ortsentfernungen im Herzogthum Meiningeu 1896. — Voit, Meiningen, S. 248 f.
□
Der
Kirche, Tochterkirche von Eishausen. Grundriss - Form:
Chor, der den Thurm trägt, 3,6 m lang und ebenso breit, älterer Anlage, jetziger
Bau von 1484, von den Herren v. Hessberg gestiftet. Eine steinerne Tafel, welche
jetzt an der Westfront links von der Thür unter dem Fenster vermauert ist, ent-
hält die alte Bau-Inschrift: 2ttmo bni mtlle? cccc octcujeftmo (dies zum Theil
durch eine in barbarischer Weise vorgenagelte Blechtafel einer Feuerversicherungs-
anstalt verdeckt) qt>avto mcepttü eft I>oc opg ipfo tue gotl^av&t confeffom. Der
Chor hat ein Kreuzgewölbe von kehlprofilirten Rippen; an der Ostseite ein spitz-
bogiges, jetzt innen rundbogig gemachtes Fenster, von zwei Spitzbögen auf kehl-
profilirtem Mittelpfosten untertheilt, aussen nur in den zwei Spitzbögen, die an
dem Mittelpfosten ein Wappen (quergetheilten Schild) tragen, verstümmelt und
verändert erhalten; an der Südseite ein hübsches Spitzbogen-Fenster mit zwei
untertheilenden Kleeblatt - Bogen und herzförmigem Schluss. Im 1., auf einem
Gesims folgenden Thurm-Obergeschoss sind an den drei freien Seiten früher spitz-
bogige Fenster (so noch innen sichtbar) wohl im 18. Jahrhundert bis auf recht-
eckige zugemauert und in den Leibungen damals erneuert (vielleicht auch damals
überhaupt erst als Spitzbogen-Fenster hergestellt und noch später im Bogenfeld
zugemauert). Der Triumphbogen vom Profil: ist spitzbogig. Das 10,7 m lange,
7,5 m breite Langhaus hat an der Südseite zwischen Ost-Ecke und 1. Fenster eine
rechteckige Blende. 1724 erfolgte eine umfangreiche Wiederherstellung der Kirche,
weitere Reparaturen besonders 1803 und 1848. Das Langhaus, das im Innern
durch Fussboden-Feuchtigkeit leidet, hat von daher ein Emporengeschoss und eine
Flachdecke mit Leistentheilung; an jeder Langseite zwei rechteckige Fenster mit
abgestuftem Profil. An der Westseite in der Mitte eine rechteckige Thür mit
Gebälk und darüber Oberlicht, im Fries des Gebälkes die Inschrift: WIr steLLten
eInst DIes haVs aLLeIn zV gottes ehr VnD CiirIstI seInes sohns er-
Adblhausen.
Hildburghausen. 4
Coburg. Landeshistorie 1700, 2 Bde., ö. — A. Human, Chronik der Stadt Hildburghausen 1886,
ö. u. A. S. 33 f. 188 £f. — J. W. Krauss, Antiqu. et memorabil. hist. Francon., dar. insond. d.
Urspr., Einr. u. Merkw. d. fürstl. Bes.-St. Hildburghausen 1753; dasselbe, wie Krauss, Beyträge
zur Erläut. d. Hochfürstl. S. Hildb. Kirchen-Schul- u. Landcshistor., Bd. II, Stadt u. Diöc. Hildb.
1752. — Kudolphi, Gotha diplomatica III, S. 309. — Schiffner, Beschreib, v. Sachsen, 2. Aufl.
1845, S. 731 ff. — Spangenberg, Hennebergische Chronika, Strassburg 1599 (neu herausgeg. von
Scheidemantel 1755, mit vergleichenden Seitenzahlen), so S. 193. 201. (354. 369.) u. ö. — Voit,
Das Herzogth. Sachsen-Meiningen, hist., stat., geogr. u. top., 1844, S. 242 f.
Adelhausen, 8,4 km südlich von Hilclburghausen (das 824 genannte Atihusun,
nach Dobenecker, Beg. I, Nr. 133 Aidhausen in Unterfranken); 1315 Atthus, Ateldes-
husin, Attilehusyn, Attelehusen, 1340 Athalhusen = zu den Häusern des Addalo,
Athalo (husyn lat. plur. vom ahd. hüs), stand unter dem Rittergut zu Eishausen
(s. d.). — H. Bergner, Die Glocken des Herzogthums S.-Meiningen (in: Schriften des Vereins
für S.-Meining. Geschichte u. Landest, Heft 33, 1899), S. 59. — Brückner, Landest II, S. 317.
— G. Jacob, Die Ortsnamen des Herzogthums Meiningen (1894), S. 15. — W. Krell, Tabelle
über Ortsentfernungen im Herzogthum Meiningeu 1896. — Voit, Meiningen, S. 248 f.
□
Der
Kirche, Tochterkirche von Eishausen. Grundriss - Form:
Chor, der den Thurm trägt, 3,6 m lang und ebenso breit, älterer Anlage, jetziger
Bau von 1484, von den Herren v. Hessberg gestiftet. Eine steinerne Tafel, welche
jetzt an der Westfront links von der Thür unter dem Fenster vermauert ist, ent-
hält die alte Bau-Inschrift: 2ttmo bni mtlle? cccc octcujeftmo (dies zum Theil
durch eine in barbarischer Weise vorgenagelte Blechtafel einer Feuerversicherungs-
anstalt verdeckt) qt>avto mcepttü eft I>oc opg ipfo tue gotl^av&t confeffom. Der
Chor hat ein Kreuzgewölbe von kehlprofilirten Rippen; an der Ostseite ein spitz-
bogiges, jetzt innen rundbogig gemachtes Fenster, von zwei Spitzbögen auf kehl-
profilirtem Mittelpfosten untertheilt, aussen nur in den zwei Spitzbögen, die an
dem Mittelpfosten ein Wappen (quergetheilten Schild) tragen, verstümmelt und
verändert erhalten; an der Südseite ein hübsches Spitzbogen-Fenster mit zwei
untertheilenden Kleeblatt - Bogen und herzförmigem Schluss. Im 1., auf einem
Gesims folgenden Thurm-Obergeschoss sind an den drei freien Seiten früher spitz-
bogige Fenster (so noch innen sichtbar) wohl im 18. Jahrhundert bis auf recht-
eckige zugemauert und in den Leibungen damals erneuert (vielleicht auch damals
überhaupt erst als Spitzbogen-Fenster hergestellt und noch später im Bogenfeld
zugemauert). Der Triumphbogen vom Profil: ist spitzbogig. Das 10,7 m lange,
7,5 m breite Langhaus hat an der Südseite zwischen Ost-Ecke und 1. Fenster eine
rechteckige Blende. 1724 erfolgte eine umfangreiche Wiederherstellung der Kirche,
weitere Reparaturen besonders 1803 und 1848. Das Langhaus, das im Innern
durch Fussboden-Feuchtigkeit leidet, hat von daher ein Emporengeschoss und eine
Flachdecke mit Leistentheilung; an jeder Langseite zwei rechteckige Fenster mit
abgestuftem Profil. An der Westseite in der Mitte eine rechteckige Thür mit
Gebälk und darüber Oberlicht, im Fries des Gebälkes die Inschrift: WIr steLLten
eInst DIes haVs aLLeIn zV gottes ehr VnD CiirIstI seInes sohns er-