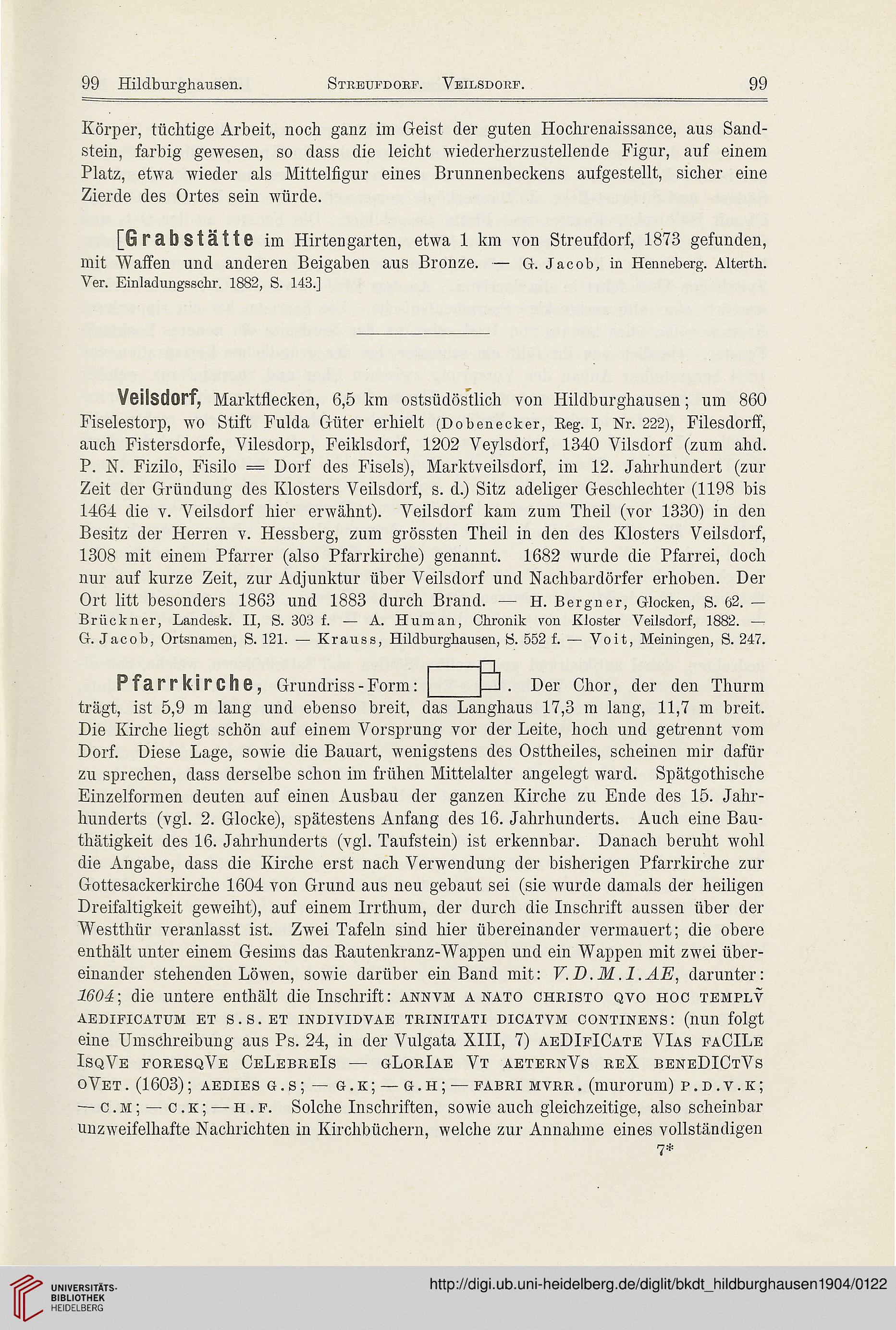99 Hildburghausen.
Strbupdoep.
Veilsdorf.
99
Körper, tüchtige Arbeit, noch ganz im Geist der guten Hochrenaissance, aus Sand-
stein, farbig gewesen, so dass die leicht wiederherzustellende Figur, auf einem
Platz, etwa wieder als Mittelfigur eines Brunnenbeckens aufgestellt, sicher eine
Zierde des Ortes sein würde.
[Grabstätte im Hirtengarten, etwa 1 km von Streufdorf, 1873 gefunden,
mit Waffen und anderen Beigaben aus Bronze. — G. Jacob, in Henneberg. Alterth.
Ver. Einladungsschr. 1882, S. 143.]
Veilsdorf, Marktflecken, 6,5 km ostsüdöstlich von Hildburghausen; um 860
Fiselestorp, wo Stift Fulda Güter erhielt (Dobenecker, Eeg. I, Nr. 222), Filesdorff,
auch Fistersdorfe, Vilesdorp, Feikisdorf, 1202 Veylsdorf, 1340 Vilsdorf (zum ahd.
P. N. Fizilo, Fisilo = Dorf des Fisels), Marktveilsdorf, im 12. Jahrhundert (zur
Zeit der Gründung des Klosters Veilsdorf, s. d.) Sitz adeliger Geschlechter (1198 bis
1464 die v. Veilsdorf hier erwähnt). Veilsdorf kam zum Theil (vor 1330) in den
Besitz der Herren v. Hessberg, zum grössten Theil in den des Klosters Veilsdorf,
1308 mit einem Pfarrer (also Pfarrkirche) genannt. 1682 wurde die Pfarrei, doch
nur auf kurze Zeit, zur Adjunktur über Veilsdorf und Nachbardörfer erhoben. Der
Ort litt besonders 1863 und 1883 durch Brand. — H. Bergner, Glocken, S. 62. —
Brückner, Landesk. II, S. 303 f. — A. Human, Chronik von Kloster Veilsdorf, 1882. —
G. Jacob, Ortsnamen, S. 121. — Krauss, Hildburghaiisen, B. 552 f. — Voit, Meiningen, S. 247.
trägt, ist 5,9 m lang und ebenso breit, das Langhaus 17,3 m lang, 11,7 m breit.
Die Kirche liegt schön auf einem Vorsprung vor der Leite, hoch und getrennt vom
Dorf. Diese Lage, sowie die Bauart, wenigstens des Osttheiles, scheinen mir dafür
zu sprechen, dass derselbe schon im frühen Mittelalter angelegt ward. Spätgothische
Einzelformen deuten auf einen Ausbau der ganzen Kirche zu Ende des 15. Jahr-
hunderts (vgl. 2. Glocke), spätestens Anfang des 16. Jahrhunderts. Auch eine Bau-
thätigkeit des 16. Jahrhunderts (vgl. Taufstein) ist erkennbar. Danach beruht wohl
die Angabe, dass die Kirche erst nach Verwendung der bisherigen Pfarrkirche zur
Gottesackerkirche 1604 von Grund aus neu gebaut sei (sie wurde damals der heiligen
Dreifaltigkeit geweiht), auf einem Irrthum, der durch die Inschrift aussen über der
Westthür veranlasst ist. Zwei Tafeln sind hier übereinander vermauert; die obere
enthält unter einem Gesims das Bautenkranz-Wappen und ein Wappen mit zwei über-
einander stehenden Löwen, sowie darüber ein Band mit: V.D.M.I.AE, darunter:
1604; die untere enthält die Inschrift: annvm a nato christo qvo hoc templv
aedificatum et s.s. et individvae trinitati dicatvm continens: (nilll folgt
eine Umsehreibung aus Ps. 24, in der Vulgata XIII, 7) aeDIfICate VIas paCILe
IsqVe foresqVe CeLebreIs — gLorIae Vt aeternVs reX beneDICtVs
oVet. (1603); aedies g . s; — g.k; — g.h; — fabri mvrr. (murorum) p.r>.v.k;
— cm; — ck; — h . f. Solche Inschriften, sowie auch gleichzeitige, also scheinbar
unzweifelhafte Nachrichten in Kirchbüchern, welche zur Annahme eines vollständigen
Pfarrkirche
Der Chor, der den Thurm
7*
Strbupdoep.
Veilsdorf.
99
Körper, tüchtige Arbeit, noch ganz im Geist der guten Hochrenaissance, aus Sand-
stein, farbig gewesen, so dass die leicht wiederherzustellende Figur, auf einem
Platz, etwa wieder als Mittelfigur eines Brunnenbeckens aufgestellt, sicher eine
Zierde des Ortes sein würde.
[Grabstätte im Hirtengarten, etwa 1 km von Streufdorf, 1873 gefunden,
mit Waffen und anderen Beigaben aus Bronze. — G. Jacob, in Henneberg. Alterth.
Ver. Einladungsschr. 1882, S. 143.]
Veilsdorf, Marktflecken, 6,5 km ostsüdöstlich von Hildburghausen; um 860
Fiselestorp, wo Stift Fulda Güter erhielt (Dobenecker, Eeg. I, Nr. 222), Filesdorff,
auch Fistersdorfe, Vilesdorp, Feikisdorf, 1202 Veylsdorf, 1340 Vilsdorf (zum ahd.
P. N. Fizilo, Fisilo = Dorf des Fisels), Marktveilsdorf, im 12. Jahrhundert (zur
Zeit der Gründung des Klosters Veilsdorf, s. d.) Sitz adeliger Geschlechter (1198 bis
1464 die v. Veilsdorf hier erwähnt). Veilsdorf kam zum Theil (vor 1330) in den
Besitz der Herren v. Hessberg, zum grössten Theil in den des Klosters Veilsdorf,
1308 mit einem Pfarrer (also Pfarrkirche) genannt. 1682 wurde die Pfarrei, doch
nur auf kurze Zeit, zur Adjunktur über Veilsdorf und Nachbardörfer erhoben. Der
Ort litt besonders 1863 und 1883 durch Brand. — H. Bergner, Glocken, S. 62. —
Brückner, Landesk. II, S. 303 f. — A. Human, Chronik von Kloster Veilsdorf, 1882. —
G. Jacob, Ortsnamen, S. 121. — Krauss, Hildburghaiisen, B. 552 f. — Voit, Meiningen, S. 247.
trägt, ist 5,9 m lang und ebenso breit, das Langhaus 17,3 m lang, 11,7 m breit.
Die Kirche liegt schön auf einem Vorsprung vor der Leite, hoch und getrennt vom
Dorf. Diese Lage, sowie die Bauart, wenigstens des Osttheiles, scheinen mir dafür
zu sprechen, dass derselbe schon im frühen Mittelalter angelegt ward. Spätgothische
Einzelformen deuten auf einen Ausbau der ganzen Kirche zu Ende des 15. Jahr-
hunderts (vgl. 2. Glocke), spätestens Anfang des 16. Jahrhunderts. Auch eine Bau-
thätigkeit des 16. Jahrhunderts (vgl. Taufstein) ist erkennbar. Danach beruht wohl
die Angabe, dass die Kirche erst nach Verwendung der bisherigen Pfarrkirche zur
Gottesackerkirche 1604 von Grund aus neu gebaut sei (sie wurde damals der heiligen
Dreifaltigkeit geweiht), auf einem Irrthum, der durch die Inschrift aussen über der
Westthür veranlasst ist. Zwei Tafeln sind hier übereinander vermauert; die obere
enthält unter einem Gesims das Bautenkranz-Wappen und ein Wappen mit zwei über-
einander stehenden Löwen, sowie darüber ein Band mit: V.D.M.I.AE, darunter:
1604; die untere enthält die Inschrift: annvm a nato christo qvo hoc templv
aedificatum et s.s. et individvae trinitati dicatvm continens: (nilll folgt
eine Umsehreibung aus Ps. 24, in der Vulgata XIII, 7) aeDIfICate VIas paCILe
IsqVe foresqVe CeLebreIs — gLorIae Vt aeternVs reX beneDICtVs
oVet. (1603); aedies g . s; — g.k; — g.h; — fabri mvrr. (murorum) p.r>.v.k;
— cm; — ck; — h . f. Solche Inschriften, sowie auch gleichzeitige, also scheinbar
unzweifelhafte Nachrichten in Kirchbüchern, welche zur Annahme eines vollständigen
Pfarrkirche
Der Chor, der den Thurm
7*