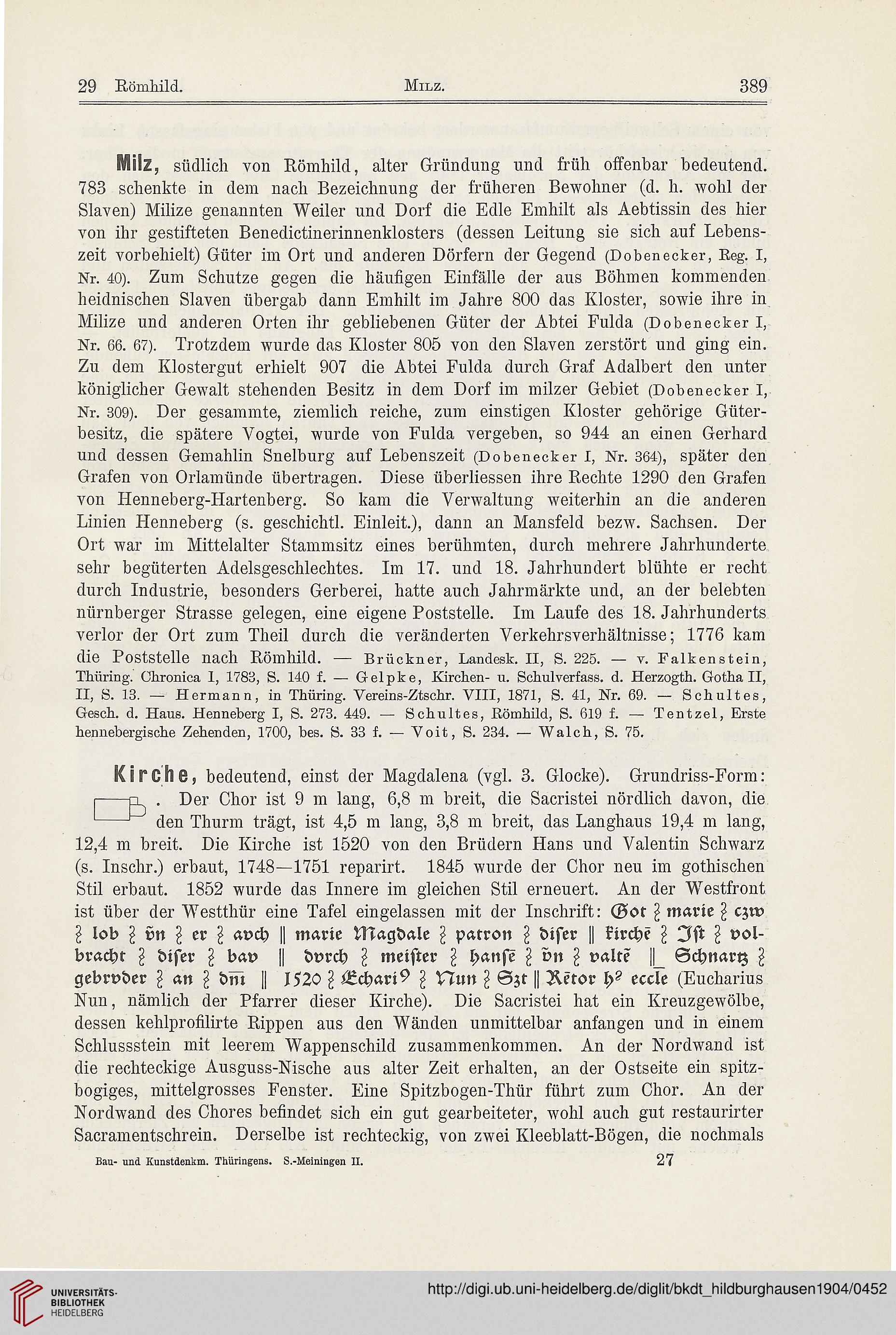29 Römhild.
Milz.
389
Milz, südlich von Römhild, alter Gründung und früh offenbar bedeutend.
783 schenkte in dem nach Bezeichnung der früheren Bewohner (d. h. wohl der
Slaven) Milize genannten Weiler und Dorf die Edle Emhilt als Aebtissin des hier
von ihr gestifteten Benedictinerinnenklosters (dessen Leitung sie sich auf Lebens-
zeit vorbehielt) Güter im Ort und anderen Dörfern der Gegend (Dobenecker, Eeg. I,
Nr. 40). Zum Schutze gegen die häufigen Einfälle der aus Böhmen kommenden
heidnischen Slaven übergab dann Emhilt im Jahre 800 das Kloster, sowie ihre in
Milize und anderen Orten ihr gebliebenen Güter der Abtei Fulda (Dobenecker I,
Nr. 66. 67). Trotzdem wurde das Kloster 805 von den Slaven zerstört und ging ein.
Zu dem Klostergut erhielt 907 die Abtei Fulda durch Graf Adalbert den unter
königlicher Gewalt stehenden Besitz in dem Dorf im milzer Gebiet (Dobenecker I,
Nr. 309). Der gesammte, ziemlich reiche, zum einstigen Kloster gehörige Güter-
besitz, die spätere Vogtei, wurde von Fulda vergeben, so 944 an einen Gerhard
und dessen Gemahlin Snelburg auf Lebenszeit (Dobenecker I, Nr. 364), später den
Grafen von Orlamünde übertragen. Diese überliessen ihre Rechte 1290 den Grafen
von Henneberg-Hartenberg. So kam die Verwaltung weiterhin an die anderen
Linien Henneberg (s. geschieht! Einleit), dann an Mansfeld bezw. Sachsen. Der
Ort war im Mittelalter Stammsitz eines berühmten, durch mehrere Jahrhunderte
sehr begüterten Adelsgeschlechtes. Im 17. und 18. Jahrhundert blühte er recht
durch Industrie, besonders Gerberei, hatte auch Jahrmärkte und, an der belebten
nürnberger Strasse gelegen, eine eigene Poststelle. Im Laufe des 18. Jahrhunderts
verlor der Ort zum Theil durch die veränderten Verkehrsverhältnisse; 1776 kam
die Poststelle nach Römhild. — Brückner, Landesk. II, S. 225. — v. Falkenstein,
Thüring. Chronica I, 1783, S. 140 f. — G-elpke, Kirchen- u. Schulverfass. d. Herzogth. Gotha II,
II, S. 13. — Hermann, in Thüring. Vereins-Ztschr. VIII, 1871, S. 41, Nr. 69. — Schultes,
Gesch. d. Haus. Henneberg I, S. 273. 449. — Schultes, ßömhild, S. 619 f. — Tentzel, Erste
hennebergische Zehenden, 1700, bes. ö. 33 f. — Voit, S. 234. — Walch, S. 75.
Kirche, bedeutend, einst der Magdalena (vgl. 3. Glocke). Grundriss-Form:
j-n . Der Chor ist 9 m lang, 6,8 m breit, die Sacristei nördlich davon, die
- den Thurm trägt, ist 4,5 m lang, 3,8 m breit, das Langhaus 19,4 m lang,
12,4 m breit. Die Kirche ist 1520 von den Brüdern Hans und Valentin Schwarz
(s. Inschr.) erbaut, 1748—1751 reparirt. 1845 wurde der Chor neu im gothischen
Stil erbaut. 1852 wurde das Innere im gleichen Stil erneuert. An der Westfront
ist über der Westthür eine Tafel eingelassen mit der Inschrift: (Bot l trtavte $ cjn?
I lob l vn l er l avd) || marte CTTagfcale l patron l tufer || fivc^e l Oft \ v>o\-
bvadbt l bifev } bat) || vvvcb l metfter l !><mfc l vn l t?alte [[_ ©d)ti<m$ l
gebn>t>er l an l oiü || 1520 l OtcfyfinV l Vinn l ©jt || &etoi- If eccle (Eucharius
Nun, nämlich der Pfarrer dieser Kirche). Die Sacristei hat ein Kreuzgewölbe,
dessen kehlprofilirte Rippen aus den Wänden unmittelbar anfangen und in einem
Schlussstein mit leerem Wappenschild zusammenkommen. An der Nordwand ist
die rechteckige Ausguss-Nische aus alter Zeit erhalten, an der Ostseite ein spitz-
bogiges, mittelgrosses Fenster. Eine Spitzbogen-Thür führt zum Chor. An der
Nordwand des Chores befindet sich ein gut gearbeiteter, wohl auch gut restaurirter
Sacramentschrein. Derselbe ist rechteckig, von zwei Kleeblatt-Bö gen, die nochmals
Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.-Meiningen II. 27
Milz.
389
Milz, südlich von Römhild, alter Gründung und früh offenbar bedeutend.
783 schenkte in dem nach Bezeichnung der früheren Bewohner (d. h. wohl der
Slaven) Milize genannten Weiler und Dorf die Edle Emhilt als Aebtissin des hier
von ihr gestifteten Benedictinerinnenklosters (dessen Leitung sie sich auf Lebens-
zeit vorbehielt) Güter im Ort und anderen Dörfern der Gegend (Dobenecker, Eeg. I,
Nr. 40). Zum Schutze gegen die häufigen Einfälle der aus Böhmen kommenden
heidnischen Slaven übergab dann Emhilt im Jahre 800 das Kloster, sowie ihre in
Milize und anderen Orten ihr gebliebenen Güter der Abtei Fulda (Dobenecker I,
Nr. 66. 67). Trotzdem wurde das Kloster 805 von den Slaven zerstört und ging ein.
Zu dem Klostergut erhielt 907 die Abtei Fulda durch Graf Adalbert den unter
königlicher Gewalt stehenden Besitz in dem Dorf im milzer Gebiet (Dobenecker I,
Nr. 309). Der gesammte, ziemlich reiche, zum einstigen Kloster gehörige Güter-
besitz, die spätere Vogtei, wurde von Fulda vergeben, so 944 an einen Gerhard
und dessen Gemahlin Snelburg auf Lebenszeit (Dobenecker I, Nr. 364), später den
Grafen von Orlamünde übertragen. Diese überliessen ihre Rechte 1290 den Grafen
von Henneberg-Hartenberg. So kam die Verwaltung weiterhin an die anderen
Linien Henneberg (s. geschieht! Einleit), dann an Mansfeld bezw. Sachsen. Der
Ort war im Mittelalter Stammsitz eines berühmten, durch mehrere Jahrhunderte
sehr begüterten Adelsgeschlechtes. Im 17. und 18. Jahrhundert blühte er recht
durch Industrie, besonders Gerberei, hatte auch Jahrmärkte und, an der belebten
nürnberger Strasse gelegen, eine eigene Poststelle. Im Laufe des 18. Jahrhunderts
verlor der Ort zum Theil durch die veränderten Verkehrsverhältnisse; 1776 kam
die Poststelle nach Römhild. — Brückner, Landesk. II, S. 225. — v. Falkenstein,
Thüring. Chronica I, 1783, S. 140 f. — G-elpke, Kirchen- u. Schulverfass. d. Herzogth. Gotha II,
II, S. 13. — Hermann, in Thüring. Vereins-Ztschr. VIII, 1871, S. 41, Nr. 69. — Schultes,
Gesch. d. Haus. Henneberg I, S. 273. 449. — Schultes, ßömhild, S. 619 f. — Tentzel, Erste
hennebergische Zehenden, 1700, bes. ö. 33 f. — Voit, S. 234. — Walch, S. 75.
Kirche, bedeutend, einst der Magdalena (vgl. 3. Glocke). Grundriss-Form:
j-n . Der Chor ist 9 m lang, 6,8 m breit, die Sacristei nördlich davon, die
- den Thurm trägt, ist 4,5 m lang, 3,8 m breit, das Langhaus 19,4 m lang,
12,4 m breit. Die Kirche ist 1520 von den Brüdern Hans und Valentin Schwarz
(s. Inschr.) erbaut, 1748—1751 reparirt. 1845 wurde der Chor neu im gothischen
Stil erbaut. 1852 wurde das Innere im gleichen Stil erneuert. An der Westfront
ist über der Westthür eine Tafel eingelassen mit der Inschrift: (Bot l trtavte $ cjn?
I lob l vn l er l avd) || marte CTTagfcale l patron l tufer || fivc^e l Oft \ v>o\-
bvadbt l bifev } bat) || vvvcb l metfter l !><mfc l vn l t?alte [[_ ©d)ti<m$ l
gebn>t>er l an l oiü || 1520 l OtcfyfinV l Vinn l ©jt || &etoi- If eccle (Eucharius
Nun, nämlich der Pfarrer dieser Kirche). Die Sacristei hat ein Kreuzgewölbe,
dessen kehlprofilirte Rippen aus den Wänden unmittelbar anfangen und in einem
Schlussstein mit leerem Wappenschild zusammenkommen. An der Nordwand ist
die rechteckige Ausguss-Nische aus alter Zeit erhalten, an der Ostseite ein spitz-
bogiges, mittelgrosses Fenster. Eine Spitzbogen-Thür führt zum Chor. An der
Nordwand des Chores befindet sich ein gut gearbeiteter, wohl auch gut restaurirter
Sacramentschrein. Derselbe ist rechteckig, von zwei Kleeblatt-Bö gen, die nochmals
Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.-Meiningen II. 27