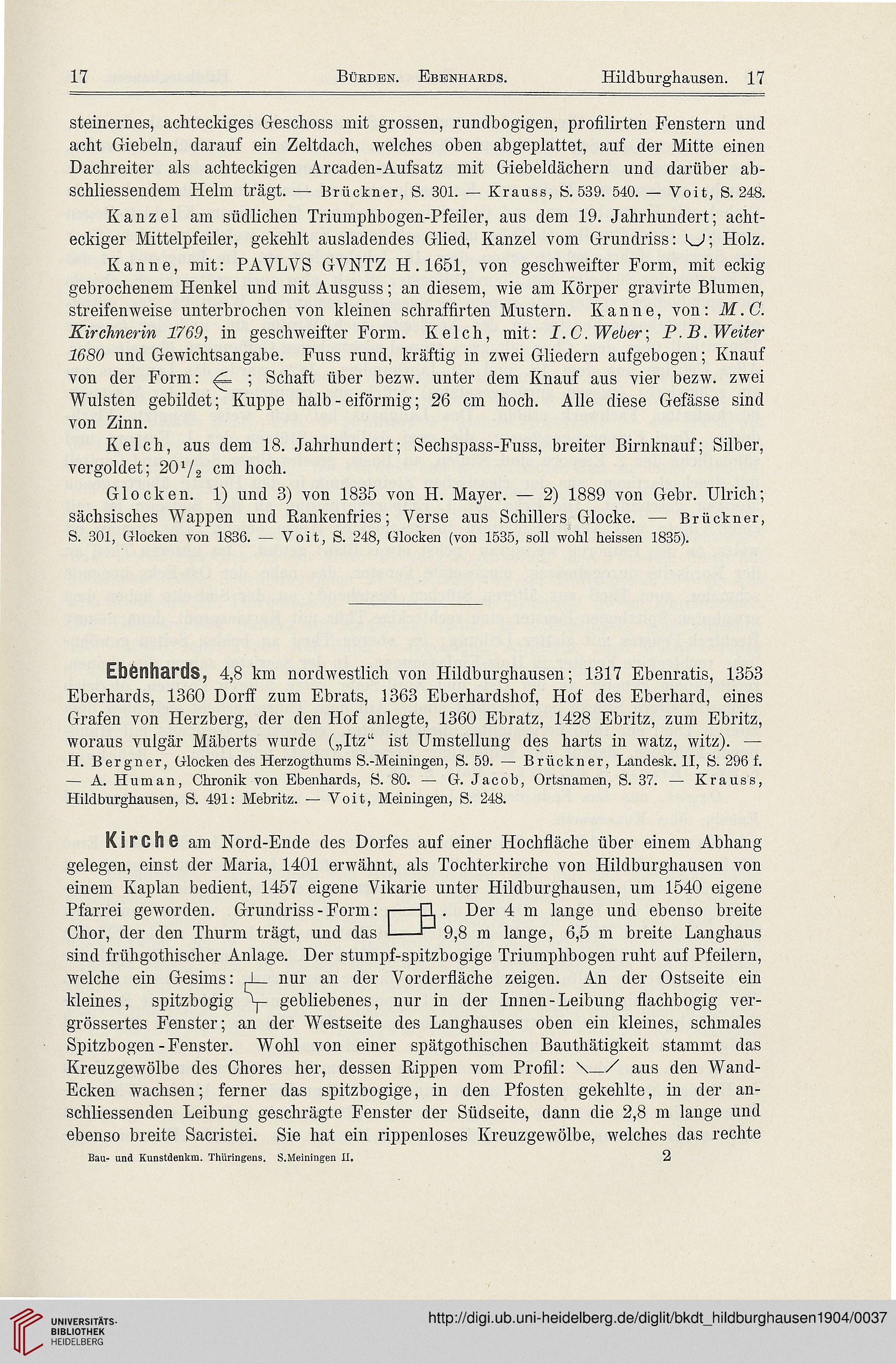17
Bürden. Ebenhards.
Hildburghausen. 17
steinernes, achteckiges Geschoss mit grossen, rundbogigen, profilirten Fenstern und
acht Giebeln, darauf ein Zeltdach, Avelches oben abgeplattet, auf der Mitte einen
Dachreiter als achteckigen Arcaden-Aufsatz mit Giebeldächern und darüber ab-
schliessendem Helm trägt. — Brückner, S. 301. — Krauss, S. 539. 540. — Voit, S. 248.
Kanzel am südlichen Triumphbogen-Pfeiler, aus dem 19. Jahrhundert; acht-
eckiger Mittelpfeiler, gekehlt ausladendes Glied, Kanzel vom Grundriss: kJ; Holz.
Kanne, mit: PAVLVS GVNTZ H. 1651, von geschweifter Form, mit eckig-
gebrochenem Henkel und mit Ausguss; an diesem, wie am Körper gravirte Blumen,
streifenweise unterbrochen von kleinen schraffirten Mustern. Kanne, von: M.C.
Kirchnerin 1769, in geschweifter Form. Kelch, mit: I.C.Weber; P.B.Weiter
1680 und Gewichtsangabe. Fuss rund, kräftig in zwei Gliedern aufgebogen; Knauf
von der Form: ; Schaft über bezw. unter dem Knauf aus vier bezw. zwei
Wülsten gebildet; Kuppe halb - eiförmig; 26 cm hoch. Alle diese Gefässe sind
von Zinn.
Kelch, aus dem 18. Jahrhundert; Sechspass-Fuss, breiter Birnknauf; Silber,
vergoldet; 201/2 cm hoch.
Glocken. 1) und 3) von 1835 von H. Mayer. — 2) 1889 von Gebr. Ulrich;
sächsisches Wappen und Rankenfries; Verse aus Schillers Glocke. — Brückner,
S. 301, Glocken von 1836. — Voit, S. 248, Glocken (von 1535, soll wohl heissen 1835).
Ebenhards, 4,8 km nordwestlich von Hildburghausen; 1317 Ebenratis, 1353
Eberhards, 1360 Dorff zum Ebrats, 1363 Eberhardshof, Hof des Eberhard, eines
Grafen von Herzberg, der den Hof anlegte, 1360 Ebratz, 1428 Ebritz, zum Ebritz,
woraus vulgär Mäberts wurde („Itz" ist Umstellung des harts in watz, witz). —
H. Bergner, Glocken des Herzogthums S.-Meiningen, S. 59. — Brückner, Landesk. II, 8. 296 f.
— A. Human, Chronik von Ebenhards, 8. 80. — G. Jacob, Ortsnamen, S. 37. — Krauss,
Hildburghausen, S. 491: Mebritz. — Voit, Meiningen, S. 248.
Kirche am Nord-Ende des Dorfes auf einer Hochfläche über einem Abhang
gelegen, einst der Maria, 1401 erwähnt, als Tochterkirche von Hildburghausen von
einem Kaplan bedient, 1457 eigene Vikarie unter Hildburghausen, um 1540 eigene
Pfarrei geworden. Grundriss - Form: i-Q . Der 4 m lange und ebenso breite
Chor, der den Thurm trägt, und das I-H m lange, 6,5 m breite Langhaus
sind frühgothischer Anlage. Der stumpf-spitzbogige Triumphbogen ruht auf Pfeilern,
welche ein Gesims: j_ nur an der Vorderfläche zeigen. An der Ostseite ein
kleines, spitzbogig y- gebliebenes, nur in der Innen-Leibung flachbogig ver-
grössertes Fenster; an der Westseite des Langhauses oben ein kleines, schmales
Spitzbogen-Fenster. Wohl von einer spätgothischen Bauthätigkeit stammt das
Kreuzgewölbe des Chores her, dessen Bippen vom Profil: \_/ aus den Wand-
Ecken wachsen; ferner das spitzbogige, in den Pfosten gekehlte, in der an-
schliessenden Leibung geschrägte Fenster der Südseite, dann die 2,8 m lange und
ebenso breite Sacristei. Sie hat ein rippenloses Kreuzgewölbe, welches das rechte
Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.Meiningen II. 2
Bürden. Ebenhards.
Hildburghausen. 17
steinernes, achteckiges Geschoss mit grossen, rundbogigen, profilirten Fenstern und
acht Giebeln, darauf ein Zeltdach, Avelches oben abgeplattet, auf der Mitte einen
Dachreiter als achteckigen Arcaden-Aufsatz mit Giebeldächern und darüber ab-
schliessendem Helm trägt. — Brückner, S. 301. — Krauss, S. 539. 540. — Voit, S. 248.
Kanzel am südlichen Triumphbogen-Pfeiler, aus dem 19. Jahrhundert; acht-
eckiger Mittelpfeiler, gekehlt ausladendes Glied, Kanzel vom Grundriss: kJ; Holz.
Kanne, mit: PAVLVS GVNTZ H. 1651, von geschweifter Form, mit eckig-
gebrochenem Henkel und mit Ausguss; an diesem, wie am Körper gravirte Blumen,
streifenweise unterbrochen von kleinen schraffirten Mustern. Kanne, von: M.C.
Kirchnerin 1769, in geschweifter Form. Kelch, mit: I.C.Weber; P.B.Weiter
1680 und Gewichtsangabe. Fuss rund, kräftig in zwei Gliedern aufgebogen; Knauf
von der Form: ; Schaft über bezw. unter dem Knauf aus vier bezw. zwei
Wülsten gebildet; Kuppe halb - eiförmig; 26 cm hoch. Alle diese Gefässe sind
von Zinn.
Kelch, aus dem 18. Jahrhundert; Sechspass-Fuss, breiter Birnknauf; Silber,
vergoldet; 201/2 cm hoch.
Glocken. 1) und 3) von 1835 von H. Mayer. — 2) 1889 von Gebr. Ulrich;
sächsisches Wappen und Rankenfries; Verse aus Schillers Glocke. — Brückner,
S. 301, Glocken von 1836. — Voit, S. 248, Glocken (von 1535, soll wohl heissen 1835).
Ebenhards, 4,8 km nordwestlich von Hildburghausen; 1317 Ebenratis, 1353
Eberhards, 1360 Dorff zum Ebrats, 1363 Eberhardshof, Hof des Eberhard, eines
Grafen von Herzberg, der den Hof anlegte, 1360 Ebratz, 1428 Ebritz, zum Ebritz,
woraus vulgär Mäberts wurde („Itz" ist Umstellung des harts in watz, witz). —
H. Bergner, Glocken des Herzogthums S.-Meiningen, S. 59. — Brückner, Landesk. II, 8. 296 f.
— A. Human, Chronik von Ebenhards, 8. 80. — G. Jacob, Ortsnamen, S. 37. — Krauss,
Hildburghausen, S. 491: Mebritz. — Voit, Meiningen, S. 248.
Kirche am Nord-Ende des Dorfes auf einer Hochfläche über einem Abhang
gelegen, einst der Maria, 1401 erwähnt, als Tochterkirche von Hildburghausen von
einem Kaplan bedient, 1457 eigene Vikarie unter Hildburghausen, um 1540 eigene
Pfarrei geworden. Grundriss - Form: i-Q . Der 4 m lange und ebenso breite
Chor, der den Thurm trägt, und das I-H m lange, 6,5 m breite Langhaus
sind frühgothischer Anlage. Der stumpf-spitzbogige Triumphbogen ruht auf Pfeilern,
welche ein Gesims: j_ nur an der Vorderfläche zeigen. An der Ostseite ein
kleines, spitzbogig y- gebliebenes, nur in der Innen-Leibung flachbogig ver-
grössertes Fenster; an der Westseite des Langhauses oben ein kleines, schmales
Spitzbogen-Fenster. Wohl von einer spätgothischen Bauthätigkeit stammt das
Kreuzgewölbe des Chores her, dessen Bippen vom Profil: \_/ aus den Wand-
Ecken wachsen; ferner das spitzbogige, in den Pfosten gekehlte, in der an-
schliessenden Leibung geschrägte Fenster der Südseite, dann die 2,8 m lange und
ebenso breite Sacristei. Sie hat ein rippenloses Kreuzgewölbe, welches das rechte
Bau- und Kunstdenkm. Thüringens. S.Meiningen II. 2