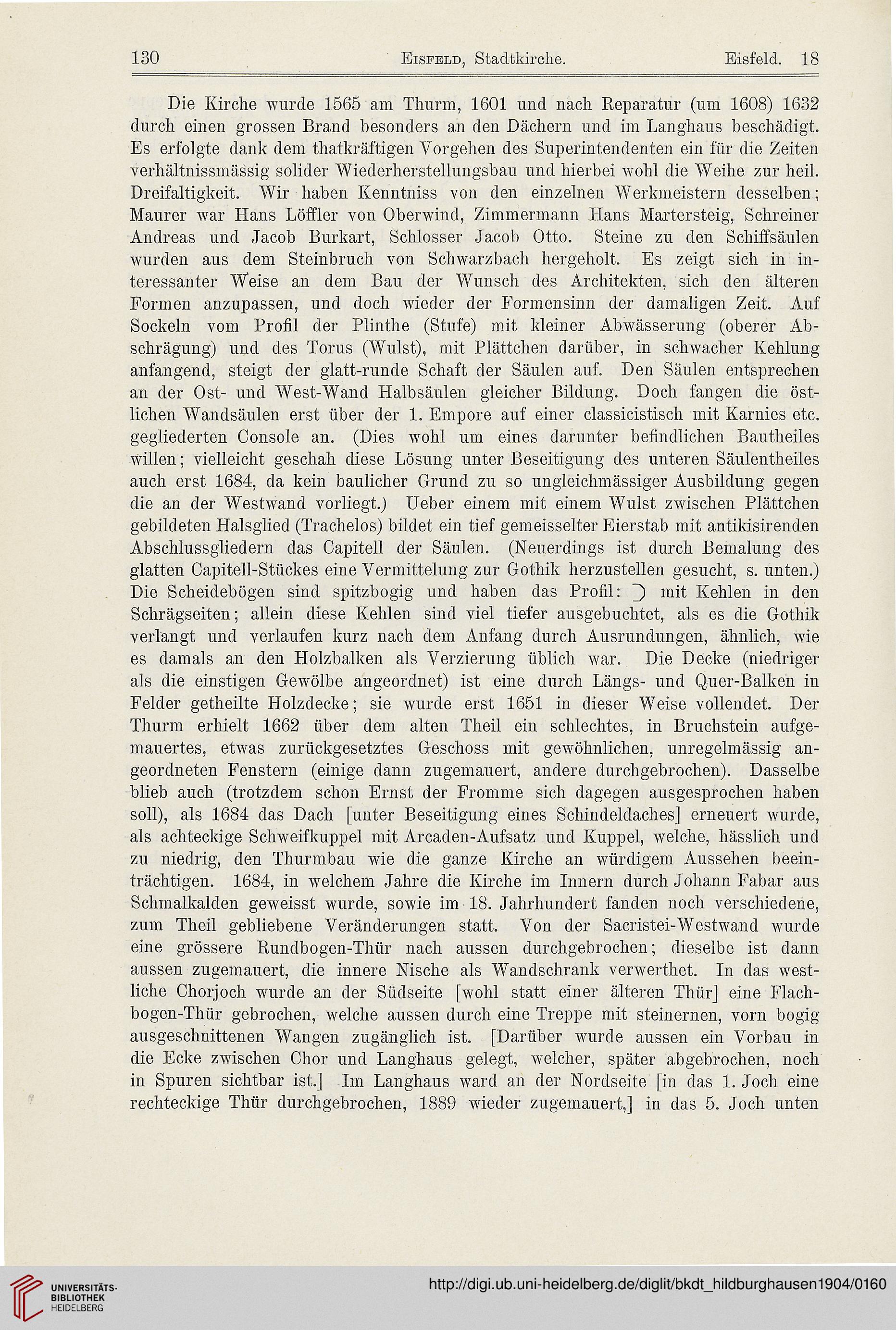130
Eisfeld, Stadtkirche.
Eisfeld. 18
Die Kirche wurde 1565 am Thurm, 1601 und nach Reparatur (um 1608) 1632
durch einen grossen Brand besonders an den Dächern und im Langhaus beschädigt.
Es erfolgte dank dem thatkräftigen Vorgehen des Superintendenten ein für die Zeiten
verhältnissmässig solider Wiederherstellungsbau und hierbei wohl die Weihe zur heil.
Dreifaltigkeit. Wir haben Kenntniss von den einzelnen Werkmeistern desselben;
Maurer war Hans Löffler von Oberwind, Zimmermann Hans Martersteig, Schreiner
Andreas und Jacob Burkart, Schlosser Jacob Otto. Steine zu den Schiffsäulen
wurden aus dem Steinbruch von Schwarzbach hergeholt. Es zeigt sich in in-
teressanter Weise an dem Bau der Wunsch des Architekten, sich den älteren
Formen anzupassen, und doch wieder der Formensinn der damaligen Zeit. Auf
Sockeln vom Profil der Plinthe (Stufe) mit kleiner Abwässerung (oberer Ab-
schrägung) und des Torus (Wulst), mit Plättchen darüber, in schwacher Kehlung
anfangend, steigt der glatt-runde Schaft der Säulen auf. Den Säulen entsprechen
an der Ost- und West-Wand Halbsäulen gleicher Bildung. Doch fangen die öst-
lichen Wandsäulen erst über der 1. Empore auf einer classicistisch mit Karnies etc.
gegliederten Console an. (Dies wohl um eines darunter befindlichen Bautheiles
willen; vielleicht geschah diese Lösung unter Beseitigung des unteren Säulentheiles
auch erst 1684, da kein baulicher Grund zu so ungleichmässiger Ausbildung gegen
die an der Westwand vorliegt.) Ueber einem mit einem Wulst zwischen Plättchen
gebildeten Halsglied (Trachelos) bildet ein tief gemeisselter Eierstab mit antikisirenden
Abschlussgliedern das Capitell der Säulen. (Neuerdings ist durch Bemalung des
glatten Capitell-Stückes eine Vermittelung zur Gothik herzustellen gesucht, s. unten.)
Die Scheidebögen sind spitzbogig und haben das Profil: ^ mit Kehlen in den
Schrägseiten; allein diese Kehlen sind viel tiefer ausgebuchtet, als es die Gothik
verlangt und verlaufen kurz nach dem Anfang durch Ausrundungen, ähnlich, wie
es damals an den Holzbalken als Verzierung üblich war. Die Decke (niedriger
als die einstigen Gewölbe angeordnet) ist eine durch Längs- und Quer-Balken in
Felder getheilte Holzdecke; sie wurde erst 1651 in dieser Weise vollendet. Der
Thurm erhielt 1662 über dem alten Theil ein schlechtes, in Bruchstein aufge-
mauertes, etwas zurückgesetztes Geschoss mit gewöhnlichen, unregelmässig' an-
geordneten Fenstern (einige dann zugemauert, andere durchgebrochen). Dasselbe
blieb auch (trotzdem schon Ernst der Fromme sich dagegen ausgesprochen haben
soll), als 1684 das Dach [unter Beseitigung eines Schindeldaches] erneuert wurde,
als achteckige Schweifkuppel mit Arcaden-Aufsatz und Kuppel, welche, hässlich und
zu niedrig, den Thurmbau wie die ganze Kirche an würdigem Aussehen beein-
trächtigen. 1684, in welchem Jahre die Kirche im Innern durch Johann Fabar aus
Schmalkalden geweisst wurde, sowie im 18. Jahrhundert fanden noch verschiedene,
zum Theil gebliebene Veränderungen statt. Von der Sacristei-Westwand wurde
eine grössere Rundbogen-Thür nach aussen durchgebrochen; dieselbe ist dann
aussen zugemauert, die innere Nische als Wandschrank verwerthet. In das west-
liche Chorjoch wurde an der Südseite [wohl statt einer älteren Thür] eine Flach-
bogen-Thür gebrochen, welche aussen durch eine Treppe mit steinernen, vorn bogig
ausgeschnittenen Wangen zugänglich ist. [Darüber wurde aussen ein Vorbau in
die Ecke zwischen Chor und Langhaus gelegt, welcher, später abgebrochen, noch
in Spuren sichtbar ist.] Im Langhaus ward an der Nordseite [in das 1. Joch eine
rechteckige Thür durchgebrochen, 1889 wieder zugemauert,] in das 5. Joch unten
Eisfeld, Stadtkirche.
Eisfeld. 18
Die Kirche wurde 1565 am Thurm, 1601 und nach Reparatur (um 1608) 1632
durch einen grossen Brand besonders an den Dächern und im Langhaus beschädigt.
Es erfolgte dank dem thatkräftigen Vorgehen des Superintendenten ein für die Zeiten
verhältnissmässig solider Wiederherstellungsbau und hierbei wohl die Weihe zur heil.
Dreifaltigkeit. Wir haben Kenntniss von den einzelnen Werkmeistern desselben;
Maurer war Hans Löffler von Oberwind, Zimmermann Hans Martersteig, Schreiner
Andreas und Jacob Burkart, Schlosser Jacob Otto. Steine zu den Schiffsäulen
wurden aus dem Steinbruch von Schwarzbach hergeholt. Es zeigt sich in in-
teressanter Weise an dem Bau der Wunsch des Architekten, sich den älteren
Formen anzupassen, und doch wieder der Formensinn der damaligen Zeit. Auf
Sockeln vom Profil der Plinthe (Stufe) mit kleiner Abwässerung (oberer Ab-
schrägung) und des Torus (Wulst), mit Plättchen darüber, in schwacher Kehlung
anfangend, steigt der glatt-runde Schaft der Säulen auf. Den Säulen entsprechen
an der Ost- und West-Wand Halbsäulen gleicher Bildung. Doch fangen die öst-
lichen Wandsäulen erst über der 1. Empore auf einer classicistisch mit Karnies etc.
gegliederten Console an. (Dies wohl um eines darunter befindlichen Bautheiles
willen; vielleicht geschah diese Lösung unter Beseitigung des unteren Säulentheiles
auch erst 1684, da kein baulicher Grund zu so ungleichmässiger Ausbildung gegen
die an der Westwand vorliegt.) Ueber einem mit einem Wulst zwischen Plättchen
gebildeten Halsglied (Trachelos) bildet ein tief gemeisselter Eierstab mit antikisirenden
Abschlussgliedern das Capitell der Säulen. (Neuerdings ist durch Bemalung des
glatten Capitell-Stückes eine Vermittelung zur Gothik herzustellen gesucht, s. unten.)
Die Scheidebögen sind spitzbogig und haben das Profil: ^ mit Kehlen in den
Schrägseiten; allein diese Kehlen sind viel tiefer ausgebuchtet, als es die Gothik
verlangt und verlaufen kurz nach dem Anfang durch Ausrundungen, ähnlich, wie
es damals an den Holzbalken als Verzierung üblich war. Die Decke (niedriger
als die einstigen Gewölbe angeordnet) ist eine durch Längs- und Quer-Balken in
Felder getheilte Holzdecke; sie wurde erst 1651 in dieser Weise vollendet. Der
Thurm erhielt 1662 über dem alten Theil ein schlechtes, in Bruchstein aufge-
mauertes, etwas zurückgesetztes Geschoss mit gewöhnlichen, unregelmässig' an-
geordneten Fenstern (einige dann zugemauert, andere durchgebrochen). Dasselbe
blieb auch (trotzdem schon Ernst der Fromme sich dagegen ausgesprochen haben
soll), als 1684 das Dach [unter Beseitigung eines Schindeldaches] erneuert wurde,
als achteckige Schweifkuppel mit Arcaden-Aufsatz und Kuppel, welche, hässlich und
zu niedrig, den Thurmbau wie die ganze Kirche an würdigem Aussehen beein-
trächtigen. 1684, in welchem Jahre die Kirche im Innern durch Johann Fabar aus
Schmalkalden geweisst wurde, sowie im 18. Jahrhundert fanden noch verschiedene,
zum Theil gebliebene Veränderungen statt. Von der Sacristei-Westwand wurde
eine grössere Rundbogen-Thür nach aussen durchgebrochen; dieselbe ist dann
aussen zugemauert, die innere Nische als Wandschrank verwerthet. In das west-
liche Chorjoch wurde an der Südseite [wohl statt einer älteren Thür] eine Flach-
bogen-Thür gebrochen, welche aussen durch eine Treppe mit steinernen, vorn bogig
ausgeschnittenen Wangen zugänglich ist. [Darüber wurde aussen ein Vorbau in
die Ecke zwischen Chor und Langhaus gelegt, welcher, später abgebrochen, noch
in Spuren sichtbar ist.] Im Langhaus ward an der Nordseite [in das 1. Joch eine
rechteckige Thür durchgebrochen, 1889 wieder zugemauert,] in das 5. Joch unten