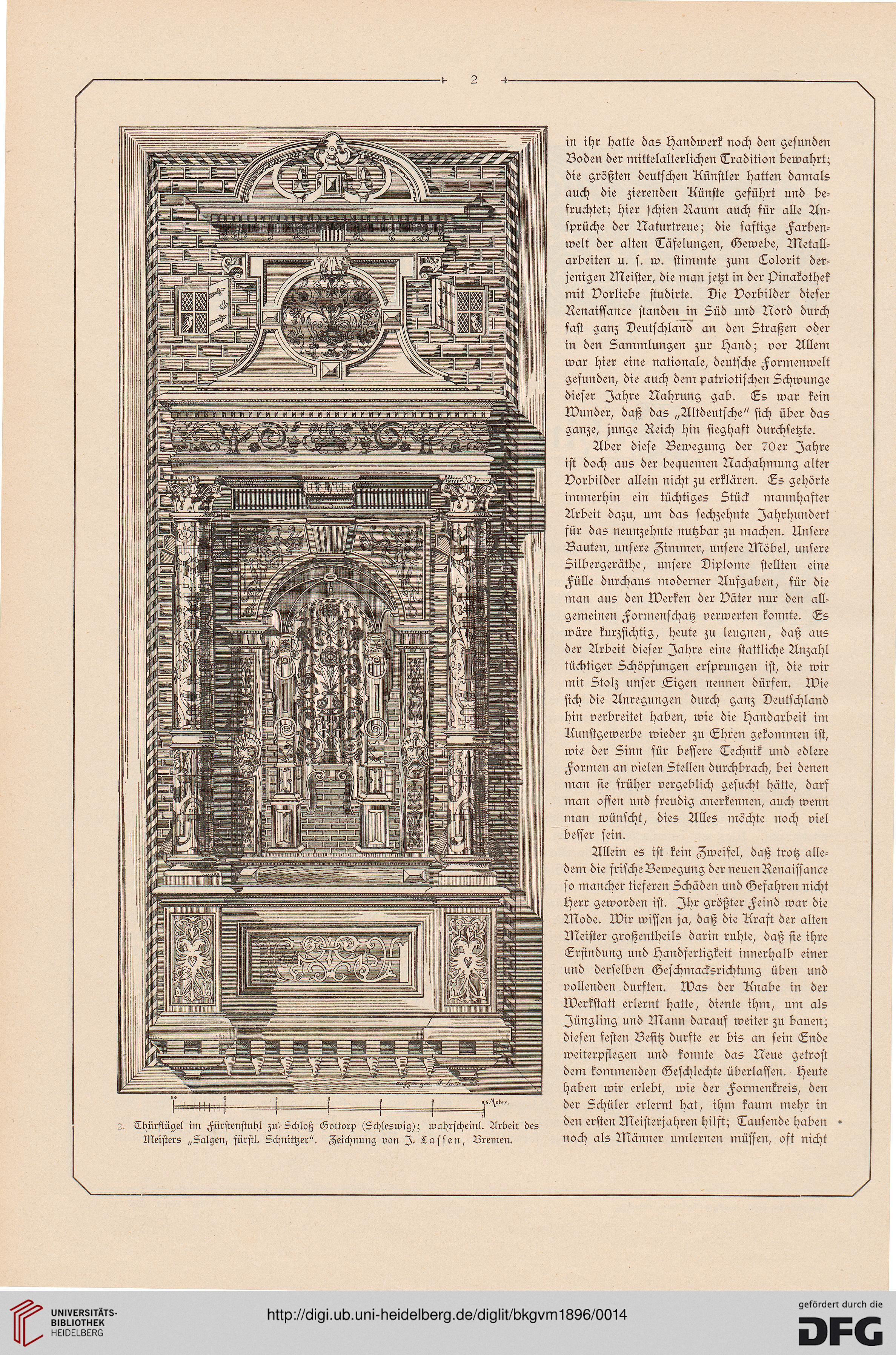r-
9
-*■
\
Thürflügel im Fürstenstuhl zu Schloß Gottorx (Schleswig); wahrscheinl. Arbeit des
Meisters „Salgen, fürstl. Schnittzer". Zeichnung von I. Lassen, Bremen.
in ihr hatte das Handwerk noch den gesunden
Boden der mittelalterlichen Tradition bewahrt;
die größten deutschen Aünstler hatten damals
auch die zierenden Aünste geführt und be-
fruchtet; hier schien Raum auch für alle An-
sprüche der Naturtreue; die saftige Farben-
welt der alten Täfelungen, Gewebe, Metall-
arbeiten u. f. w. stimmte zum Tolorit der-
jenigen Meister, die man jetzt in der Pinakothek
mit Vorliebe studirte. Die Vorbilder dieser
Renaissance standen in Süd und Nord durch
fast ganz Deutschland an den Straßen oder
in den Sammlungen zur bsand; vor Allem
war hier eine nationale, deutsche Formenwelt
gesunden, die auch dem patriotischen Schwünge
dieser Zahre Nahrung gab. (Es war kein
Wunder, daß das „Altdeutsche" sich über das
ganze, junge Reich hin sieghaft durchsetzte.
Aber diese Bewegung der 70er Jahre
ist doch aus der bequemen Nachahmung alter
Vorbilder allein nicht zu erklären. (Es gehörte
immerhin ein tüchtiges Stück mannhafter
Arbeit dazu, um das sechzehnte Jahrhundert
für das neunzehnte nutzbar zu machen. Unsere
Bauten, unsere Zimmer, unsere Möbel, unsere
Silbergeräthe, unsere Diplome stellten eine
Fülle durchaus moderner Aufgaben, für die
man aus den Werken der Väter nur den all-
gemeinen Formenschatz verwerten konnte. (Es
wäre kurzsichtig, heute zu leugnen, daß aus
der Arbeit dieser Jahre eine stattliche Anzahl
tüchtiger Schöpfungen ersprungen ist, die wir
mit Stolz unser Ligen nennen dürfen. Wie
sich die Anregungen durch ganz Deutschland
hin verbreitet haben, wie die Landarbeit im
Aunstgewerbe wieder zu Ehren gekommen ist,
wie der Sinn für bessere Technik und edlere
Formen an vielen Stellen durchbrach, bei denen
man sie früher vergeblich gesucht hätte, darf
man offen und freudig anerkennen, auch wenn
man wünscht, dies Alles möchte noch viel
besser sein.
Allein es ist kein Zweifel, daß trotz alle-
dem die frische Bewegung der neuen Renaissance
so mancher tieferen Schäden und Gefahren nicht
Herr geworden ist. Ihr größter Feind war die
Mode. Wir wissen ja, daß die Araft der alten
Meister großentheils darin ruhte, daß sie ihre
Erfindung und Handfertigkeit innerhalb einer
und derselben Geschmacksrichtung üben und
vollenden durften. Mas der Anabe in der
Werkstatt erlernt hatte, diente ihm, um als
Jüngling und Mann darauf weiter zu bauen;
diesen festen Besitz durfte er bis an sein Ende
weiterpflegen und konnte das Neue getrost
dem kommenden Geschlechts überlassen, bleute
haben wir erlebt, wie der Formenkreis, den
der Schüler erlernt hat, ihm kaum mehr in
den ersten Meisterjahren hilft; Tausende haben
noch als Männer umlernen müssen, oft nicht
9
-*■
\
Thürflügel im Fürstenstuhl zu Schloß Gottorx (Schleswig); wahrscheinl. Arbeit des
Meisters „Salgen, fürstl. Schnittzer". Zeichnung von I. Lassen, Bremen.
in ihr hatte das Handwerk noch den gesunden
Boden der mittelalterlichen Tradition bewahrt;
die größten deutschen Aünstler hatten damals
auch die zierenden Aünste geführt und be-
fruchtet; hier schien Raum auch für alle An-
sprüche der Naturtreue; die saftige Farben-
welt der alten Täfelungen, Gewebe, Metall-
arbeiten u. f. w. stimmte zum Tolorit der-
jenigen Meister, die man jetzt in der Pinakothek
mit Vorliebe studirte. Die Vorbilder dieser
Renaissance standen in Süd und Nord durch
fast ganz Deutschland an den Straßen oder
in den Sammlungen zur bsand; vor Allem
war hier eine nationale, deutsche Formenwelt
gesunden, die auch dem patriotischen Schwünge
dieser Zahre Nahrung gab. (Es war kein
Wunder, daß das „Altdeutsche" sich über das
ganze, junge Reich hin sieghaft durchsetzte.
Aber diese Bewegung der 70er Jahre
ist doch aus der bequemen Nachahmung alter
Vorbilder allein nicht zu erklären. (Es gehörte
immerhin ein tüchtiges Stück mannhafter
Arbeit dazu, um das sechzehnte Jahrhundert
für das neunzehnte nutzbar zu machen. Unsere
Bauten, unsere Zimmer, unsere Möbel, unsere
Silbergeräthe, unsere Diplome stellten eine
Fülle durchaus moderner Aufgaben, für die
man aus den Werken der Väter nur den all-
gemeinen Formenschatz verwerten konnte. (Es
wäre kurzsichtig, heute zu leugnen, daß aus
der Arbeit dieser Jahre eine stattliche Anzahl
tüchtiger Schöpfungen ersprungen ist, die wir
mit Stolz unser Ligen nennen dürfen. Wie
sich die Anregungen durch ganz Deutschland
hin verbreitet haben, wie die Landarbeit im
Aunstgewerbe wieder zu Ehren gekommen ist,
wie der Sinn für bessere Technik und edlere
Formen an vielen Stellen durchbrach, bei denen
man sie früher vergeblich gesucht hätte, darf
man offen und freudig anerkennen, auch wenn
man wünscht, dies Alles möchte noch viel
besser sein.
Allein es ist kein Zweifel, daß trotz alle-
dem die frische Bewegung der neuen Renaissance
so mancher tieferen Schäden und Gefahren nicht
Herr geworden ist. Ihr größter Feind war die
Mode. Wir wissen ja, daß die Araft der alten
Meister großentheils darin ruhte, daß sie ihre
Erfindung und Handfertigkeit innerhalb einer
und derselben Geschmacksrichtung üben und
vollenden durften. Mas der Anabe in der
Werkstatt erlernt hatte, diente ihm, um als
Jüngling und Mann darauf weiter zu bauen;
diesen festen Besitz durfte er bis an sein Ende
weiterpflegen und konnte das Neue getrost
dem kommenden Geschlechts überlassen, bleute
haben wir erlebt, wie der Formenkreis, den
der Schüler erlernt hat, ihm kaum mehr in
den ersten Meisterjahren hilft; Tausende haben
noch als Männer umlernen müssen, oft nicht