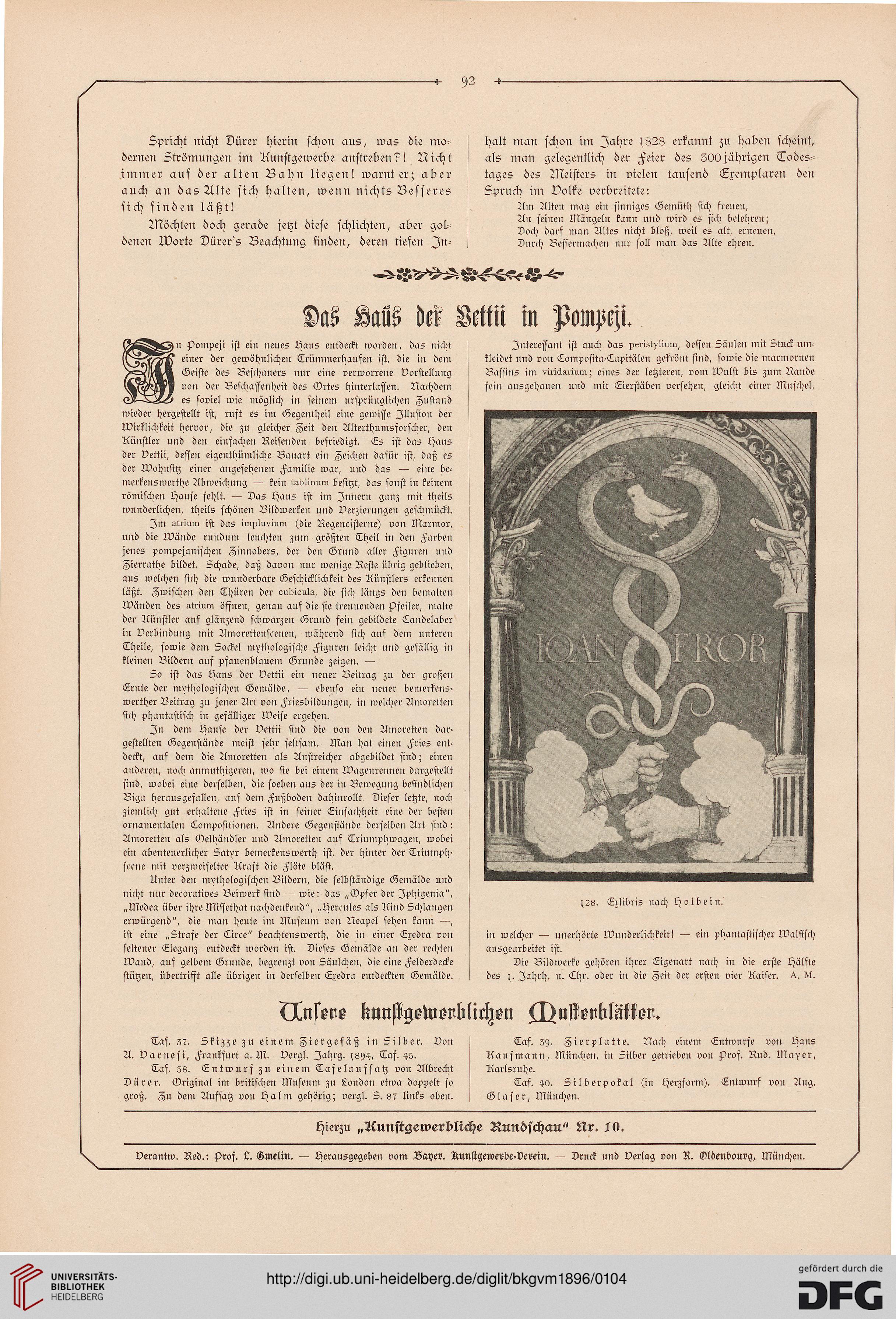/
■+
92 -t
Spricht nicht Dürer hierin schon aus, was die nro-
dernen Strömungen im Aunstgewerbe anstreben?! Nicht
immer auf der alten Bahn liegen! warnt er; aber
auch an das Alte sich halten, wenn nichts Besseres
sich finden läßt!
Möchten doch gerade jetzt diese schlichten, aber gol-
denen Worte Dürer's Beachtung finden, deren tiefen In-
halt man schon im Jahre (828 erkannt zu haben scheint,
als man gelegentlich der Feier des 300jährigen Todes-
tages des Meisters in vielen tausend Exemplaren den
Spruch im Volke verbreitete:
Am Alten mag ein sinniges Gemüth sich freuen,
An seinen Mängeln kann und wird es sich belehren;
Doch darf man Altes nicht bloß, weil es alt, erneuen,
Durch Bessermachen nur soll man das Alte ehren.
n§ Laus öcr Mit in Pompeji.
n Pompeji ist ein neues paus entdeckt worden, das nicht
einer der gewöhnlichen Trümmerhaufen ist, die in dem
Geiste des Beschauers nur eine verworrene Vorstellung
von der Beschaffenheit des Drtes hinterlassen. Nachdem
es soviel wie möglich in seinem ursprünglichen Zustand
wieder hergestellt ist, ruft es im Gegentheil eine gewisse Illusion der
Wirklichkeit hervor, die zu gleicher Zeit den Alterthumssorscher, den
Künstler und den einfachen Reisenden befriedigt. Ls ist das paus
der Vettii, dessen eigenthümliche Bauart ein Zeichen dafür ist, daß es
der Wohnsitz einer angesehenen Familie war, und das — eine bc-
merkenswerthe Abweichung — kein tablinum besitzt, das sonst in keinem
römischen Pause fehlt. — Das paus ist inr Innern ganz mit theils
wunderlichen, theils schönen Bildwerken und Verzierungen geschmückt.
Im atrium ist das impluvium (die Regeucisterne) von Marmor,
und die Wände rundum leuchten zum größten Theil in den Farben
jenes xompejanischen Zinnobers, der den Grund aller Figuren und
Zierrathe bildet. Schade, daß davon nur wenige Reste übrig geblieben,
aus welchen sich die wunderbare Geschicklichkeit des Künstlers erkennen
läßt. Zwischen den Thüren der cubicula, die sich längs den bemalten
Wänden des atrium öffnen, genau auf die sie trennenden Pfeiler, malte
der Künstler auf glänzend schwarzen Grund fein gebildete Eandelabcr
in Verbindung mit Amorettenscenen, während sich auf den: unteren
Theile, sowie dem Sockel mythologische Figuren leicht und gefällig iu
kleinen Bildern auf pfauenblauem Grunde zeigen. —
So ist das paus der vettii ein neuer Beitrag zu der großen
Ernte der mythologischen Gemälde, — ebenso ein neuer bemerkens-
werther Beitrag zu jener Art von Friesbildungen, in welcher Amoretten
sich phantastisch in gefälliger Weise ergehen.
In dem Pause der Vettii sind die von den Amoretten dar-
gestellten Gegenstände meist sehr seltsam. Man hat einen Fries ent-
deckt, auf dem die Amoretten als Anstreicher abgebildet sind; einen
anderen, noch anmuthigeren, wo sie bei einem Wagenrennen dargestellt
sind, wobei eine derselben, die soeben aus der in Bewegung befindlichen
Biga herausgefallen, auf dem Fußboden dahinrollt. Dieser letzte, noch
ziemlich gut erhaltene Fries ist in seiner Einfachheit eine der besten
ornamentalen Eompositionen. Andere Gegenstände derselben Art sind:
Amoretten als Gelhändler und Amoretten auf Triumphwagen, wobei
ein abenteuerlicher Satyr bemerkenswerth ist, der hinter der Triumph-
seene mit verzweifelter Kraft die Flöte bläst.
Unter den mythologischen Bildern, die selbständige Gemälde und
nicht nur decoratives Beiwerk sind — wie: das „Gpfer der Iphigenia",
„Medea über ihre Miffcthat nachdenkend", „pereules als Kind Schlangen
erwürgend", die man heute im Museum von Neapel sehen kann —,
ist eine „Strafe der Lirce" beachtenswerth, die in einer Exedra von
seltener Eleganz entdeckt worden ist. Dieses Gemälde an der rechten
Mand, auf gelbem Grunde, begrenzt von Säulchen, die eine Felderdecke
stützen, übertrifft alle übrigen in derselbe» Exedra entdeckten Gemälde.
Interessant ist auch das peristylium, dessen Säulen mit Stuck um-
kleidet und von Lomxosita-Lapitälen gekrönt sind, sowie die marmornen
Bassins im viridarium; eines der letzteren, vom Wulst bis zum Rande
fein ausgehauen und mit Eierstäben versehen, gleicht einer Muschel,
\28. Exlibris nach Polbein.
in welcher — unerhörte Wunderlichkeit! — ein phantastischer Walfisch
ausgearbeitet ist.
Die Bildwerke gehören ihrer Eigenart nach in die erste pälfte
des ;. Iahrh. n. Ehr. oder in die Zeit der ersten vier Kaiser. A. M.
Unsere kunstgewerblichen MusterblWer.
Taf. 37. Skizze zu einem Ziergesäß in Silber. von
A. Varnesi, Frankfurt a. M. Vergl. Iahrg. {894, Tas. 45.
Taf. 38. Entwurf zu einem Tafelaufsatz von Albrecht
Dürer. Griginal im britischen Museum zu London etwa doppelt so
groß. Zu dem Aufsatz von Palm gehörig; vergl. S. 87 links oben.
Taf. 39. Z i e r p l a t t e. Nach einein Entwürfe von pans
Kaufmann, München, in Silber getrieben von Prof. Rud. Mayer,
Karlsruhe.
Taf. 40. Silberpokal (in perzform). Entwurf von Aug.
Glaser, München.
hierzu „Kunstgewerbliche Rundschau" Nr. 10.
X
verantw. Red.: Pros. L. Gmelin. — perausgegeben vom Bayer. Nunftgewerbe-Verein. — Druck und Verlag von R. Dldenbourg, München.
■+
92 -t
Spricht nicht Dürer hierin schon aus, was die nro-
dernen Strömungen im Aunstgewerbe anstreben?! Nicht
immer auf der alten Bahn liegen! warnt er; aber
auch an das Alte sich halten, wenn nichts Besseres
sich finden läßt!
Möchten doch gerade jetzt diese schlichten, aber gol-
denen Worte Dürer's Beachtung finden, deren tiefen In-
halt man schon im Jahre (828 erkannt zu haben scheint,
als man gelegentlich der Feier des 300jährigen Todes-
tages des Meisters in vielen tausend Exemplaren den
Spruch im Volke verbreitete:
Am Alten mag ein sinniges Gemüth sich freuen,
An seinen Mängeln kann und wird es sich belehren;
Doch darf man Altes nicht bloß, weil es alt, erneuen,
Durch Bessermachen nur soll man das Alte ehren.
n§ Laus öcr Mit in Pompeji.
n Pompeji ist ein neues paus entdeckt worden, das nicht
einer der gewöhnlichen Trümmerhaufen ist, die in dem
Geiste des Beschauers nur eine verworrene Vorstellung
von der Beschaffenheit des Drtes hinterlassen. Nachdem
es soviel wie möglich in seinem ursprünglichen Zustand
wieder hergestellt ist, ruft es im Gegentheil eine gewisse Illusion der
Wirklichkeit hervor, die zu gleicher Zeit den Alterthumssorscher, den
Künstler und den einfachen Reisenden befriedigt. Ls ist das paus
der Vettii, dessen eigenthümliche Bauart ein Zeichen dafür ist, daß es
der Wohnsitz einer angesehenen Familie war, und das — eine bc-
merkenswerthe Abweichung — kein tablinum besitzt, das sonst in keinem
römischen Pause fehlt. — Das paus ist inr Innern ganz mit theils
wunderlichen, theils schönen Bildwerken und Verzierungen geschmückt.
Im atrium ist das impluvium (die Regeucisterne) von Marmor,
und die Wände rundum leuchten zum größten Theil in den Farben
jenes xompejanischen Zinnobers, der den Grund aller Figuren und
Zierrathe bildet. Schade, daß davon nur wenige Reste übrig geblieben,
aus welchen sich die wunderbare Geschicklichkeit des Künstlers erkennen
läßt. Zwischen den Thüren der cubicula, die sich längs den bemalten
Wänden des atrium öffnen, genau auf die sie trennenden Pfeiler, malte
der Künstler auf glänzend schwarzen Grund fein gebildete Eandelabcr
in Verbindung mit Amorettenscenen, während sich auf den: unteren
Theile, sowie dem Sockel mythologische Figuren leicht und gefällig iu
kleinen Bildern auf pfauenblauem Grunde zeigen. —
So ist das paus der vettii ein neuer Beitrag zu der großen
Ernte der mythologischen Gemälde, — ebenso ein neuer bemerkens-
werther Beitrag zu jener Art von Friesbildungen, in welcher Amoretten
sich phantastisch in gefälliger Weise ergehen.
In dem Pause der Vettii sind die von den Amoretten dar-
gestellten Gegenstände meist sehr seltsam. Man hat einen Fries ent-
deckt, auf dem die Amoretten als Anstreicher abgebildet sind; einen
anderen, noch anmuthigeren, wo sie bei einem Wagenrennen dargestellt
sind, wobei eine derselben, die soeben aus der in Bewegung befindlichen
Biga herausgefallen, auf dem Fußboden dahinrollt. Dieser letzte, noch
ziemlich gut erhaltene Fries ist in seiner Einfachheit eine der besten
ornamentalen Eompositionen. Andere Gegenstände derselben Art sind:
Amoretten als Gelhändler und Amoretten auf Triumphwagen, wobei
ein abenteuerlicher Satyr bemerkenswerth ist, der hinter der Triumph-
seene mit verzweifelter Kraft die Flöte bläst.
Unter den mythologischen Bildern, die selbständige Gemälde und
nicht nur decoratives Beiwerk sind — wie: das „Gpfer der Iphigenia",
„Medea über ihre Miffcthat nachdenkend", „pereules als Kind Schlangen
erwürgend", die man heute im Museum von Neapel sehen kann —,
ist eine „Strafe der Lirce" beachtenswerth, die in einer Exedra von
seltener Eleganz entdeckt worden ist. Dieses Gemälde an der rechten
Mand, auf gelbem Grunde, begrenzt von Säulchen, die eine Felderdecke
stützen, übertrifft alle übrigen in derselbe» Exedra entdeckten Gemälde.
Interessant ist auch das peristylium, dessen Säulen mit Stuck um-
kleidet und von Lomxosita-Lapitälen gekrönt sind, sowie die marmornen
Bassins im viridarium; eines der letzteren, vom Wulst bis zum Rande
fein ausgehauen und mit Eierstäben versehen, gleicht einer Muschel,
\28. Exlibris nach Polbein.
in welcher — unerhörte Wunderlichkeit! — ein phantastischer Walfisch
ausgearbeitet ist.
Die Bildwerke gehören ihrer Eigenart nach in die erste pälfte
des ;. Iahrh. n. Ehr. oder in die Zeit der ersten vier Kaiser. A. M.
Unsere kunstgewerblichen MusterblWer.
Taf. 37. Skizze zu einem Ziergesäß in Silber. von
A. Varnesi, Frankfurt a. M. Vergl. Iahrg. {894, Tas. 45.
Taf. 38. Entwurf zu einem Tafelaufsatz von Albrecht
Dürer. Griginal im britischen Museum zu London etwa doppelt so
groß. Zu dem Aufsatz von Palm gehörig; vergl. S. 87 links oben.
Taf. 39. Z i e r p l a t t e. Nach einein Entwürfe von pans
Kaufmann, München, in Silber getrieben von Prof. Rud. Mayer,
Karlsruhe.
Taf. 40. Silberpokal (in perzform). Entwurf von Aug.
Glaser, München.
hierzu „Kunstgewerbliche Rundschau" Nr. 10.
X
verantw. Red.: Pros. L. Gmelin. — perausgegeben vom Bayer. Nunftgewerbe-Verein. — Druck und Verlag von R. Dldenbourg, München.