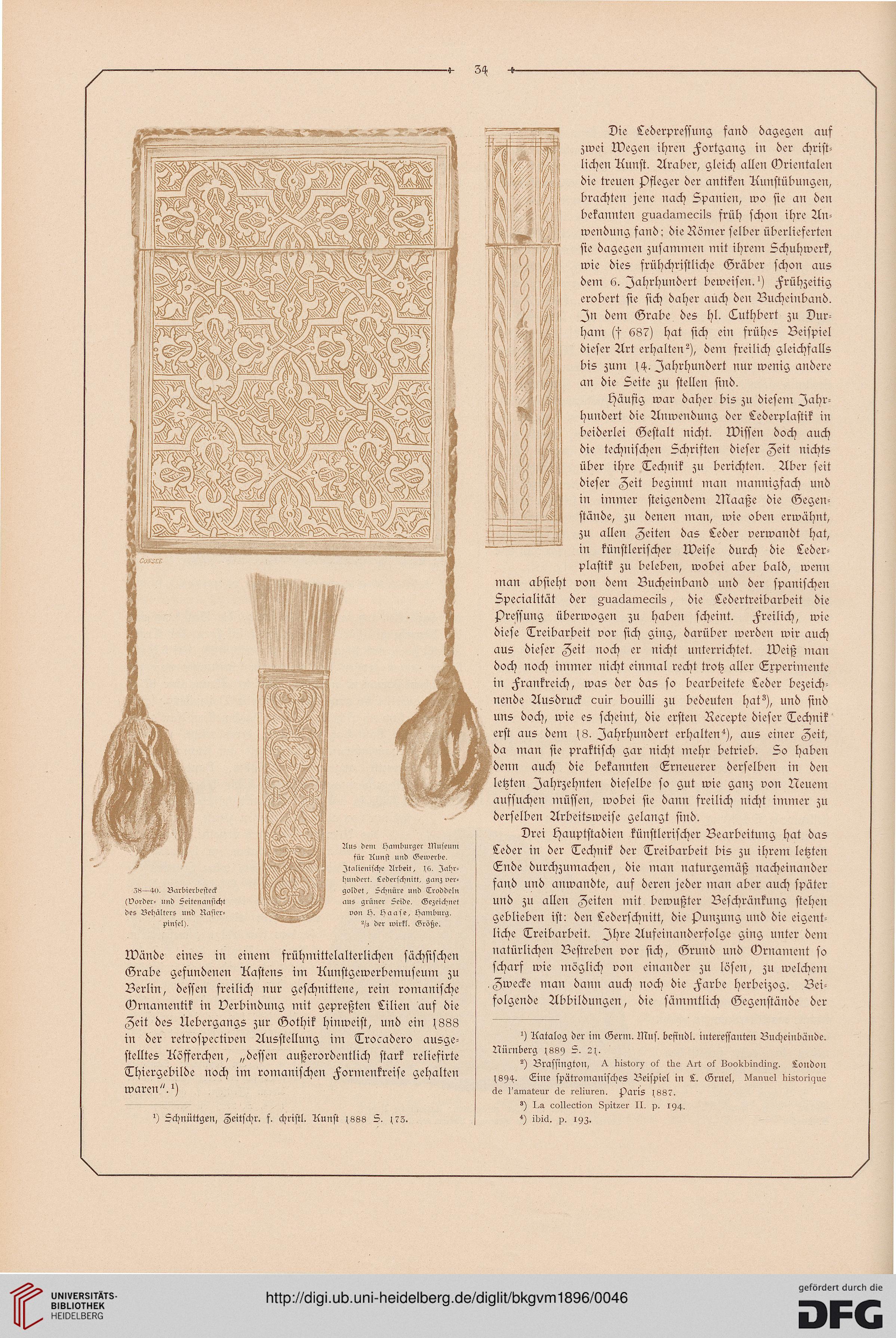3^ -+•
38—^0. Barbierbesteck
(vorder- und Seitenansicht
des Behälters und Rasier-
pinsel).
Aus dem Hamburger Museum
für Aunst und Gewerbe.
Italienische Arbeit, 1(6. Jahr-
hundert. Lederschnitt, ganz ver-
goldet , Schnüre und Troddeln
aus grüner Seide. Gezeichnet
von 6. Haase, Hamburg.
2/s der wirk!. Größe.
Wände eines in einem frühmittelalterlichen sächsischen
Grabe gefundenen Aastens im Aunstgewerbemuseum zu
Berlin, dessen freilich nur geschnittene, rein romanische
Ornamentik in Verbindung mit gepreßten Lilien auf die
Zeit des Üebergangs zur Gothik hinweist, und ein \888
in der retrospectiven Ausstellung im Trocadero ausge-
stelltes Aöfferchen, „dessen außerordentlich stark reliefirte
Thiergebilde noch in: romanischen Formenkreise gehalten
waren". Ü
b Schnüttgen, Jeitschr. f. christl. Aunst ^888 5. [75.
Die Lederpressung fand dagegen auf
zwei Wegen ihren Fortgang in der christ-
lichen Aunst. Araber, gleich allen Orientalen
die treuen Pfleger der antiken Aunstübungen,
brachten jene nach Spanien, wo sie an den
bekannten Auaclamecils früh schon ihre An-
wendung fand; die Römer selber überlieferten
sie dagegen zusammen mit ihrem Schuhwerk,
wie dies frühchristliche Gräber schon aus
dem 6. Jahrhundert beweisen, h Frühzeitig
erobert sie sich daher auch den Bucheinband.
In dem Grabe des hl. Luthbert zu Dur-
Ham (fl 687) hat sich ein frühes Beispiel
dieser Art erhalten^), dem freilich gleichfalls
bis zum sch Jahrhundert nur wenig andere
an die Seite zu stellen sind.
Häufig war daher bis zu diesem Jahr-
hundert die Anwendung der Lederplastik in
beiderlei Gestalt nicht. Wissen doch auch
die technischen Schriften dieser Zeit nichts
über ihre Technik zu berichten. Aber seit
dieser Zeit beginnt man mannigfach und
in immer steigendem Maaße die Gegen-
stände, zu denen inan, wie oben erwähnt,
zu allen Zeiten das Leder verwandt hat,
in künstlerischer Weise durch die Leder-
plastik zu beleben, wobei aber bald, wenn
man absieht von dem Bucheinband und der spanischen
Specialität der Znuckamecils, die Ledertreibarbeit die
Pressung überwogen zu haben scheint. Freilich, wie
diese Treibarbeit vor sich ging, darüber werden wir auch
aus dieser Zeit noch er nicht unterrichtet. Weiß man
doch noch immer nicht einnml recht trotz aller Experimente
in Frankreich, was der das so bearbeitete Leder bezeich-
nende Ausdruck cuir bouilli zu bedeuten hat ^), und find
uns doch, wie es scheint, die ersten Recepte dieser Technik
erst aus dem f8. Jahrhundert erhalten^), aus einer Zeit,
- da man sie praktisch gar nicht mehr betrieb. So haben
(denn auch die bekannten Erneuerer derselben in den
letzten Jahrzehnten dieselbe so gut wie ganz von Neuem
aufsuchen müssen, wobei sie dann freilich nicht immer zu
derselben Arbeitsweise gelangt sind.
Drei Hauptstadien künstlerischer Bearbeitung hat das
Leder in der Technik der Treibarbeit bis zu ihrem letzten
Ende durchzumachen, die inan naturgemäß nacheinander
fand und anwandte, auf deren jeder man aber auch später
und zu allen Zeiten mit bewußter Beschränkung stehen
geblieben ist: den Lederschnitt, die Punzung und die eigent-
liche Treibarbeit. Ihre Aufeinanderfolge ging unter dem
natürlichen Bestreben vor sich, Grund und Ornament so
scharf wie möglich von einander zu lösen, zu welchem
. Zwecke man dann auch noch die Farbe herbeizog. Bei-
folgende Abbildungen, die sämmtlich Gegenstände der * 2 * 4
1) Katalog der im Germ. Mus. befind!, interessanten Bucheinbände.
Nürnberg :88J S. 2\.
2) Braffrngton, A history of the Art of Bookbinding. London
;(894. Eine spätromanisches Beispiel in L. Gruel, Manuel historique
de 1’amateur de reliuren. Paris 1(887.
8) La Collection Spitzer II. p. 194.
4) ibid. p. 193.
/
38—^0. Barbierbesteck
(vorder- und Seitenansicht
des Behälters und Rasier-
pinsel).
Aus dem Hamburger Museum
für Aunst und Gewerbe.
Italienische Arbeit, 1(6. Jahr-
hundert. Lederschnitt, ganz ver-
goldet , Schnüre und Troddeln
aus grüner Seide. Gezeichnet
von 6. Haase, Hamburg.
2/s der wirk!. Größe.
Wände eines in einem frühmittelalterlichen sächsischen
Grabe gefundenen Aastens im Aunstgewerbemuseum zu
Berlin, dessen freilich nur geschnittene, rein romanische
Ornamentik in Verbindung mit gepreßten Lilien auf die
Zeit des Üebergangs zur Gothik hinweist, und ein \888
in der retrospectiven Ausstellung im Trocadero ausge-
stelltes Aöfferchen, „dessen außerordentlich stark reliefirte
Thiergebilde noch in: romanischen Formenkreise gehalten
waren". Ü
b Schnüttgen, Jeitschr. f. christl. Aunst ^888 5. [75.
Die Lederpressung fand dagegen auf
zwei Wegen ihren Fortgang in der christ-
lichen Aunst. Araber, gleich allen Orientalen
die treuen Pfleger der antiken Aunstübungen,
brachten jene nach Spanien, wo sie an den
bekannten Auaclamecils früh schon ihre An-
wendung fand; die Römer selber überlieferten
sie dagegen zusammen mit ihrem Schuhwerk,
wie dies frühchristliche Gräber schon aus
dem 6. Jahrhundert beweisen, h Frühzeitig
erobert sie sich daher auch den Bucheinband.
In dem Grabe des hl. Luthbert zu Dur-
Ham (fl 687) hat sich ein frühes Beispiel
dieser Art erhalten^), dem freilich gleichfalls
bis zum sch Jahrhundert nur wenig andere
an die Seite zu stellen sind.
Häufig war daher bis zu diesem Jahr-
hundert die Anwendung der Lederplastik in
beiderlei Gestalt nicht. Wissen doch auch
die technischen Schriften dieser Zeit nichts
über ihre Technik zu berichten. Aber seit
dieser Zeit beginnt man mannigfach und
in immer steigendem Maaße die Gegen-
stände, zu denen inan, wie oben erwähnt,
zu allen Zeiten das Leder verwandt hat,
in künstlerischer Weise durch die Leder-
plastik zu beleben, wobei aber bald, wenn
man absieht von dem Bucheinband und der spanischen
Specialität der Znuckamecils, die Ledertreibarbeit die
Pressung überwogen zu haben scheint. Freilich, wie
diese Treibarbeit vor sich ging, darüber werden wir auch
aus dieser Zeit noch er nicht unterrichtet. Weiß man
doch noch immer nicht einnml recht trotz aller Experimente
in Frankreich, was der das so bearbeitete Leder bezeich-
nende Ausdruck cuir bouilli zu bedeuten hat ^), und find
uns doch, wie es scheint, die ersten Recepte dieser Technik
erst aus dem f8. Jahrhundert erhalten^), aus einer Zeit,
- da man sie praktisch gar nicht mehr betrieb. So haben
(denn auch die bekannten Erneuerer derselben in den
letzten Jahrzehnten dieselbe so gut wie ganz von Neuem
aufsuchen müssen, wobei sie dann freilich nicht immer zu
derselben Arbeitsweise gelangt sind.
Drei Hauptstadien künstlerischer Bearbeitung hat das
Leder in der Technik der Treibarbeit bis zu ihrem letzten
Ende durchzumachen, die inan naturgemäß nacheinander
fand und anwandte, auf deren jeder man aber auch später
und zu allen Zeiten mit bewußter Beschränkung stehen
geblieben ist: den Lederschnitt, die Punzung und die eigent-
liche Treibarbeit. Ihre Aufeinanderfolge ging unter dem
natürlichen Bestreben vor sich, Grund und Ornament so
scharf wie möglich von einander zu lösen, zu welchem
. Zwecke man dann auch noch die Farbe herbeizog. Bei-
folgende Abbildungen, die sämmtlich Gegenstände der * 2 * 4
1) Katalog der im Germ. Mus. befind!, interessanten Bucheinbände.
Nürnberg :88J S. 2\.
2) Braffrngton, A history of the Art of Bookbinding. London
;(894. Eine spätromanisches Beispiel in L. Gruel, Manuel historique
de 1’amateur de reliuren. Paris 1(887.
8) La Collection Spitzer II. p. 194.
4) ibid. p. 193.
/