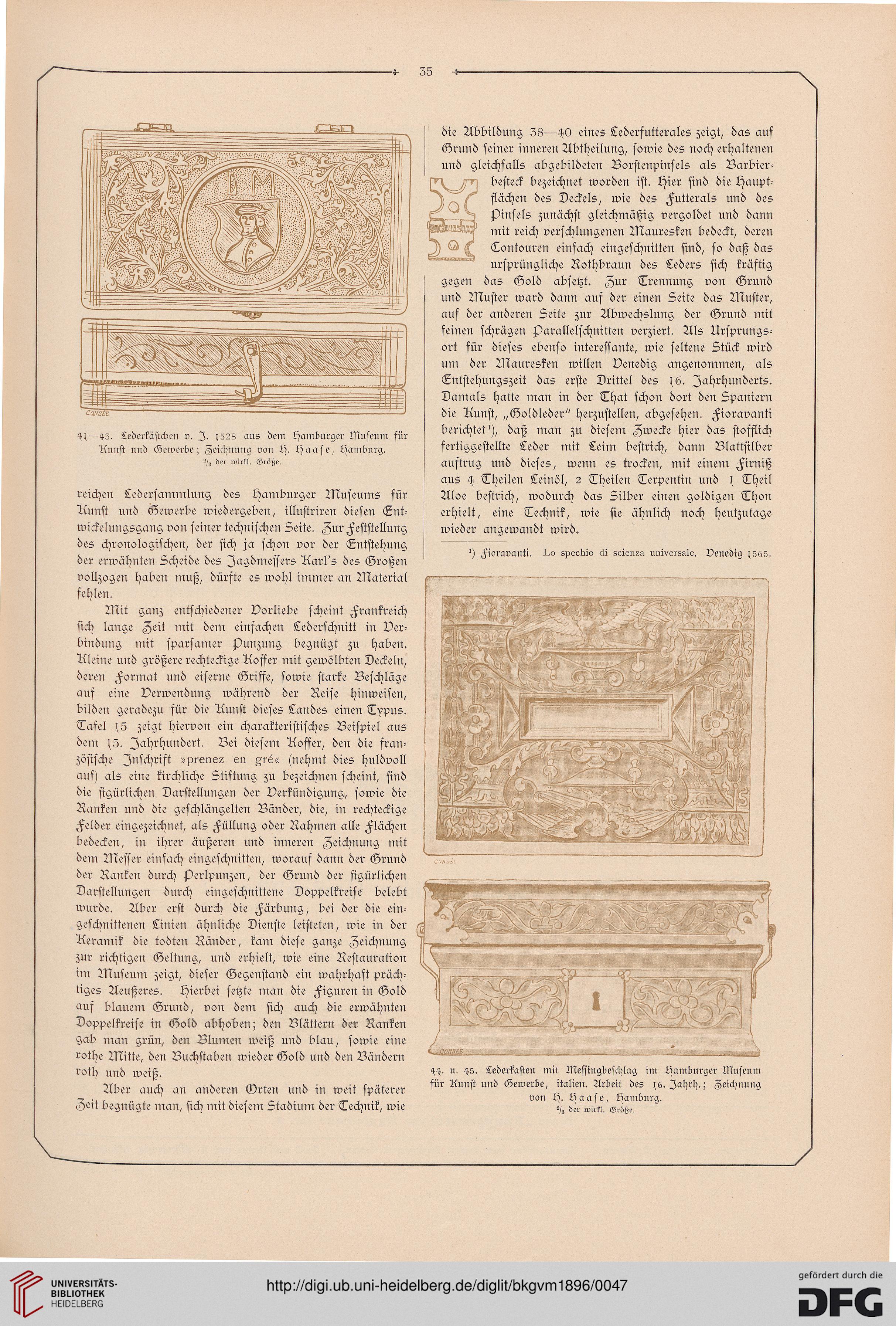55
4 (—43. Ledcrkästchen v. ~S. 1528 aus dem Hamburger Museum für
Kunst und Gewerbe; Zeichnung von H. Haase, Hamburg.
der wirkl. Größe.
reichen Ledersammlung des Hamburger Museums für
Uunst und Gewerbe wiedergeben, illustriren diesen Tnt-
wickelungsgang von seiner technischen Seite. Zur Feststellung
des chronologischen, der sich ja schon vor der Entstehung
der erwähnten Scheide des Jagdmessers Uarl's des Großen
vollzogen haben muß, dürfte es wohl immer an Material
fehlen.
Mit ganz entschiedener Vorliebe scheint Frankreich
sich lange Zeit mit dem einfachen Lederschnitt in Ver-
bindung mit sparsamer Punzung begnügt zu haben.
Uleine und größere rechteckige Uoffer mit gewölbten Deckeln,
deren Forniat und eiserne Griffe, sowie starke Beschläge
auf eine Verwendung während der Reise Hinweisen,
bilden geradezu für die Uunst dieses Landes einen T^pus.
Tafel s5 zeigt hiervon ein charakteristisches Beispiel aus
dem s5. Jahrhundert. Bei diesem Uoffer, den die fran-
zösische Inschrift »prenez en gre« (nehmt dies huldvoll
auf) als eine kirchliche Stiftung zu bezeichnen scheint, sind
die figürlichen Darstellungen der Verkündigung, sowie die
Ranken und die geschlängelten Bänder, die, in rechteckige
Felder eingezeichnet, als Füllung oder Rahmen alle Flächen
bedecken, in ihrer äußeren und inneren Zeichnung mit
dem Messer einfach eingefchnitten, worauf dann der Grund
der Ranken durch Perlpunzen, der Grund der figürlichen
Darstellungen durch eingeschnittene Doppelkreise belebt
wurde. Aber erst durch die Färbung, bei der die ein-
geschnittenen Linien ähnliche Dienste leisteten, wie in der
Ueramik die todten Ränder, kam diese ganze Zeichnung
zur richtigen Geltung, und erhielt, wie eine Restauration
im Museum zeigt, dieser Gegenstand ein wahrhaft präch-
tiges Aeußeres. pierbei setzte man die Figuren in Gold
auf blauem Grund, von dem sich auch die erwähnten
Doppelkreise in Gold abhoben; den Blättern der Ranken
gab man grün, den Blumen weiß und blau, sowie eine
rothe Mitte, den Buchstaben wieder Gold und den Bändern
roth und weiß.
Aber auch an anderen Orten und in weit späterer
Zeit begnügte man, sich mit diesem Stadium der Technik, wie
die Abbildung 58—^0 eines Lederfutterales zeigt, das auf
Grund feiner inneren Abtheilung, sowie des noch erhaltenen
und gleichfalls abgebildeten Borstenpinsels als Barbier-
Ifi yr;-) besteck bezeichnet worden ist. Pier sind die Paupt-
j r flächen des Deckels, wie des Futterals und des
Pinsels zunächst gleichmäßig vergoldet und dann
p“2 mit reich verschlungenen Mauresken bedeckt, deren
P Tontouren einfach eingeschnitten sind, so daß das
ursprüngliche Rothbraun des Leders sich kräftig
gegen das Gold abfetzt. Zur Trennung von Grund
und Muster ward dann auf der einen Seite das Muster,
auf der anderen Seite zur Abwechslung der Grund mit
feinen schrägen Parallelschnitten verziert. Als Ursprungs-
ort für dieses ebenso interessante, wie seltene Stück wird
mit der Mauresken willen Venedig angenommen, als
Tntstehungszeit das erste Drittel des s6. Jahrhunderts.
Damals hatte man in der Thal schon dort den Spaniern
die Uunst, „Goldleder" herzustellen, abgesehen. Fioravanti
berichtet'), daß man zu diesem Zwecke hier das stofflich
fertiggestellte Leder mit Leint bestrich, dann Blattsilber
austrug und dieses, wenn es trocken, mit einem Firniß
aus ^ Theilen Leinöl, 2 Theilen Terpentin und s Theil
Aloe bestrich, wodurch das Silber einen goldigen Thon
erhielt, eine Technik, wie sie ähnlich noch heutzutage
wieder angewandt wird.
') Fioravanti. Ko spechio di scienza universale. Venedig (565.
44. u. 45. Lederkasten mit Messingbeschlag im Hamburger Museum
für Kunst und Gewerbe, italicn. Arbeit des (6. Jahrh.; Zeichnung
von ff- Haase, Hamburg.
2/g der wirkl. Größe.
X
X
4 (—43. Ledcrkästchen v. ~S. 1528 aus dem Hamburger Museum für
Kunst und Gewerbe; Zeichnung von H. Haase, Hamburg.
der wirkl. Größe.
reichen Ledersammlung des Hamburger Museums für
Uunst und Gewerbe wiedergeben, illustriren diesen Tnt-
wickelungsgang von seiner technischen Seite. Zur Feststellung
des chronologischen, der sich ja schon vor der Entstehung
der erwähnten Scheide des Jagdmessers Uarl's des Großen
vollzogen haben muß, dürfte es wohl immer an Material
fehlen.
Mit ganz entschiedener Vorliebe scheint Frankreich
sich lange Zeit mit dem einfachen Lederschnitt in Ver-
bindung mit sparsamer Punzung begnügt zu haben.
Uleine und größere rechteckige Uoffer mit gewölbten Deckeln,
deren Forniat und eiserne Griffe, sowie starke Beschläge
auf eine Verwendung während der Reise Hinweisen,
bilden geradezu für die Uunst dieses Landes einen T^pus.
Tafel s5 zeigt hiervon ein charakteristisches Beispiel aus
dem s5. Jahrhundert. Bei diesem Uoffer, den die fran-
zösische Inschrift »prenez en gre« (nehmt dies huldvoll
auf) als eine kirchliche Stiftung zu bezeichnen scheint, sind
die figürlichen Darstellungen der Verkündigung, sowie die
Ranken und die geschlängelten Bänder, die, in rechteckige
Felder eingezeichnet, als Füllung oder Rahmen alle Flächen
bedecken, in ihrer äußeren und inneren Zeichnung mit
dem Messer einfach eingefchnitten, worauf dann der Grund
der Ranken durch Perlpunzen, der Grund der figürlichen
Darstellungen durch eingeschnittene Doppelkreise belebt
wurde. Aber erst durch die Färbung, bei der die ein-
geschnittenen Linien ähnliche Dienste leisteten, wie in der
Ueramik die todten Ränder, kam diese ganze Zeichnung
zur richtigen Geltung, und erhielt, wie eine Restauration
im Museum zeigt, dieser Gegenstand ein wahrhaft präch-
tiges Aeußeres. pierbei setzte man die Figuren in Gold
auf blauem Grund, von dem sich auch die erwähnten
Doppelkreise in Gold abhoben; den Blättern der Ranken
gab man grün, den Blumen weiß und blau, sowie eine
rothe Mitte, den Buchstaben wieder Gold und den Bändern
roth und weiß.
Aber auch an anderen Orten und in weit späterer
Zeit begnügte man, sich mit diesem Stadium der Technik, wie
die Abbildung 58—^0 eines Lederfutterales zeigt, das auf
Grund feiner inneren Abtheilung, sowie des noch erhaltenen
und gleichfalls abgebildeten Borstenpinsels als Barbier-
Ifi yr;-) besteck bezeichnet worden ist. Pier sind die Paupt-
j r flächen des Deckels, wie des Futterals und des
Pinsels zunächst gleichmäßig vergoldet und dann
p“2 mit reich verschlungenen Mauresken bedeckt, deren
P Tontouren einfach eingeschnitten sind, so daß das
ursprüngliche Rothbraun des Leders sich kräftig
gegen das Gold abfetzt. Zur Trennung von Grund
und Muster ward dann auf der einen Seite das Muster,
auf der anderen Seite zur Abwechslung der Grund mit
feinen schrägen Parallelschnitten verziert. Als Ursprungs-
ort für dieses ebenso interessante, wie seltene Stück wird
mit der Mauresken willen Venedig angenommen, als
Tntstehungszeit das erste Drittel des s6. Jahrhunderts.
Damals hatte man in der Thal schon dort den Spaniern
die Uunst, „Goldleder" herzustellen, abgesehen. Fioravanti
berichtet'), daß man zu diesem Zwecke hier das stofflich
fertiggestellte Leder mit Leint bestrich, dann Blattsilber
austrug und dieses, wenn es trocken, mit einem Firniß
aus ^ Theilen Leinöl, 2 Theilen Terpentin und s Theil
Aloe bestrich, wodurch das Silber einen goldigen Thon
erhielt, eine Technik, wie sie ähnlich noch heutzutage
wieder angewandt wird.
') Fioravanti. Ko spechio di scienza universale. Venedig (565.
44. u. 45. Lederkasten mit Messingbeschlag im Hamburger Museum
für Kunst und Gewerbe, italicn. Arbeit des (6. Jahrh.; Zeichnung
von ff- Haase, Hamburg.
2/g der wirkl. Größe.
X
X