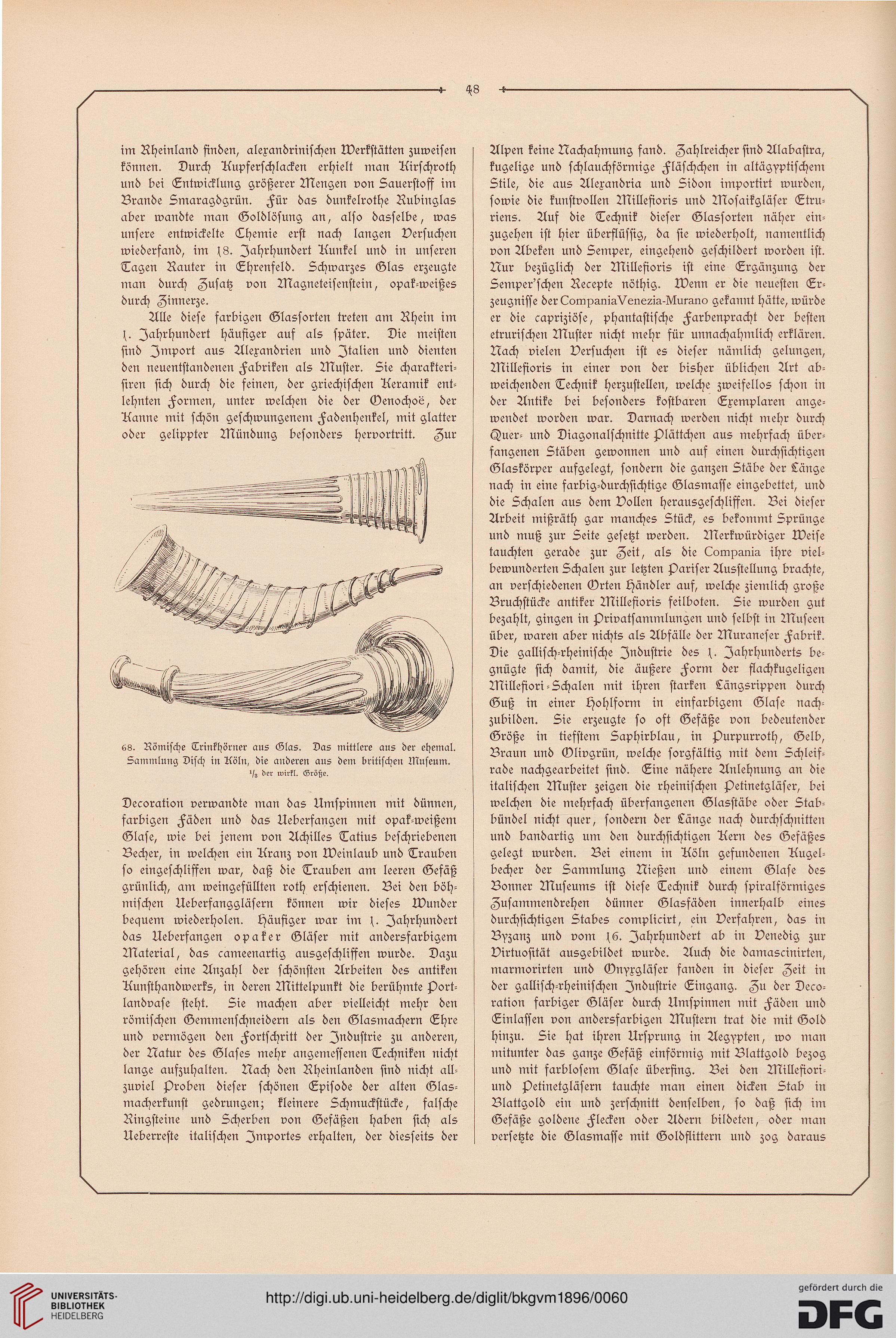/
■4- ^8 -I
im Rheinland finden, alexandrinischen Werkstätten zuweisen
können. Durch Rupferschlacken erhielt man Rirschroth
und bei Entwicklung größerer Mengen von Sauerstoff im
Brande Smaragdgrün. Für das dunkelrothe Rubinglas
aber wandte man Goldlösung an, also dasselbe, was
unsere entwickelte Therme erst nach langen Versuchen
wiederfand, im \8. Jahrhundert Runkel und in unseren
Tagen Rauter in Ehrenseld. Schwarzes Glas erzeugte
man durch Zusatz von Magneteisenstein, opak-weißes
durch Zinnerze.
Alle diese farbigen Glassorten treten am Rhein im
s. Jahrhundert häufiger auf als später. Die meisten
sind Import aus Alexandrien und Italien und dienten
den neuentstandenen Fabriken als Muster. Sie charakteri-
siren sich durch die feinen, der griechischen Reramik ent-
lehnten Formen, unter welchen die der Oenochoe, der
Ranne mit schön geschwungenein Fadenhenkel, mit glatter
oder getippter Mündung besonders hervortritt. Zur
68. Römische Trinkhörner aus Glas. Das mittlere ans der ehemal.
Sammlung Disch in Köln, die anderen aus dem britischen Museum.
Vs der wirkl. Größe.
Decoration verwandte man das Umspinnen init dünnen,
farbigen Fäden und das Ueberfangen mit opak-weißem
Glase, wie bei jenem von Achilles Tatius beschriebenen
Becher, in welchen ein Rranz von Weinlaub und Trauben
so eingeschliffen war, daß die Trauben am leeren Gefäß
grünlich, ani weingefüllten roth erschienen. Bei den böh-
mischen Ueberfanggläsern können wir dieses Wunder
bequem wiederholen, Häufiger war im Jahrhundert
das Ueberfangen opaker Gläser mit andersfarbigem
Material, das cameenartig ausgeschliffen wurde. Dazu
gehören eine Anzahl der schönsten Arbeiten des antiken
Runsthandwerks, in deren Mittelpunkt die berühurte Port-
landvase steht. Sie machen aber vielleicht mehr den
römischen Gemmenschneidern als den Glasurachern Ehre
und vermögen den Fortschritt der Industrie zu anderen,
der Natur des Glases mehr angemessenen Techniken nicht
lange aufzuhalten. Nach den Rheinlanden sind nicht all-
zuviel Proben dieser schönen Episode der alten Glas-
inacherkunst gedrungen; kleinere Schmuckstücke, falsche
Ringsteine und Scherben von Gefäßen haben sich als
Ueberreste italischen Importes erhalten, der diesseits der
Alpen keine Nachahmung fand. Zahlreicher sind Alabastra,
kugelige und schlauchförmige Fläschchen in altägyptischem
Stile, die aus Alexandria und Sidon importirt wurden,
sowie die kunstvollen Millefioris und Mosaikgläser Etru-
riens. Auf die Technik dieser Glassorten näher ein-
zugehen ist hier überflüssig, da sie wiederholt, namentlich
von Abeken und Semper, eingehend geschildert worden ist.
Nur bezüglich der Millefioris ist eine Ergänzung der
Semper'schen Recepte nöthig. Wenn er die neuesten Er-
zeugnisse der LompLniuVeneAu-Nurnuo gekannt hätte, würde
er die capriziöse, phantastische Farbenpracht der besten
etrurischen Muster nicht mehr für unnachahmlich erklären.
Nach vielen Versuchen ist es dieser nämlich gelungen,
Millefioris in einer von der bisher üblichen Art ab-
weichenden Technik herzustellen, welche zweifellos schon in
der Antike bei besonders kostbaren Exemplaren ange-
wendet worden war. Darnach werden nicht mehr durch
^uer- und Diagonalschnitte Plättchen aus mehrfach über-
fangenen Stäben gewonnen und auf einen durchsichtigen
Glaskörper aufgelegt, sondern die ganzen Stäbe der Länge
nach in eine farbig-durchsichtige Glasmasse eingebettet, und
die Schalen aus dem Vollen herausgeschliffen. Bei dieser
Arbeit mißräth gar manches Stück, es bekommt Sprünge
und muß zur Seite gesetzt werden. Merkwürdiger Weise
tauchten gerade zur Zeit, als die Compania ihre viel-
bewunderten Schalen zur letzten pariser Ausstellung brachte,
an verschiedenen Orten Händler auf, welche ziemlich große
Bruchstücke antiker Millefioris seilboten. Sie wurden gut
bezahlt, gingen in Privatsammlungen und selbst in Museen
über, waren aber nichts als Abfälle der Muranefer Fabrik.
Die gallisch-rheinische Industrie des Jahrhunderts be-
gnügte sich damit, die äußere Forin der flachkugeligen
Millefiori-Schalen mit ihren starken Längsrippen durch
Guß in einer Hohlform in einfarbigem Glase nach-
zubilden. Sie erzeugte so oft Gefäße von bedeutender
Größe in tiefstem Saphirblau, in Purpurroth, Gelb,
Braun und Olivgrün, welche sorgfältig mit dem Schleif-
rade nachgearbeitet find. Eine nähere Anlehnung an die
italischen Muster zeigen die rheinischen petinetgläser, bei
welchen die mehrfach überfangenen Glasstäbe oder Stab-
bündel nicht quer, sondern der Länge nach durchschnitten
und bandartig um den durchsichtigen Rern des Gefäßes
gelegt wurden. Bei einem in Röln gefundenen Rugel-
becher der Sammlung Nießen und einem Glase des
Bonner Museums ist diese Technik durch spiralförmiges
Zusammendrehen dünner Glasfäden innerhalb eines
durchsichtigen Stabes complicirt, ein Verfahren, das in
Byzanz und vom \6. Jahrhundert ab in Venedig zur
Virtuosität ausgebildet wurde. Auch die damascinirten,
marmorirten und Gnyxgläser fanden in dieser Zeit in
der gallisch-rheinischen Industrie Eingang. Zu der Deco-
ration farbiger Gläser durch Umspinnen mit Fäden und
Einlassen von andersfarbigen Mustern trat die mit Gold
hinzu. Sie hat ihren Ursprung in Aegypten, wo man
mitunter das ganze Gefäß einförniig mit Blattgold bezog
und mit farblosem Glase überfing. Bei den Millefiori-
und petinetgläsern tauchte man einen dicken Stab in
Blattgold ein und zerschnitt denselben, so daß sich im
Gefäße goldene Flecken oder Adern bildeten, oder man
versetzte die Glasmasse mit Goldflittern und zog daraus
X
■4- ^8 -I
im Rheinland finden, alexandrinischen Werkstätten zuweisen
können. Durch Rupferschlacken erhielt man Rirschroth
und bei Entwicklung größerer Mengen von Sauerstoff im
Brande Smaragdgrün. Für das dunkelrothe Rubinglas
aber wandte man Goldlösung an, also dasselbe, was
unsere entwickelte Therme erst nach langen Versuchen
wiederfand, im \8. Jahrhundert Runkel und in unseren
Tagen Rauter in Ehrenseld. Schwarzes Glas erzeugte
man durch Zusatz von Magneteisenstein, opak-weißes
durch Zinnerze.
Alle diese farbigen Glassorten treten am Rhein im
s. Jahrhundert häufiger auf als später. Die meisten
sind Import aus Alexandrien und Italien und dienten
den neuentstandenen Fabriken als Muster. Sie charakteri-
siren sich durch die feinen, der griechischen Reramik ent-
lehnten Formen, unter welchen die der Oenochoe, der
Ranne mit schön geschwungenein Fadenhenkel, mit glatter
oder getippter Mündung besonders hervortritt. Zur
68. Römische Trinkhörner aus Glas. Das mittlere ans der ehemal.
Sammlung Disch in Köln, die anderen aus dem britischen Museum.
Vs der wirkl. Größe.
Decoration verwandte man das Umspinnen init dünnen,
farbigen Fäden und das Ueberfangen mit opak-weißem
Glase, wie bei jenem von Achilles Tatius beschriebenen
Becher, in welchen ein Rranz von Weinlaub und Trauben
so eingeschliffen war, daß die Trauben am leeren Gefäß
grünlich, ani weingefüllten roth erschienen. Bei den böh-
mischen Ueberfanggläsern können wir dieses Wunder
bequem wiederholen, Häufiger war im Jahrhundert
das Ueberfangen opaker Gläser mit andersfarbigem
Material, das cameenartig ausgeschliffen wurde. Dazu
gehören eine Anzahl der schönsten Arbeiten des antiken
Runsthandwerks, in deren Mittelpunkt die berühurte Port-
landvase steht. Sie machen aber vielleicht mehr den
römischen Gemmenschneidern als den Glasurachern Ehre
und vermögen den Fortschritt der Industrie zu anderen,
der Natur des Glases mehr angemessenen Techniken nicht
lange aufzuhalten. Nach den Rheinlanden sind nicht all-
zuviel Proben dieser schönen Episode der alten Glas-
inacherkunst gedrungen; kleinere Schmuckstücke, falsche
Ringsteine und Scherben von Gefäßen haben sich als
Ueberreste italischen Importes erhalten, der diesseits der
Alpen keine Nachahmung fand. Zahlreicher sind Alabastra,
kugelige und schlauchförmige Fläschchen in altägyptischem
Stile, die aus Alexandria und Sidon importirt wurden,
sowie die kunstvollen Millefioris und Mosaikgläser Etru-
riens. Auf die Technik dieser Glassorten näher ein-
zugehen ist hier überflüssig, da sie wiederholt, namentlich
von Abeken und Semper, eingehend geschildert worden ist.
Nur bezüglich der Millefioris ist eine Ergänzung der
Semper'schen Recepte nöthig. Wenn er die neuesten Er-
zeugnisse der LompLniuVeneAu-Nurnuo gekannt hätte, würde
er die capriziöse, phantastische Farbenpracht der besten
etrurischen Muster nicht mehr für unnachahmlich erklären.
Nach vielen Versuchen ist es dieser nämlich gelungen,
Millefioris in einer von der bisher üblichen Art ab-
weichenden Technik herzustellen, welche zweifellos schon in
der Antike bei besonders kostbaren Exemplaren ange-
wendet worden war. Darnach werden nicht mehr durch
^uer- und Diagonalschnitte Plättchen aus mehrfach über-
fangenen Stäben gewonnen und auf einen durchsichtigen
Glaskörper aufgelegt, sondern die ganzen Stäbe der Länge
nach in eine farbig-durchsichtige Glasmasse eingebettet, und
die Schalen aus dem Vollen herausgeschliffen. Bei dieser
Arbeit mißräth gar manches Stück, es bekommt Sprünge
und muß zur Seite gesetzt werden. Merkwürdiger Weise
tauchten gerade zur Zeit, als die Compania ihre viel-
bewunderten Schalen zur letzten pariser Ausstellung brachte,
an verschiedenen Orten Händler auf, welche ziemlich große
Bruchstücke antiker Millefioris seilboten. Sie wurden gut
bezahlt, gingen in Privatsammlungen und selbst in Museen
über, waren aber nichts als Abfälle der Muranefer Fabrik.
Die gallisch-rheinische Industrie des Jahrhunderts be-
gnügte sich damit, die äußere Forin der flachkugeligen
Millefiori-Schalen mit ihren starken Längsrippen durch
Guß in einer Hohlform in einfarbigem Glase nach-
zubilden. Sie erzeugte so oft Gefäße von bedeutender
Größe in tiefstem Saphirblau, in Purpurroth, Gelb,
Braun und Olivgrün, welche sorgfältig mit dem Schleif-
rade nachgearbeitet find. Eine nähere Anlehnung an die
italischen Muster zeigen die rheinischen petinetgläser, bei
welchen die mehrfach überfangenen Glasstäbe oder Stab-
bündel nicht quer, sondern der Länge nach durchschnitten
und bandartig um den durchsichtigen Rern des Gefäßes
gelegt wurden. Bei einem in Röln gefundenen Rugel-
becher der Sammlung Nießen und einem Glase des
Bonner Museums ist diese Technik durch spiralförmiges
Zusammendrehen dünner Glasfäden innerhalb eines
durchsichtigen Stabes complicirt, ein Verfahren, das in
Byzanz und vom \6. Jahrhundert ab in Venedig zur
Virtuosität ausgebildet wurde. Auch die damascinirten,
marmorirten und Gnyxgläser fanden in dieser Zeit in
der gallisch-rheinischen Industrie Eingang. Zu der Deco-
ration farbiger Gläser durch Umspinnen mit Fäden und
Einlassen von andersfarbigen Mustern trat die mit Gold
hinzu. Sie hat ihren Ursprung in Aegypten, wo man
mitunter das ganze Gefäß einförniig mit Blattgold bezog
und mit farblosem Glase überfing. Bei den Millefiori-
und petinetgläsern tauchte man einen dicken Stab in
Blattgold ein und zerschnitt denselben, so daß sich im
Gefäße goldene Flecken oder Adern bildeten, oder man
versetzte die Glasmasse mit Goldflittern und zog daraus
X