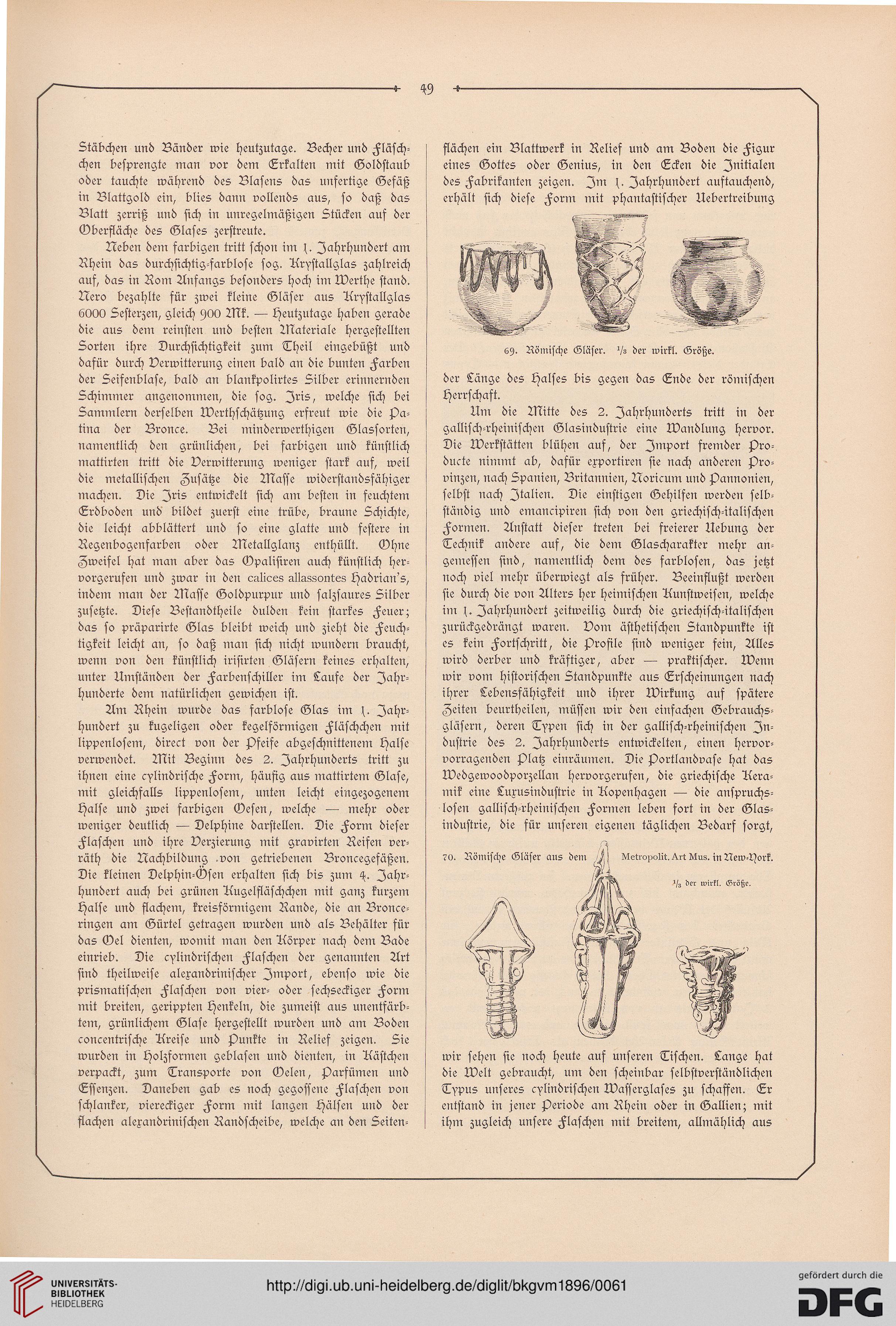+- ^9 +
\
5täbchen und Bänder wie heutzutage. Becher und Fläsch-
chen besprengte man vor dem Erkalten mit Goldstaub
oder tauchte während des Blasens das unfertige Gefäß
in Blattgold ein, blies dann vollends aus, so daß das
Blatt zerriß und sich in unregelmäßigen Stücken auf der
Gberfläche des Glases zerstreute.
Neben dem farbigen tritt schon im Jahrhundert am
Rhein das durchsichtig-farblose sog. Arystallglas zahlreich
auf, das in Rom Anfangs besonders hoch im Werthe stand.
Nero bezahlte für zwei kleine Gläser aus Arystallglas
6000 Sesterzen, gleich siOO Mk. — Heutzutage haben gerade
die aus dem reinsten und besten Materiale hergestellten
Sorten ihre Durchsichtigkeit zum Theil eingebüßt und
dafür durch Verwitterung einen bald an die bunten Farben
der Seifenblase, bald an blankpolirtes Silber erinnernden
Schimmer angenommen, die sog. Iris, welche sich bei
Sammlern derselben Werthschätzung erfreut wie die Pa-
tina der Bronce. Bei minderwerthigen Glassorten,
namentlich den grünlichen, bei farbigen und künstlich
mattirten tritt die Verwitterung weniger stark auf, weil
die metallischen Zusätze die Masse widerstandsfähiger
machen. Die Iris entwickelt sich am besten in feuchtem
Erdboden und bildet zuerst eine trübe, braune Schichte,
die leicht abblättert und so eine glatte und festere in
Regenbogenfarben oder Metallglanz enthüllt. Ohne
Zweifel hat man aber das Gpalisiren auch künstlich her-
vorgerufen und zwar in den calices allassontes Hadrian's,
indem man der Maste Goldpurpur und salzsaures Silber
zusetzte. Diese Bestandtheile dulden kein starkes Feuer;
das so präparirte Glas bleibt weich und zieht die Feuch-
tigkeit leicht an, so daß inan sich nicht wundern braucht,
wenn von den künstlich irisirten Gläsern keines erhalten,
unter Amständen der Farbenschiller im Laufe der Jahr-
hunderte dem natürlichen gewichen ist.
Am Rhein wurde das farblose Glas im f. Jahr-
hundert zu kugeligen oder kegelförmigen Fläschchen mit
lippenlosem, direct von der Pfeife abgeschnittenem Halse
verwendet. Mit Beginn des 2. Jahrhunderts tritt zu
ihnen eine cylindrische Form, häufig aus mattirtem Glase,
init gleichfalls lippenlosem, unten leicht eingezogenem
Halse und zwei farbigen Gesen, welche — mehr oder
weniger deutlich — Delphine darstellen. Die Form dieser
Flaschen und ihre Verzierung mit gravirten Reifen ver-
räth die Nachbildung .von getriebenen Broncegefäßen.
Die kleinen Delphin-Gsen erhalten sich bis zum Jahr-
hundert auch bei grünen Augelfläfchchen mit ganz kurzem
Halse und fiachem, kreisförmigem Rande, die an Bronce-
ringen am Gürtel getragen wurden und als Behälter für
das Gel dienten, womit man den Aörper nach dem Bade
einrieb. Die cylindrifchen Flaschen der genannten Art
sind theilweise alexandrinischer Import, ebenso wie die
prismatischen Flaschen von vier- oder sechseckiger Form
init breiten, gerippten Henkeln, die zumeist aus unentfärb-
tem, grünlichem Glase hergestellt wurden und am Boden
concentrische Areise und Punkte in Relief zeigen. Sie
wurden in Holzformen geblasen und dienten, in Aästchen
verpackt, zum Transporte von Gelen, Parfümen und
Essenzen. Daneben gab es noch gegossene Flaschen von
schlanker, viereckiger Form mit langen Hälsen und der
stachen alexandrinischen Randscheibe, welche an den Seiten-
flächen ein Blattwerk in Relief und am Boden die Figur
eines Gottes oder Genius, in den Ecken die Initialen
des Fabrikanten zeigen. Im p Jahrhundert auftauchend,
erhält sich diese Form mit phantastischer Uebertreibung
69. Römische Gläser. Vs der wirkt. Größe.
der Länge des Halses bis gegen das Ende der römischen
Herrschaft.
Am die Mitte des 2. Jahrhunderts tritt in der
gallisch-rheinischen Glasindustrie eine Wandlung hervor.
Die Werkstätten blühen aus, der Import fremder pro-
ducte nimmt ab, dafür exportiren sie nach anderen Pro-
vinzen, nach Spanien, Britannien, Noricum und Pannonien,
selbst nach Italien. Die einstigen Gehilfen werden selb-
ständig und emancipiren sich von den griechisch-italischen
Formen. Anstatt dieser treten bei freierer Aebung der
Technik andere aus, die dem Glascharakter mehr an-
gemessen sind, namentlich dem des farblosen, das jetzt
noch viel mehr überwiegt als früher. Beeinflußt werden
sie durch die von Alters her heimischen Aunstweisen, welche
im \. Jahrhundert zeitweilig durch die griechisch-italischen
zurückgedrängt waren. Vom ästhetischen Standpunkte ist
es kein Fortschritt, die Profile sind weniger fein, Alles
wird derber und kräftiger, aber — praktischer. Wenn
wir vom historischen Standpunkte aus Erscheinungen nach
ihrer Lebensfähigkeit und ihrer Wirkung auf spätere
Zeiten beurtheilen, müssen wir den einfachen Gebrauchs-
gläsern, deren Typen sich in der gallisch-rheinischen In-
dustrie des 2. Jahrhunderts entwickelten, einen hervor-
vorragenden Platz einräumen. Die Portlandvase hat das
Wedgewoodporzellan hervorgerufen, die griechische Aera-
mik eine Luxusindustrie in Kopenhagen — die anspruchs-
losen gallisch-rheinischen Formen leben fort in der Glas-
industrie, die für unseren eigenen täglichen Bedarf sorgt,
wir sehen sie noch heute aus unseren Tischen. Lange hat
die Welt gebraucht, um den scheinbar selbstverständlichen
Typus unseres cylindrifchen Wasserglases zu schaffen. Er
entstand in jener Periode am Rhein oder in Gallien; mit
ihm zugleich unsere Flaschen mit breitem, allmählich aus
\
5täbchen und Bänder wie heutzutage. Becher und Fläsch-
chen besprengte man vor dem Erkalten mit Goldstaub
oder tauchte während des Blasens das unfertige Gefäß
in Blattgold ein, blies dann vollends aus, so daß das
Blatt zerriß und sich in unregelmäßigen Stücken auf der
Gberfläche des Glases zerstreute.
Neben dem farbigen tritt schon im Jahrhundert am
Rhein das durchsichtig-farblose sog. Arystallglas zahlreich
auf, das in Rom Anfangs besonders hoch im Werthe stand.
Nero bezahlte für zwei kleine Gläser aus Arystallglas
6000 Sesterzen, gleich siOO Mk. — Heutzutage haben gerade
die aus dem reinsten und besten Materiale hergestellten
Sorten ihre Durchsichtigkeit zum Theil eingebüßt und
dafür durch Verwitterung einen bald an die bunten Farben
der Seifenblase, bald an blankpolirtes Silber erinnernden
Schimmer angenommen, die sog. Iris, welche sich bei
Sammlern derselben Werthschätzung erfreut wie die Pa-
tina der Bronce. Bei minderwerthigen Glassorten,
namentlich den grünlichen, bei farbigen und künstlich
mattirten tritt die Verwitterung weniger stark auf, weil
die metallischen Zusätze die Masse widerstandsfähiger
machen. Die Iris entwickelt sich am besten in feuchtem
Erdboden und bildet zuerst eine trübe, braune Schichte,
die leicht abblättert und so eine glatte und festere in
Regenbogenfarben oder Metallglanz enthüllt. Ohne
Zweifel hat man aber das Gpalisiren auch künstlich her-
vorgerufen und zwar in den calices allassontes Hadrian's,
indem man der Maste Goldpurpur und salzsaures Silber
zusetzte. Diese Bestandtheile dulden kein starkes Feuer;
das so präparirte Glas bleibt weich und zieht die Feuch-
tigkeit leicht an, so daß inan sich nicht wundern braucht,
wenn von den künstlich irisirten Gläsern keines erhalten,
unter Amständen der Farbenschiller im Laufe der Jahr-
hunderte dem natürlichen gewichen ist.
Am Rhein wurde das farblose Glas im f. Jahr-
hundert zu kugeligen oder kegelförmigen Fläschchen mit
lippenlosem, direct von der Pfeife abgeschnittenem Halse
verwendet. Mit Beginn des 2. Jahrhunderts tritt zu
ihnen eine cylindrische Form, häufig aus mattirtem Glase,
init gleichfalls lippenlosem, unten leicht eingezogenem
Halse und zwei farbigen Gesen, welche — mehr oder
weniger deutlich — Delphine darstellen. Die Form dieser
Flaschen und ihre Verzierung mit gravirten Reifen ver-
räth die Nachbildung .von getriebenen Broncegefäßen.
Die kleinen Delphin-Gsen erhalten sich bis zum Jahr-
hundert auch bei grünen Augelfläfchchen mit ganz kurzem
Halse und fiachem, kreisförmigem Rande, die an Bronce-
ringen am Gürtel getragen wurden und als Behälter für
das Gel dienten, womit man den Aörper nach dem Bade
einrieb. Die cylindrifchen Flaschen der genannten Art
sind theilweise alexandrinischer Import, ebenso wie die
prismatischen Flaschen von vier- oder sechseckiger Form
init breiten, gerippten Henkeln, die zumeist aus unentfärb-
tem, grünlichem Glase hergestellt wurden und am Boden
concentrische Areise und Punkte in Relief zeigen. Sie
wurden in Holzformen geblasen und dienten, in Aästchen
verpackt, zum Transporte von Gelen, Parfümen und
Essenzen. Daneben gab es noch gegossene Flaschen von
schlanker, viereckiger Form mit langen Hälsen und der
stachen alexandrinischen Randscheibe, welche an den Seiten-
flächen ein Blattwerk in Relief und am Boden die Figur
eines Gottes oder Genius, in den Ecken die Initialen
des Fabrikanten zeigen. Im p Jahrhundert auftauchend,
erhält sich diese Form mit phantastischer Uebertreibung
69. Römische Gläser. Vs der wirkt. Größe.
der Länge des Halses bis gegen das Ende der römischen
Herrschaft.
Am die Mitte des 2. Jahrhunderts tritt in der
gallisch-rheinischen Glasindustrie eine Wandlung hervor.
Die Werkstätten blühen aus, der Import fremder pro-
ducte nimmt ab, dafür exportiren sie nach anderen Pro-
vinzen, nach Spanien, Britannien, Noricum und Pannonien,
selbst nach Italien. Die einstigen Gehilfen werden selb-
ständig und emancipiren sich von den griechisch-italischen
Formen. Anstatt dieser treten bei freierer Aebung der
Technik andere aus, die dem Glascharakter mehr an-
gemessen sind, namentlich dem des farblosen, das jetzt
noch viel mehr überwiegt als früher. Beeinflußt werden
sie durch die von Alters her heimischen Aunstweisen, welche
im \. Jahrhundert zeitweilig durch die griechisch-italischen
zurückgedrängt waren. Vom ästhetischen Standpunkte ist
es kein Fortschritt, die Profile sind weniger fein, Alles
wird derber und kräftiger, aber — praktischer. Wenn
wir vom historischen Standpunkte aus Erscheinungen nach
ihrer Lebensfähigkeit und ihrer Wirkung auf spätere
Zeiten beurtheilen, müssen wir den einfachen Gebrauchs-
gläsern, deren Typen sich in der gallisch-rheinischen In-
dustrie des 2. Jahrhunderts entwickelten, einen hervor-
vorragenden Platz einräumen. Die Portlandvase hat das
Wedgewoodporzellan hervorgerufen, die griechische Aera-
mik eine Luxusindustrie in Kopenhagen — die anspruchs-
losen gallisch-rheinischen Formen leben fort in der Glas-
industrie, die für unseren eigenen täglichen Bedarf sorgt,
wir sehen sie noch heute aus unseren Tischen. Lange hat
die Welt gebraucht, um den scheinbar selbstverständlichen
Typus unseres cylindrifchen Wasserglases zu schaffen. Er
entstand in jener Periode am Rhein oder in Gallien; mit
ihm zugleich unsere Flaschen mit breitem, allmählich aus