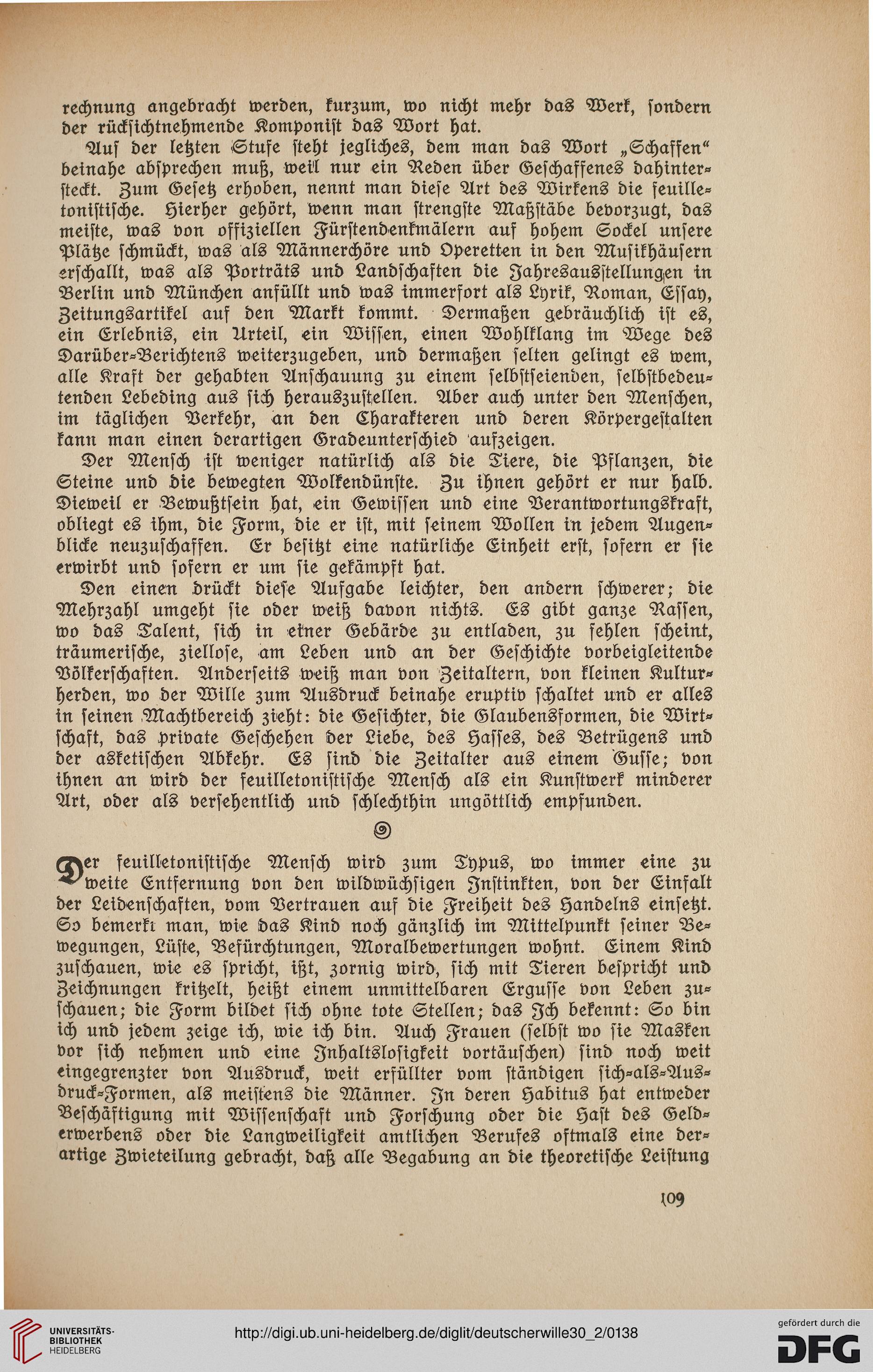rechnung angebracht werden, kurzum, wo nicht rnehr das Werk, sondern
der rücksichtnehmende Komponist das Wort hat.
Aus der letzten Stufe steht jegliches, dem man das Wort „Schaffen"
beinahe absprechen muß, weil nur ein Reden über Geschaffenes dahinter-
steckt. Zum Gesetz erhoben, nennt man diese Art des Wirkens die feuille-
tonistische. Hierher gehört, wenn man strengste Maßstäbe bevorzugt, das
meiste, was von offiziellen Fürstendenkmälern auf hohem Sockel unsere
Plätze schmückt, was als Männerchöre und Operetten in den Musikhäusern
erschallt, was als Porträts und Landschaften die Iahresausstellungen in
Berlin und München anfüllt und was immerfort als Lyrik, Roman, Essay,
Zeitungsartikel auf den Markt kommt. Dermaßen gebräuchlich ist es,
ein Erlebnis, ein Arteil, ein Wissen, einen Wohlklang im Wege des
Darüber-Berichtens weiterzugeben, und dermaßen selten gelingt es wem,
alle Kraft der gehabten Anschauung zu einem selbstseienden, selbstbedeu«
tenden Lebeding aus sich herauszustellen. Aber auch unter den Menschen,
im täglichen Verkehr, an den Charakteren und deren Körpergestalten
kann man einen derartigen Gradeunterschied aufzeigen.
Der Mensch ist weniger natürlich als die Tiere, die Pflanzen, die
Steine und die bewegten Wolkendünste. Zu ihnen gehört er nur halb.
Dieweil er Bewußtsein hat, ein Gewissen und eine Verantwortungskraft,
obliegt es ihm, die Form, die er ist, mit seinem Wollen in jedem Augen-
blicke neuzuschaffen. Er besitzt eine natürliche Einheit erst, sofern er sie
erwirbt und sofern er um sie gekämpft hat.
Den einen drückt diese Aufgabe leichter, den andern schwerer; die
Mehrzahl umgeht sie oder weiß davon nichts. Es gibt ganze Rassen,
wo das Talent, sich in etner Gebärde zu entladen, zu fehlen scheint,
träumerische, ziellose, am Leben und an der Geschichte vorbeigleitende
Völkerschaften. Anderseits weiß man von Zeitaltern, von kleinen Kultur»
herden, wo der Wille zum Ausdruck beinahe eruptiv schaltet und er alles
in seinen Machtbereich zieht: die Gesichter, die Glaubensformen, die Wirt-
schaft, das private Geschehen der Liebe, des tzasses, des Betrügens und
der asketischen Abkehr. Es sind die Zeitalter aus einem Gusse; von
ihnen an wird der feuilletonistische Mensch als ein Kunstwerk minderer
Art, oder als versehentlich und schlechthin ungöttlich empfunden.
(Aer feuilletonistische Mensch wird zum Typus, wo immer eine zu
^weite Entfernung von den wildwüchsigen Instinkten, von der Einfalt
der Leidenschaften, vom Vertrauen auf die Freiheit des tzandelns einsetzt.
So bemerkr man, wie das Kind noch gänzlich im Mittelpunkt seiner Be-
wegungen, Lüste, Befürchtungen, Moralbewertungen wohnt. Einem Kind
zuschauen, wie es spricht, ißt, ^ornig wird, sich mit Tieren bespricht und
Zeichnungen kritzelt, heißt einem unmittelbaren Ergusse von Leben zu--
schauen; die Form bildet fich ohne tote Stellen; das Ich bekennt: So bin
ich und jedem zeige ich, wie ich bin. Auch Frauen (selbst wo sie Masken
vor sich nehmen und eine Inhaltslosigkeit vortäuschen) sind noch weit
eingegrenzter von Ausdruck, weit ersüllter vom ständigen sich-als-Aus-
druck-Formen, als meistens die Männer. In deren tzabitus hat entweder
Beschäftigung mit Wissenschaft und Forschung oder die tzast des Geld-
erwerbens oder die Langweiligkeit amtlichen Berufes oftmals eine der«
artige Zwieteilung gebracht, daß alle Begabung an die theoretische Leistung
L09
der rücksichtnehmende Komponist das Wort hat.
Aus der letzten Stufe steht jegliches, dem man das Wort „Schaffen"
beinahe absprechen muß, weil nur ein Reden über Geschaffenes dahinter-
steckt. Zum Gesetz erhoben, nennt man diese Art des Wirkens die feuille-
tonistische. Hierher gehört, wenn man strengste Maßstäbe bevorzugt, das
meiste, was von offiziellen Fürstendenkmälern auf hohem Sockel unsere
Plätze schmückt, was als Männerchöre und Operetten in den Musikhäusern
erschallt, was als Porträts und Landschaften die Iahresausstellungen in
Berlin und München anfüllt und was immerfort als Lyrik, Roman, Essay,
Zeitungsartikel auf den Markt kommt. Dermaßen gebräuchlich ist es,
ein Erlebnis, ein Arteil, ein Wissen, einen Wohlklang im Wege des
Darüber-Berichtens weiterzugeben, und dermaßen selten gelingt es wem,
alle Kraft der gehabten Anschauung zu einem selbstseienden, selbstbedeu«
tenden Lebeding aus sich herauszustellen. Aber auch unter den Menschen,
im täglichen Verkehr, an den Charakteren und deren Körpergestalten
kann man einen derartigen Gradeunterschied aufzeigen.
Der Mensch ist weniger natürlich als die Tiere, die Pflanzen, die
Steine und die bewegten Wolkendünste. Zu ihnen gehört er nur halb.
Dieweil er Bewußtsein hat, ein Gewissen und eine Verantwortungskraft,
obliegt es ihm, die Form, die er ist, mit seinem Wollen in jedem Augen-
blicke neuzuschaffen. Er besitzt eine natürliche Einheit erst, sofern er sie
erwirbt und sofern er um sie gekämpft hat.
Den einen drückt diese Aufgabe leichter, den andern schwerer; die
Mehrzahl umgeht sie oder weiß davon nichts. Es gibt ganze Rassen,
wo das Talent, sich in etner Gebärde zu entladen, zu fehlen scheint,
träumerische, ziellose, am Leben und an der Geschichte vorbeigleitende
Völkerschaften. Anderseits weiß man von Zeitaltern, von kleinen Kultur»
herden, wo der Wille zum Ausdruck beinahe eruptiv schaltet und er alles
in seinen Machtbereich zieht: die Gesichter, die Glaubensformen, die Wirt-
schaft, das private Geschehen der Liebe, des tzasses, des Betrügens und
der asketischen Abkehr. Es sind die Zeitalter aus einem Gusse; von
ihnen an wird der feuilletonistische Mensch als ein Kunstwerk minderer
Art, oder als versehentlich und schlechthin ungöttlich empfunden.
(Aer feuilletonistische Mensch wird zum Typus, wo immer eine zu
^weite Entfernung von den wildwüchsigen Instinkten, von der Einfalt
der Leidenschaften, vom Vertrauen auf die Freiheit des tzandelns einsetzt.
So bemerkr man, wie das Kind noch gänzlich im Mittelpunkt seiner Be-
wegungen, Lüste, Befürchtungen, Moralbewertungen wohnt. Einem Kind
zuschauen, wie es spricht, ißt, ^ornig wird, sich mit Tieren bespricht und
Zeichnungen kritzelt, heißt einem unmittelbaren Ergusse von Leben zu--
schauen; die Form bildet fich ohne tote Stellen; das Ich bekennt: So bin
ich und jedem zeige ich, wie ich bin. Auch Frauen (selbst wo sie Masken
vor sich nehmen und eine Inhaltslosigkeit vortäuschen) sind noch weit
eingegrenzter von Ausdruck, weit ersüllter vom ständigen sich-als-Aus-
druck-Formen, als meistens die Männer. In deren tzabitus hat entweder
Beschäftigung mit Wissenschaft und Forschung oder die tzast des Geld-
erwerbens oder die Langweiligkeit amtlichen Berufes oftmals eine der«
artige Zwieteilung gebracht, daß alle Begabung an die theoretische Leistung
L09