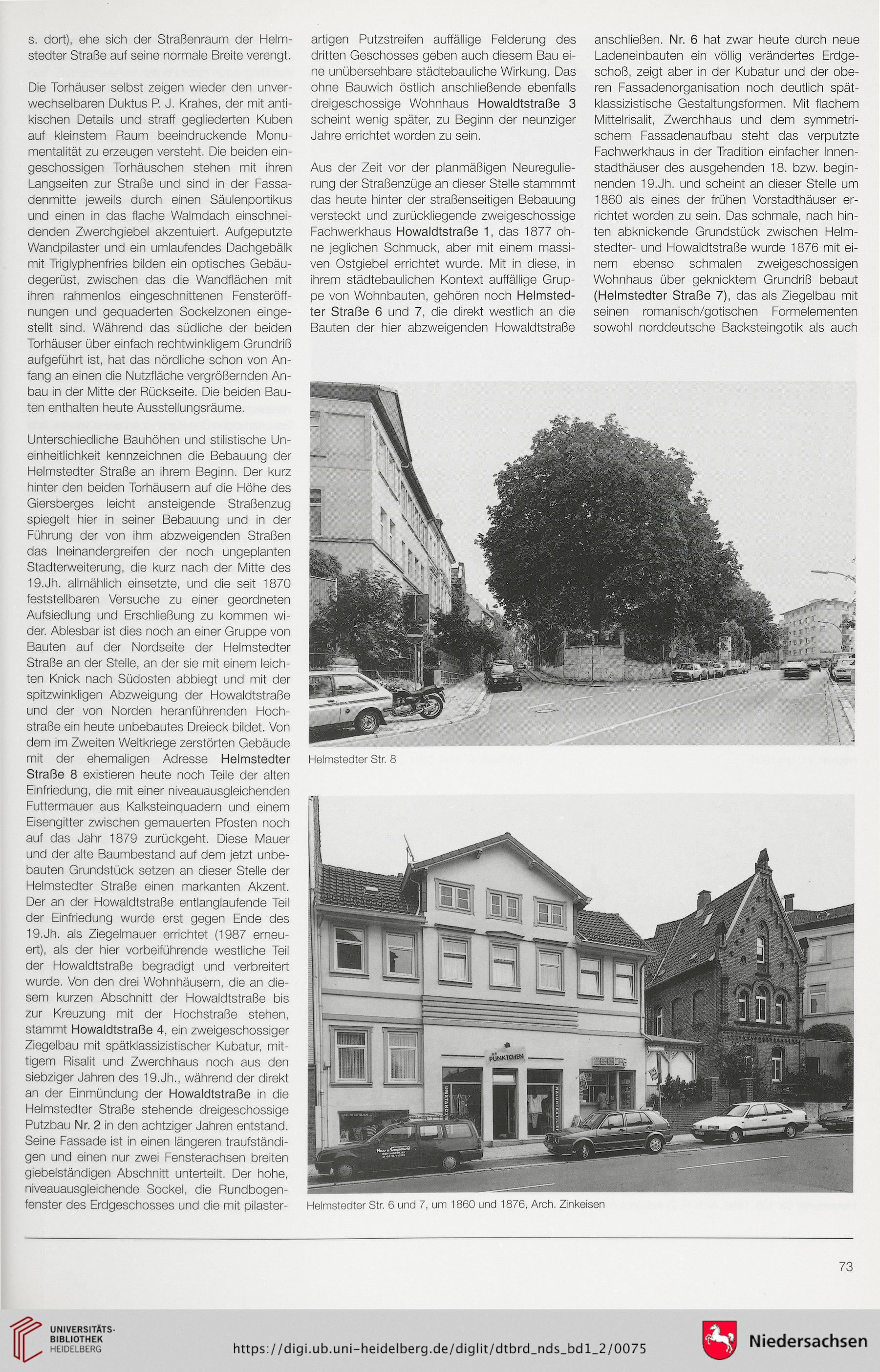s. dort), ehe sich der Straßenraum der Helm-
stedter Straße auf seine normale Breite verengt.
Die Torhäuser selbst zeigen wieder den unver-
wechselbaren Duktus P. J. Krahes, der mit anti-
kischen Details und straff gegliederten Kuben
auf kleinstem Raum beeindruckende Monu-
mentalität zu erzeugen versteht. Die beiden ein-
geschossigen Torhäuschen stehen mit ihren
Langseiten zur Straße und sind in der Fassa-
denmitte jeweils durch einen Säulenportikus
und einen in das flache Walmdach einschnei-
denden Zwerchgiebel akzentuiert. Aufgeputzte
Wandpilaster und ein umlaufendes Dachgebäik
mit Triglyphenfries bilden ein optisches Gebäu-
degerüst, zwischen das die Wandflächen mit
ihren rahmenlos eingeschnittenen Fensteröff-
nungen und gequaderten Sockelzonen einge-
stellt sind. Während das südliche der beiden
Torhäuser über einfach rechtwinkligem Grundriß
aufgeführt ist, hat das nördliche schon von An-
fang an einen die Nutzfläche vergrößernden An-
bau in der Mitte der Rückseite. Die beiden Bau-
ten enthalten heute Ausstellungsräume.
Unterschiedliche Bauhöhen und stilistische Un-
einheitlichkeit kennzeichnen die Bebauung der
Helmstedter Straße an ihrem Beginn. Der kurz
hinter den beiden Torhäusern auf die Höhe des
Giersberges leicht ansteigende Straßenzug
spiegelt hier in seiner Bebauung und in der
Führung der von ihm abzweigenden Straßen
das Ineinandergreifen der noch ungeplanten
Stadterweiterung, die kurz nach der Mitte des
19.Jh. allmählich einsetzte, und die seit 1870
feststellbaren Versuche zu einer geordneten
Aufsiedlung und Erschließung zu kommen wi-
der. Ablesbar ist dies noch an einer Gruppe von
Bauten auf der Nordseite der Helmstedter
Straße an der Stelle, an der sie mit einem leich-
ten Knick nach Südosten abbiegt und mit der
spitzwinkligen Abzweigung der Howaldtstraße
und der von Norden heranführenden Hoch-
straße ein heute unbebautes Dreieck bildet. Von
dem im Zweiten Weltkriege zerstörten Gebäude
mit der ehemaligen Adresse Helmstedter
Straße 8 existieren heute noch Teile der alten
Einfriedung, die mit einer niveauausgleichenden
Futtermauer aus Kalksteinquadern und einem
Eisengitter zwischen gemauerten Pfosten noch
auf das Jahr 1879 zurückgeht. Diese Mauer
und der alte Baumbestand auf dem jetzt unbe-
bauten Grundstück setzen an dieser Stelle der
Helmstedter Straße einen markanten Akzent.
Der an der Howaldtstraße entlanglaufende Teil
der Einfriedung wurde erst gegen Ende des
19.Jh. als Ziegelmauer errichtet (1987 erneu-
ert), als der hier vorbeiführende westliche Teil
der Howaldtstraße begradigt und verbreitert
wurde. Von den drei Wohnhäusern, die an die-
sem kurzen Abschnitt der Howaldtstraße bis
zur Kreuzung mit der Hochstraße stehen,
stammt Howaldtstraße 4, ein zweigeschossiger
Ziegelbau mit spätklassizistischer Kubatur, mit-
tigem Risalit und Zwerchhaus noch aus den
siebziger Jahren des 19.Jh., während der direkt
an der Einmündung der Howaldtstraße in die
Helmstedter Straße stehende dreigeschossige
Putzbau Nr. 2 in den achtziger Jahren entstand.
Seine Fassade ist in einen längeren traufständi-
gen und einen nur zwei Fensterachsen breiten
giebelständigen Abschnitt unterteilt. Der hohe,
niveauausgleichende Sockel, die Rundbogen-
fenster des Erdgeschosses und die mit pilaster-
artigen Putzstreifen auffällige Felderung des
dritten Geschosses geben auch diesem Bau ei-
ne unübersehbare städtebauliche Wirkung. Das
ohne Bauwich östlich anschließende ebenfalls
dreigeschossige Wohnhaus Howaldtstraße 3
scheint wenig später, zu Beginn der neunziger
Jahre errichtet worden zu sein.
Aus der Zeit vor der planmäßigen Neuregulie-
rung der Straßenzüge an dieser Stelle stammmt
das heute hinter der straßenseitigen Bebauung
versteckt und zurückliegende zweigeschossige
Fachwerkhaus Howaldtstraße 1, das 1877 oh-
ne jeglichen Schmuck, aber mit einem massi-
ven Ostgiebel errichtet wurde. Mit in diese, in
ihrem städtebaulichen Kontext auffällige Grup-
pe von Wohnbauten, gehören noch Helmsted-
ter Straße 6 und 7, die direkt westlich an die
Bauten der hier abzweigenden Howaldtstraße
anschließen. Nr. 6 hat zwar heute durch neue
Ladeneinbauten ein völlig verändertes Erdge-
schoß, zeigt aber in der Kubatur und der obe-
ren Fassadenorganisation noch deutlich spät-
klassizistische Gestaltungsformen. Mit flachem
Mittelrisalit, Zwerchhaus und dem symmetri-
schem Fassadenaufbau steht das verputzte
Fachwerkhaus in der Tradition einfacher Innen-
stadthäuser des ausgehenden 18. bzw. begin-
nenden 19.Jh. und scheint an dieser Stelle um
1860 als eines der frühen Vorstadthäuser er-
richtet worden zu sein. Das schmale, nach hin-
ten abknickende Grundstück zwischen Helm-
stedter- und Howaldtstraße wurde 1876 mit ei-
nem ebenso schmalen zweigeschossigen
Wohnhaus über geknicktem Grundriß bebaut
(Helmstedter Straße 7), das als Ziegelbau mit
seinen romanisch/gotischen Formelementen
sowohl norddeutsche Backsteingotik als auch
Helmstedter Str. 8
PUNKWtN
Helmstedter Str. 6 und 7, um 1860 und 1876, Arch. Zinkeisen
73
stedter Straße auf seine normale Breite verengt.
Die Torhäuser selbst zeigen wieder den unver-
wechselbaren Duktus P. J. Krahes, der mit anti-
kischen Details und straff gegliederten Kuben
auf kleinstem Raum beeindruckende Monu-
mentalität zu erzeugen versteht. Die beiden ein-
geschossigen Torhäuschen stehen mit ihren
Langseiten zur Straße und sind in der Fassa-
denmitte jeweils durch einen Säulenportikus
und einen in das flache Walmdach einschnei-
denden Zwerchgiebel akzentuiert. Aufgeputzte
Wandpilaster und ein umlaufendes Dachgebäik
mit Triglyphenfries bilden ein optisches Gebäu-
degerüst, zwischen das die Wandflächen mit
ihren rahmenlos eingeschnittenen Fensteröff-
nungen und gequaderten Sockelzonen einge-
stellt sind. Während das südliche der beiden
Torhäuser über einfach rechtwinkligem Grundriß
aufgeführt ist, hat das nördliche schon von An-
fang an einen die Nutzfläche vergrößernden An-
bau in der Mitte der Rückseite. Die beiden Bau-
ten enthalten heute Ausstellungsräume.
Unterschiedliche Bauhöhen und stilistische Un-
einheitlichkeit kennzeichnen die Bebauung der
Helmstedter Straße an ihrem Beginn. Der kurz
hinter den beiden Torhäusern auf die Höhe des
Giersberges leicht ansteigende Straßenzug
spiegelt hier in seiner Bebauung und in der
Führung der von ihm abzweigenden Straßen
das Ineinandergreifen der noch ungeplanten
Stadterweiterung, die kurz nach der Mitte des
19.Jh. allmählich einsetzte, und die seit 1870
feststellbaren Versuche zu einer geordneten
Aufsiedlung und Erschließung zu kommen wi-
der. Ablesbar ist dies noch an einer Gruppe von
Bauten auf der Nordseite der Helmstedter
Straße an der Stelle, an der sie mit einem leich-
ten Knick nach Südosten abbiegt und mit der
spitzwinkligen Abzweigung der Howaldtstraße
und der von Norden heranführenden Hoch-
straße ein heute unbebautes Dreieck bildet. Von
dem im Zweiten Weltkriege zerstörten Gebäude
mit der ehemaligen Adresse Helmstedter
Straße 8 existieren heute noch Teile der alten
Einfriedung, die mit einer niveauausgleichenden
Futtermauer aus Kalksteinquadern und einem
Eisengitter zwischen gemauerten Pfosten noch
auf das Jahr 1879 zurückgeht. Diese Mauer
und der alte Baumbestand auf dem jetzt unbe-
bauten Grundstück setzen an dieser Stelle der
Helmstedter Straße einen markanten Akzent.
Der an der Howaldtstraße entlanglaufende Teil
der Einfriedung wurde erst gegen Ende des
19.Jh. als Ziegelmauer errichtet (1987 erneu-
ert), als der hier vorbeiführende westliche Teil
der Howaldtstraße begradigt und verbreitert
wurde. Von den drei Wohnhäusern, die an die-
sem kurzen Abschnitt der Howaldtstraße bis
zur Kreuzung mit der Hochstraße stehen,
stammt Howaldtstraße 4, ein zweigeschossiger
Ziegelbau mit spätklassizistischer Kubatur, mit-
tigem Risalit und Zwerchhaus noch aus den
siebziger Jahren des 19.Jh., während der direkt
an der Einmündung der Howaldtstraße in die
Helmstedter Straße stehende dreigeschossige
Putzbau Nr. 2 in den achtziger Jahren entstand.
Seine Fassade ist in einen längeren traufständi-
gen und einen nur zwei Fensterachsen breiten
giebelständigen Abschnitt unterteilt. Der hohe,
niveauausgleichende Sockel, die Rundbogen-
fenster des Erdgeschosses und die mit pilaster-
artigen Putzstreifen auffällige Felderung des
dritten Geschosses geben auch diesem Bau ei-
ne unübersehbare städtebauliche Wirkung. Das
ohne Bauwich östlich anschließende ebenfalls
dreigeschossige Wohnhaus Howaldtstraße 3
scheint wenig später, zu Beginn der neunziger
Jahre errichtet worden zu sein.
Aus der Zeit vor der planmäßigen Neuregulie-
rung der Straßenzüge an dieser Stelle stammmt
das heute hinter der straßenseitigen Bebauung
versteckt und zurückliegende zweigeschossige
Fachwerkhaus Howaldtstraße 1, das 1877 oh-
ne jeglichen Schmuck, aber mit einem massi-
ven Ostgiebel errichtet wurde. Mit in diese, in
ihrem städtebaulichen Kontext auffällige Grup-
pe von Wohnbauten, gehören noch Helmsted-
ter Straße 6 und 7, die direkt westlich an die
Bauten der hier abzweigenden Howaldtstraße
anschließen. Nr. 6 hat zwar heute durch neue
Ladeneinbauten ein völlig verändertes Erdge-
schoß, zeigt aber in der Kubatur und der obe-
ren Fassadenorganisation noch deutlich spät-
klassizistische Gestaltungsformen. Mit flachem
Mittelrisalit, Zwerchhaus und dem symmetri-
schem Fassadenaufbau steht das verputzte
Fachwerkhaus in der Tradition einfacher Innen-
stadthäuser des ausgehenden 18. bzw. begin-
nenden 19.Jh. und scheint an dieser Stelle um
1860 als eines der frühen Vorstadthäuser er-
richtet worden zu sein. Das schmale, nach hin-
ten abknickende Grundstück zwischen Helm-
stedter- und Howaldtstraße wurde 1876 mit ei-
nem ebenso schmalen zweigeschossigen
Wohnhaus über geknicktem Grundriß bebaut
(Helmstedter Straße 7), das als Ziegelbau mit
seinen romanisch/gotischen Formelementen
sowohl norddeutsche Backsteingotik als auch
Helmstedter Str. 8
PUNKWtN
Helmstedter Str. 6 und 7, um 1860 und 1876, Arch. Zinkeisen
73