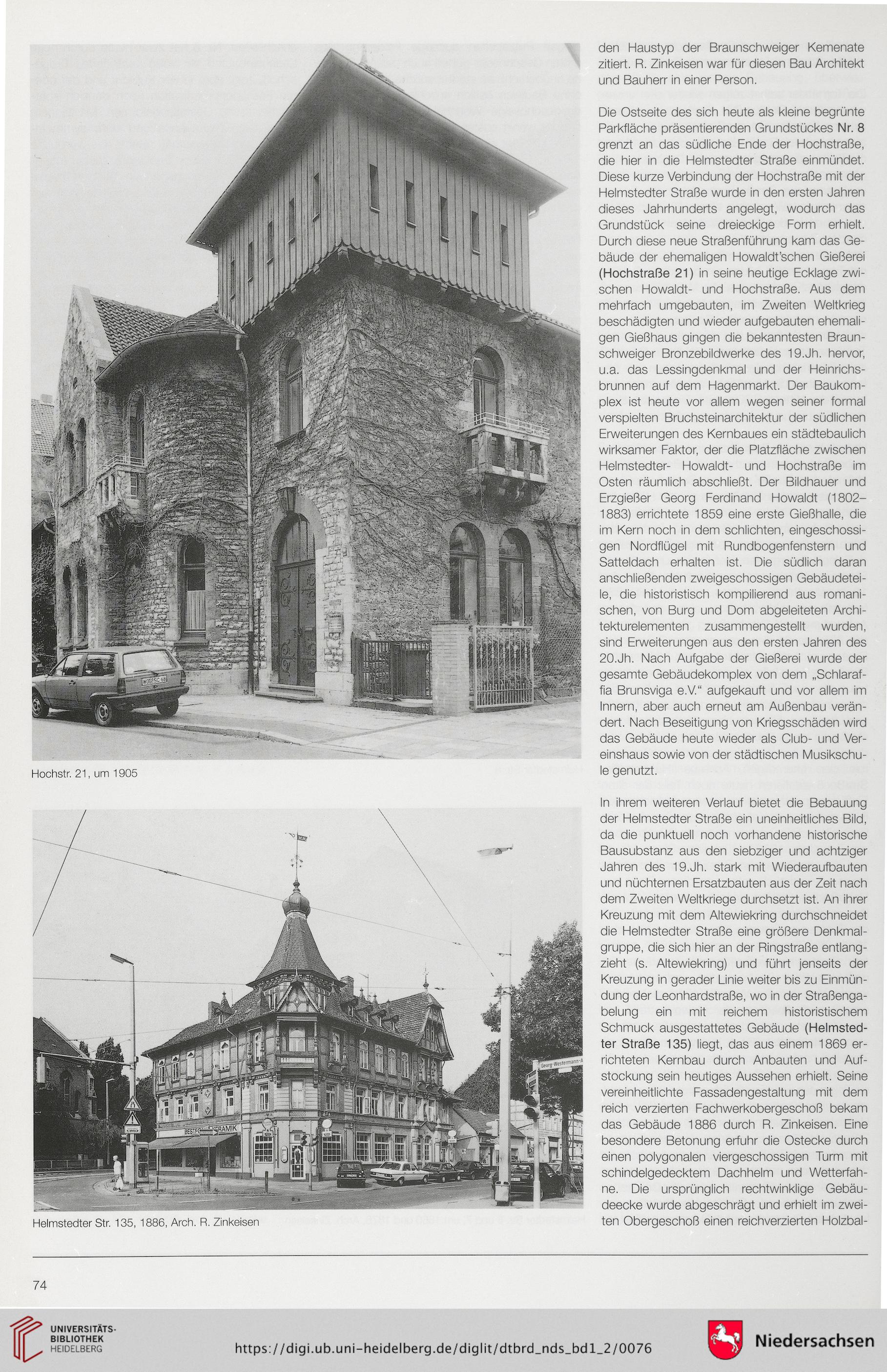J
Hochstr. 21, um 1905
den Haustyp der Braunschweiger Kemenate
zitiert. R. Zinkeisen war für diesen Bau Architekt
und Bauherr in einer Person.
Die Ostseite des sich heute als kleine begrünte
Parkfläche präsentierenden Grundstückes Nr. 8
grenzt an das südliche Ende der Hochstraße,
die hier in die Helmstedter Straße einmündet.
Diese kurze Verbindung der Hochstraße mit der
Helmstedter Straße wurde in den ersten Jahren
dieses Jahrhunderts angelegt, wodurch das
Grundstück seine dreieckige Form erhielt.
Durch diese neue Straßenführung kam das Ge-
bäude der ehemaligen Howaldt’schen Gießerei
(Hochstraße 21) in seine heutige Ecklage zwi-
schen Howaldt- und Hochstraße. Aus dem
mehrfach umgebauten, im Zweiten Weltkrieg
beschädigten und wieder aufgebauten ehemali-
gen Gießhaus gingen die bekanntesten Braun-
schweiger Bronzebildwerke des 19.Jh. hervor,
u.a. das Lessingdenkmal und der Heinrichs-
brunnen auf dem Hagenmarkt. Der Baukom-
plex ist heute vor allem wegen seiner formal
verspielten Bruchsteinarchitektur der südlichen
Erweiterungen des Kernbaues ein städtebaulich
wirksamer Faktor, der die Platzfläche zwischen
Helmstedter- Howaldt- und Hochstraße im
Osten räumlich abschließt. Der Bildhauer und
Erzgießer Georg Ferdinand Howaldt (1802-
1883) errichtete 1859 eine erste Gießhalle, die
im Kern noch in dem schlichten, eingeschossi-
gen Nordflügel mit Rundbogenfenstern und
Satteldach erhalten ist. Die südlich daran
anschließenden zweigeschossigen Gebäudetei-
le, die historistisch kompilierend aus romani-
schen, von Burg und Dom abgeleiteten Archi-
tekturelementen zusammengestellt wurden,
sind Erweiterungen aus den ersten Jahren des
20.Jh. Nach Aufgabe der Gießerei wurde der
gesamte Gebäudekomplex von dem „Schlaraf-
fia Brunsviga e.V.“ aufgekauft und vor allem im
Innern, aber auch erneut am Außenbau verän-
dert. Nach Beseitigung von Kriegsschäden wird
das Gebäude heute wieder als Club- und Ver-
einshaus sowie von der städtischen Musikschu-
le genutzt.
Helmstedter Str. 135, 1886, Arch, R. Zinkeisen
In ihrem weiteren Verlauf bietet die Bebauung
der Helmstedter Straße ein uneinheitliches Bild,
da die punktuell noch vorhandene historische
Bausubstanz aus den siebziger und achtziger
Jahren des 19.Jh. stark mit Wiederaufbauten
und nüchternen Ersatzbauten aus der Zeit nach
dem Zweiten Weltkriege durchsetzt ist. An ihrer
Kreuzung mit dem Altewiekring durchschneidet
die Helmstedter Straße eine größere Denkmal-
gruppe, die sich hier an der Ringstraße entlang-
zieht (s. Altewiekring) und führt jenseits der
Kreuzung in gerader Linie weiter bis zu Einmün-
dung der Leonhardstraße, wo in der Straßenga-
belung ein mit reichem historistischem
Schmuck ausgestattetes Gebäude (Helmsted-
ter Straße 135) liegt, das aus einem 1869 er-
richteten Kernbau durch Anbauten und Auf-
stockung sein heutiges Aussehen erhielt. Seine
vereinheitlichte Fassadengestaltung mit dem
reich verzierten Fachwerkobergeschoß bekam
das Gebäude 1886 durch R. Zinkeisen. Eine
besondere Betonung erfuhr die Ostecke durch
einen polygonalen viergeschossigen Turm mit
schindelgedecktem Dachhelm und Wetterfah-
ne. Die ursprünglich rechtwinklige Gebäu-
deecke wurde abgeschrägt und erhielt im zwei-
ten Obergeschoß einen reichverzierten Holzbal-
74
Hochstr. 21, um 1905
den Haustyp der Braunschweiger Kemenate
zitiert. R. Zinkeisen war für diesen Bau Architekt
und Bauherr in einer Person.
Die Ostseite des sich heute als kleine begrünte
Parkfläche präsentierenden Grundstückes Nr. 8
grenzt an das südliche Ende der Hochstraße,
die hier in die Helmstedter Straße einmündet.
Diese kurze Verbindung der Hochstraße mit der
Helmstedter Straße wurde in den ersten Jahren
dieses Jahrhunderts angelegt, wodurch das
Grundstück seine dreieckige Form erhielt.
Durch diese neue Straßenführung kam das Ge-
bäude der ehemaligen Howaldt’schen Gießerei
(Hochstraße 21) in seine heutige Ecklage zwi-
schen Howaldt- und Hochstraße. Aus dem
mehrfach umgebauten, im Zweiten Weltkrieg
beschädigten und wieder aufgebauten ehemali-
gen Gießhaus gingen die bekanntesten Braun-
schweiger Bronzebildwerke des 19.Jh. hervor,
u.a. das Lessingdenkmal und der Heinrichs-
brunnen auf dem Hagenmarkt. Der Baukom-
plex ist heute vor allem wegen seiner formal
verspielten Bruchsteinarchitektur der südlichen
Erweiterungen des Kernbaues ein städtebaulich
wirksamer Faktor, der die Platzfläche zwischen
Helmstedter- Howaldt- und Hochstraße im
Osten räumlich abschließt. Der Bildhauer und
Erzgießer Georg Ferdinand Howaldt (1802-
1883) errichtete 1859 eine erste Gießhalle, die
im Kern noch in dem schlichten, eingeschossi-
gen Nordflügel mit Rundbogenfenstern und
Satteldach erhalten ist. Die südlich daran
anschließenden zweigeschossigen Gebäudetei-
le, die historistisch kompilierend aus romani-
schen, von Burg und Dom abgeleiteten Archi-
tekturelementen zusammengestellt wurden,
sind Erweiterungen aus den ersten Jahren des
20.Jh. Nach Aufgabe der Gießerei wurde der
gesamte Gebäudekomplex von dem „Schlaraf-
fia Brunsviga e.V.“ aufgekauft und vor allem im
Innern, aber auch erneut am Außenbau verän-
dert. Nach Beseitigung von Kriegsschäden wird
das Gebäude heute wieder als Club- und Ver-
einshaus sowie von der städtischen Musikschu-
le genutzt.
Helmstedter Str. 135, 1886, Arch, R. Zinkeisen
In ihrem weiteren Verlauf bietet die Bebauung
der Helmstedter Straße ein uneinheitliches Bild,
da die punktuell noch vorhandene historische
Bausubstanz aus den siebziger und achtziger
Jahren des 19.Jh. stark mit Wiederaufbauten
und nüchternen Ersatzbauten aus der Zeit nach
dem Zweiten Weltkriege durchsetzt ist. An ihrer
Kreuzung mit dem Altewiekring durchschneidet
die Helmstedter Straße eine größere Denkmal-
gruppe, die sich hier an der Ringstraße entlang-
zieht (s. Altewiekring) und führt jenseits der
Kreuzung in gerader Linie weiter bis zu Einmün-
dung der Leonhardstraße, wo in der Straßenga-
belung ein mit reichem historistischem
Schmuck ausgestattetes Gebäude (Helmsted-
ter Straße 135) liegt, das aus einem 1869 er-
richteten Kernbau durch Anbauten und Auf-
stockung sein heutiges Aussehen erhielt. Seine
vereinheitlichte Fassadengestaltung mit dem
reich verzierten Fachwerkobergeschoß bekam
das Gebäude 1886 durch R. Zinkeisen. Eine
besondere Betonung erfuhr die Ostecke durch
einen polygonalen viergeschossigen Turm mit
schindelgedecktem Dachhelm und Wetterfah-
ne. Die ursprünglich rechtwinklige Gebäu-
deecke wurde abgeschrägt und erhielt im zwei-
ten Obergeschoß einen reichverzierten Holzbal-
74