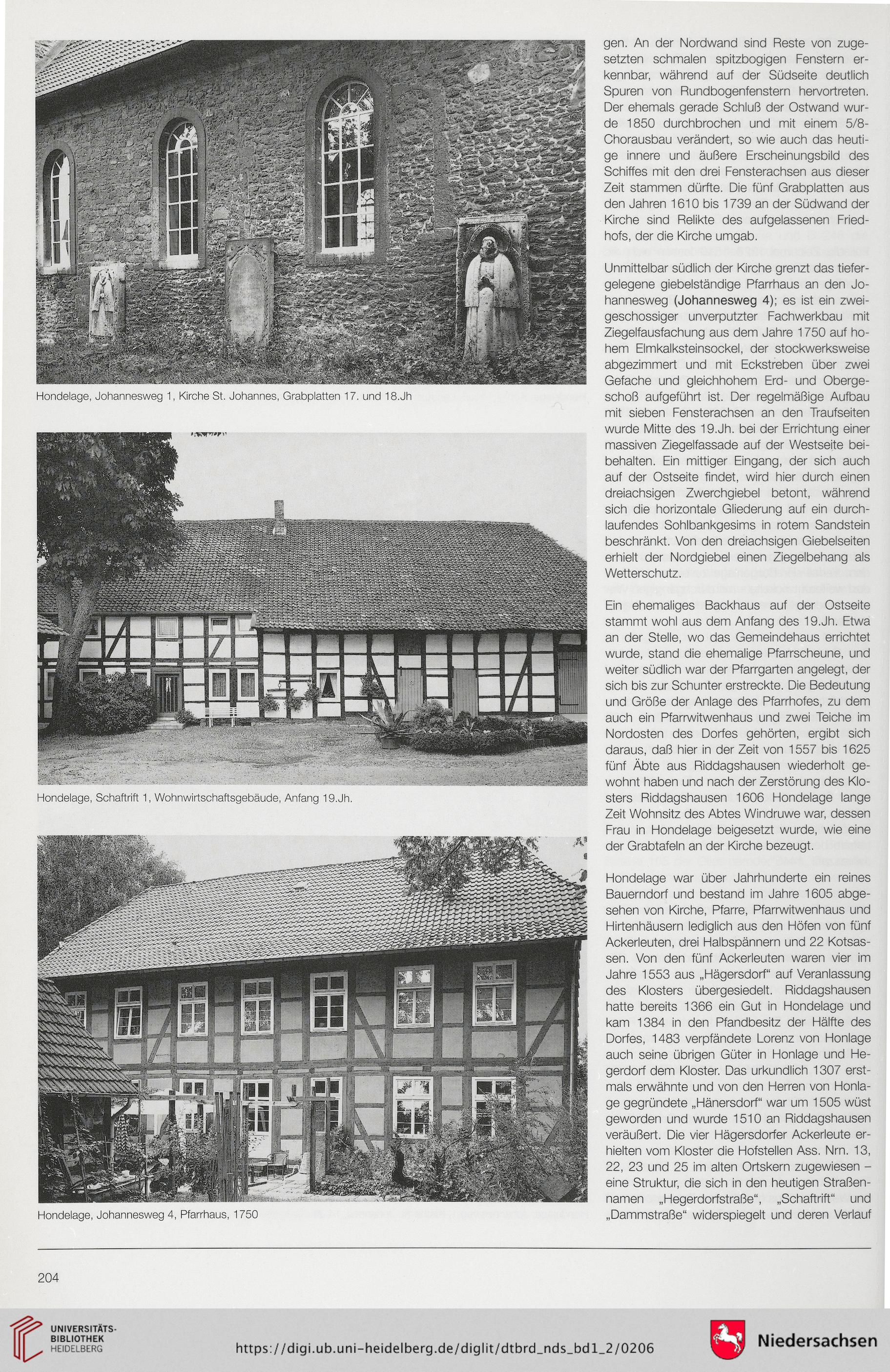Hondelage, Johannesweg 1, Kirche St. Johannes, Grabplatten 17. und 18.Jh
Hondelage, Schaftrift 1, Wohnwirtschaftsgebäude, Anfang 19.Jh.
Hondelage, Johannesweg 4, Pfarrhaus, 1750
gen. An der Nordwand sind Reste von zuge-
setzten schmalen spitzbogigen Fenstern er-
kennbar, während auf der Südseite deutlich
Spuren von Rundbogenfenstern hervortreten.
Der ehemals gerade Schluß der Ostwand wur-
de 1850 durchbrochen und mit einem 5/8-
Chorausbau verändert, so wie auch das heuti-
ge innere und äußere Erscheinungsbild des
Schiffes mit den drei Fensterachsen aus dieser
Zeit stammen dürfte. Die fünf Grabplatten aus
den Jahren 1610 bis 1739 an der Südwand der
Kirche sind Relikte des aufgelassenen Fried-
hofs, der die Kirche umgab.
Unmittelbar südlich der Kirche grenzt das tiefer-
gelegene giebelständige Pfarrhaus an den Jo-
hannesweg (Johannesweg 4); es ist ein zwei-
geschossiger unverputzter Fachwerkbau mit
Ziegelfausfachung aus dem Jahre 1750 auf ho-
hem Elmkalksteinsockel, der stockwerksweise
abgezimmert und mit Eckstreben über zwei
Gefache und gleichhohem Erd- und Oberge-
schoß aufgeführt ist. Der regelmäßige Aufbau
mit sieben Fensterachsen an den Traufseiten
wurde Mitte des 19.Jh. bei der Errichtung einer
massiven Ziegelfassade auf der Westseite bei-
behalten. Ein mittiger Eingang, der sich auch
auf der Ostseite findet, wird hier durch einen
dreiachsigen Zwerchgiebel betont, während
sich die horizontale Gliederung auf ein durch-
laufendes Sohlbankgesims in rotem Sandstein
beschränkt. Von den dreiachsigen Giebelseiten
erhielt der Nordgiebel einen Ziegelbehang als
Wetterschutz.
Ein ehemaliges Backhaus auf der Ostseite
stammt wohl aus dem Anfang des 19.Jh. Etwa
an der Stelle, wo das Gemeindehaus errichtet
wurde, stand die ehemalige Pfarrscheune, und
weiter südlich war der Pfarrgarten angelegt, der
sich bis zur Schunter erstreckte. Die Bedeutung
und Größe der Anlage des Pfarrhofes, zu dem
auch ein Pfarrwitwenhaus und zwei Teiche im
Nordosten des Dorfes gehörten, ergibt sich
daraus, daß hier in der Zeit von 1557 bis 1625
fünf Äbte aus Riddagshausen wiederholt ge-
wohnt haben und nach der Zerstörung des Klo-
sters Riddagshausen 1606 Hondelage lange
Zeit Wohnsitz des Abtes Windruwe war, dessen
Frau in Hondelage beigesetzt wurde, wie eine
der Grabtafeln an der Kirche bezeugt.
Hondelage war über Jahrhunderte ein reines
Bauerndorf und bestand im Jahre 1605 abge-
sehen von Kirche, Pfarre, Pfarrwitwenhaus und
Hirtenhäusern lediglich aus den Höfen von fünf
Ackerleuten, drei Halbspännern und 22 Kotsas-
sen. Von den fünf Ackerleuten waren vier im
Jahre 1553 aus „Hägersdorf“ auf Veranlassung
des Klosters übergesiedelt. Riddagshausen
hatte bereits 1366 ein Gut in Hondelage und
kam 1384 in den Pfandbesitz der Hälfte des
Dorfes, 1483 verpfändete Lorenz von Honlage
auch seine übrigen Güter in Honlage und He-
gerdorf dem Kloster. Das urkundlich 1307 erst-
mals erwähnte und von den Herren von Honla-
ge gegründete „Hänersdorf“ war um 1505 wüst
geworden und wurde 1510 an Riddagshausen
veräußert. Die vier Hägersdorfer Ackerleute er-
hielten vom Kloster die Hofstellen Ass. Nrn. 13,
22, 23 und 25 im alten Ortskern zugewiesen -
eine Struktur, die sich in den heutigen Straßen-
namen „Hegerdorfstraße“, „Schaftrift“ und
„Dammstraße“ widerspiegelt und deren Verlauf
204
Hondelage, Schaftrift 1, Wohnwirtschaftsgebäude, Anfang 19.Jh.
Hondelage, Johannesweg 4, Pfarrhaus, 1750
gen. An der Nordwand sind Reste von zuge-
setzten schmalen spitzbogigen Fenstern er-
kennbar, während auf der Südseite deutlich
Spuren von Rundbogenfenstern hervortreten.
Der ehemals gerade Schluß der Ostwand wur-
de 1850 durchbrochen und mit einem 5/8-
Chorausbau verändert, so wie auch das heuti-
ge innere und äußere Erscheinungsbild des
Schiffes mit den drei Fensterachsen aus dieser
Zeit stammen dürfte. Die fünf Grabplatten aus
den Jahren 1610 bis 1739 an der Südwand der
Kirche sind Relikte des aufgelassenen Fried-
hofs, der die Kirche umgab.
Unmittelbar südlich der Kirche grenzt das tiefer-
gelegene giebelständige Pfarrhaus an den Jo-
hannesweg (Johannesweg 4); es ist ein zwei-
geschossiger unverputzter Fachwerkbau mit
Ziegelfausfachung aus dem Jahre 1750 auf ho-
hem Elmkalksteinsockel, der stockwerksweise
abgezimmert und mit Eckstreben über zwei
Gefache und gleichhohem Erd- und Oberge-
schoß aufgeführt ist. Der regelmäßige Aufbau
mit sieben Fensterachsen an den Traufseiten
wurde Mitte des 19.Jh. bei der Errichtung einer
massiven Ziegelfassade auf der Westseite bei-
behalten. Ein mittiger Eingang, der sich auch
auf der Ostseite findet, wird hier durch einen
dreiachsigen Zwerchgiebel betont, während
sich die horizontale Gliederung auf ein durch-
laufendes Sohlbankgesims in rotem Sandstein
beschränkt. Von den dreiachsigen Giebelseiten
erhielt der Nordgiebel einen Ziegelbehang als
Wetterschutz.
Ein ehemaliges Backhaus auf der Ostseite
stammt wohl aus dem Anfang des 19.Jh. Etwa
an der Stelle, wo das Gemeindehaus errichtet
wurde, stand die ehemalige Pfarrscheune, und
weiter südlich war der Pfarrgarten angelegt, der
sich bis zur Schunter erstreckte. Die Bedeutung
und Größe der Anlage des Pfarrhofes, zu dem
auch ein Pfarrwitwenhaus und zwei Teiche im
Nordosten des Dorfes gehörten, ergibt sich
daraus, daß hier in der Zeit von 1557 bis 1625
fünf Äbte aus Riddagshausen wiederholt ge-
wohnt haben und nach der Zerstörung des Klo-
sters Riddagshausen 1606 Hondelage lange
Zeit Wohnsitz des Abtes Windruwe war, dessen
Frau in Hondelage beigesetzt wurde, wie eine
der Grabtafeln an der Kirche bezeugt.
Hondelage war über Jahrhunderte ein reines
Bauerndorf und bestand im Jahre 1605 abge-
sehen von Kirche, Pfarre, Pfarrwitwenhaus und
Hirtenhäusern lediglich aus den Höfen von fünf
Ackerleuten, drei Halbspännern und 22 Kotsas-
sen. Von den fünf Ackerleuten waren vier im
Jahre 1553 aus „Hägersdorf“ auf Veranlassung
des Klosters übergesiedelt. Riddagshausen
hatte bereits 1366 ein Gut in Hondelage und
kam 1384 in den Pfandbesitz der Hälfte des
Dorfes, 1483 verpfändete Lorenz von Honlage
auch seine übrigen Güter in Honlage und He-
gerdorf dem Kloster. Das urkundlich 1307 erst-
mals erwähnte und von den Herren von Honla-
ge gegründete „Hänersdorf“ war um 1505 wüst
geworden und wurde 1510 an Riddagshausen
veräußert. Die vier Hägersdorfer Ackerleute er-
hielten vom Kloster die Hofstellen Ass. Nrn. 13,
22, 23 und 25 im alten Ortskern zugewiesen -
eine Struktur, die sich in den heutigen Straßen-
namen „Hegerdorfstraße“, „Schaftrift“ und
„Dammstraße“ widerspiegelt und deren Verlauf
204