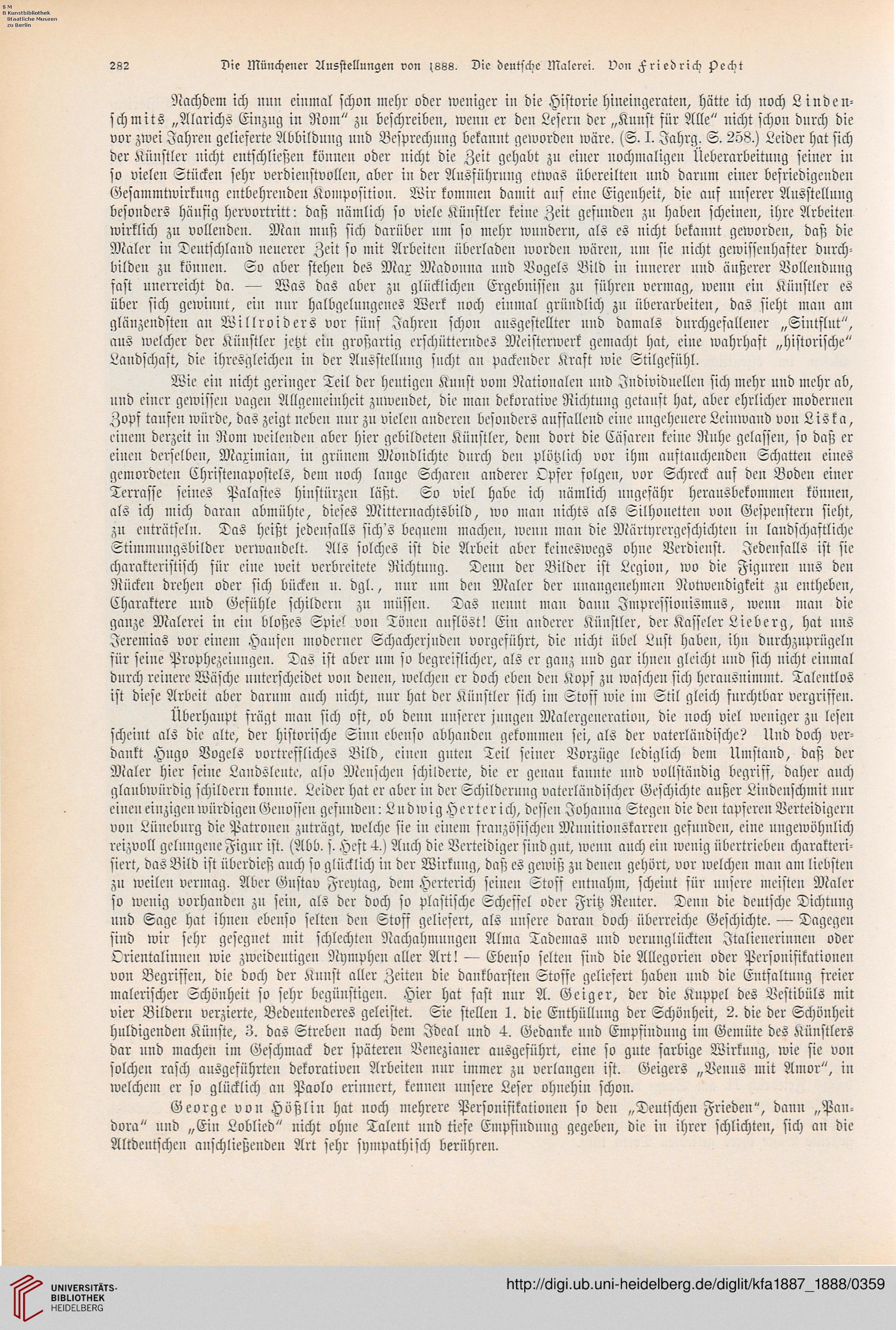282
Die Münchener Ausstellungen von ^888. Die deutsche Malerei. Von Friedrich Pecht
Nachdem ich nun einmal schon mehr oder weniger in die Historie hineingeraten, hätte ich noch Linden-
schmits „Alarichs Einzug in Rom" zn beschreiben, wenn er den Lesern der „Kunst für Alle" nicht schon durch die
vor zwei Jahren gelieferte Abbildung und Besprechung bekannt geworden wäre. (S-1. Jahrg. S. 258.) Leider hat sich
der Künstler nicht entschließen können oder nicht die Zeit gehabt zu einer nochmaligen Üeberarbeitung seiner in
so vielen Stücken sehr verdienstvollen, aber in der Ausführung etwas übereilten und darum einer befriedigenden
Gesammtwirkung entbehrenden Komposition. Wir kommen damit auf eine Eigenheit, die auf unserer Ausstellung
besonders häufig hervortritt: daß nämlich so viele Künstler keine Zeit gefunden zu haben scheinen, ihre Arbeiten
wirklich zu vollenden. Man muß sich darüber um so mehr wundern, als es nicht bekannt geworden, daß die
Maler in Deutschland neuerer Zeit so mit Arbeiten überladen worden wären, um sie nicht gewissenhafter durch-
bilden zu können. So aber stehen des Max Madonna und Vogels Bild in innerer und äußerer Vollendung
fast unerreicht da. — Was das aber zn glücklichen Ergebnissen zn führen vermag, wenn ein Künstler es
über sich gewinnt, ein nur halbgelnngenes Werk noch einmal gründlich zn überarbeiten, das sieht man am
glänzendsten an Willroiders vor fünf Jahren schon ausgestellter und damals durchgefallener „Sintflut",
aus welcher der Künstler jetzt ein großartig erschütterndes Meisterwerk gemacht hat, eine wahrhaft „historische"
Landschaft, die ihresgleichen in der Ausstellung sucht an packender Kraft wie Stilgefühl.
Wie ein nicht geringer Teil der heutigen Kunst vom Nationalen und Individuellen sich mehr und mehr ab,
und einer gewissen vagen Allgemeinheit zuwendet, die man dekorative Richtung getauft hat, aber ehrlicher modernen
Zopf taufen würde, das zeigt neben nur zu vielen anderen besonders auffallend eine ungeheuere Leinwand von Liska,
einem derzeit in Rom weilenden aber hier gebildeten Künstler, dem dort die Cäsaren keine Ruhe gelassen, so daß er
einen derselben, Maximian, in grünem Mondlichte durch den plötzlich vor ihm auftauchenden Schatten eines
gemordeten Christenapostels, dem noch lange Scharen anderer Opfer folgen, vor Schreck auf den Boden einer
Terrasse seines Palastes Hinstürzen läßt. So viel habe ich nämlich ungefähr herausbekommen können,
als ich mich daran abmühte, dieses Mitternachtsbild, wo man nichts als Silhouetten von Gespenstern sieht,
zn enträtseln. Das heißt jedenfalls sich's bequem machen, wenn man die Märtyrergeschichten in landschaftliche
Stimmnngsbilder verwandelt. Als solches ist die Arbeit aber keineswegs ohne Verdienst. Jedenfalls ist sie
charakteristisch für eine weit verbreitete Richtung. Denn der Bilder ist Legion, wo die Figuren uns den
Rücken drehen oder sich bücken n. dgl., nur um den Maler der unangenehmen Notwendigkeit zu entheben,
Charaktere und Gefühle schildern zn müssen. Das nennt man dann Impressionismus, wenn man die
ganze Malerei in ein bloßes Spiel von Tönen anflöst! Ein anderer Künstler, der Kasseler Lieberg, hat uns
Jeremias vor einem Hansen moderner Schacherjnden vorgeführt, die nicht übel Lust haben, ihn dnrchznprügeln
für seine Prophezeiungen. Das ist aber um so begreiflicher, als er ganz und gar ihnen gleicht und sich nicht einmal
durch reinere Wüsche unterscheidet von denen, welchen er doch eben den Kopf zu waschen sich heransnimmt. Talentlos
ist diese Arbeit aber darum auch nicht, nur hat der Künstler sich im Stoff wie im Stil gleich furchtbar vergriffen.
Überhaupt frägt man sich oft, ob denn unserer jungen Malergcneration, die noch viel weniger zu lesen
scheint als die alte, der historische Sinn ebenso abhanden gekommen sei, als der vaterländische? Und doch ver-
dankt Hugo Vogels vortreffliches Bild, einen guten Teil seiner Vorzüge lediglich dem Umstand, daß der
Maler hier seine Landsleute, also Menschen schilderte, die er genau kannte und vollständig begriff, daher auch
glaubwürdig schildern konnte. Leider hat er aber in der Schilderung vaterländischer Geschichte außer Lindenschmit nur
einen einzigen würdigen Genossen gefunden: Ludwig Herter ich, dessen Johanna Stegen die den tapferen Verteidigern
von Lüneburg die Patronen zuträgt, welche sie in einem französischen Mnnitionskarren gefunden, eine ungewöhnlich
reizvoll gelungene Figur ist. (Abb. s. Heft -l.) Auch die Verteidiger sind gut, wenn auch ein wenig übertrieben charakteri-
siert, das Bild ist überdies; auch so glücklich in der Wirkung, daß es gewiß zn denen gehört, vor welchen man am liebsten
zu weilen vermag. Aber Gustav Freytag, dem Herterich seinen Stoff entnahm, scheint für unsere meisten Maler
so wenig vorhanden zu sein, als der doch so plastische Scheffel oder Fritz Reuter. Denn die deutsche Dichtung
und Sage hat ihnen ebenso selten den Stoff geliefert, als unsere daran doch überreiche Geschichte. — Dagegen
sind wir sehr gesegnet mit schlechten Nachahmungen Alma Tademas und verunglückten Italienerinnen oder
Orientalinnen wie zweideutigen Nymphen aller Art! — Ebenso selten sind die Allegorien oder Personifikationen
von Begriffen, die doch der Kunst aller Zeiten die dankbarsten Stoffe geliefert haben und die Entfaltung freier
malerischer Schönheit so sehr begünstigen. Hier hat fast nur A. Geiger, der die Kuppel des Vestibüls mit
vier Bildern verzierte, Bedeutenderes geleistet. Sie stellen 1. die Enthüllung der Schönheit, 2. die der Schönheit
huldigenden Künste, 3. das Streben nach dem Ideal und 4. Gedanke und Empfindung im Gemüte des Künstlers
dar und machen im Geschmack der späteren Venezianer ausgeführt, eine so gute farbige Wirkung, wie sie von
solchen rasch ausgeführten dekorativen Arbeiten nur immer zu verlangen ist. Geigers „Venus mit Amor", in
welchem er so glücklich an Paolo erinnert, kennen unsere Leser ohnehin schon.
George von Hößlin hat noch mehrere Personifikationen so den „Deutschen Frieden", dann „Pan-
dora" und „Ein Loblied" nicht ohne Talent und tiefe Empfindung gegeben, die in ihrer schlichten, sich an die
Altdeutschen anschließenden Art sehr sympathisch berühren.
Die Münchener Ausstellungen von ^888. Die deutsche Malerei. Von Friedrich Pecht
Nachdem ich nun einmal schon mehr oder weniger in die Historie hineingeraten, hätte ich noch Linden-
schmits „Alarichs Einzug in Rom" zn beschreiben, wenn er den Lesern der „Kunst für Alle" nicht schon durch die
vor zwei Jahren gelieferte Abbildung und Besprechung bekannt geworden wäre. (S-1. Jahrg. S. 258.) Leider hat sich
der Künstler nicht entschließen können oder nicht die Zeit gehabt zu einer nochmaligen Üeberarbeitung seiner in
so vielen Stücken sehr verdienstvollen, aber in der Ausführung etwas übereilten und darum einer befriedigenden
Gesammtwirkung entbehrenden Komposition. Wir kommen damit auf eine Eigenheit, die auf unserer Ausstellung
besonders häufig hervortritt: daß nämlich so viele Künstler keine Zeit gefunden zu haben scheinen, ihre Arbeiten
wirklich zu vollenden. Man muß sich darüber um so mehr wundern, als es nicht bekannt geworden, daß die
Maler in Deutschland neuerer Zeit so mit Arbeiten überladen worden wären, um sie nicht gewissenhafter durch-
bilden zu können. So aber stehen des Max Madonna und Vogels Bild in innerer und äußerer Vollendung
fast unerreicht da. — Was das aber zn glücklichen Ergebnissen zn führen vermag, wenn ein Künstler es
über sich gewinnt, ein nur halbgelnngenes Werk noch einmal gründlich zn überarbeiten, das sieht man am
glänzendsten an Willroiders vor fünf Jahren schon ausgestellter und damals durchgefallener „Sintflut",
aus welcher der Künstler jetzt ein großartig erschütterndes Meisterwerk gemacht hat, eine wahrhaft „historische"
Landschaft, die ihresgleichen in der Ausstellung sucht an packender Kraft wie Stilgefühl.
Wie ein nicht geringer Teil der heutigen Kunst vom Nationalen und Individuellen sich mehr und mehr ab,
und einer gewissen vagen Allgemeinheit zuwendet, die man dekorative Richtung getauft hat, aber ehrlicher modernen
Zopf taufen würde, das zeigt neben nur zu vielen anderen besonders auffallend eine ungeheuere Leinwand von Liska,
einem derzeit in Rom weilenden aber hier gebildeten Künstler, dem dort die Cäsaren keine Ruhe gelassen, so daß er
einen derselben, Maximian, in grünem Mondlichte durch den plötzlich vor ihm auftauchenden Schatten eines
gemordeten Christenapostels, dem noch lange Scharen anderer Opfer folgen, vor Schreck auf den Boden einer
Terrasse seines Palastes Hinstürzen läßt. So viel habe ich nämlich ungefähr herausbekommen können,
als ich mich daran abmühte, dieses Mitternachtsbild, wo man nichts als Silhouetten von Gespenstern sieht,
zn enträtseln. Das heißt jedenfalls sich's bequem machen, wenn man die Märtyrergeschichten in landschaftliche
Stimmnngsbilder verwandelt. Als solches ist die Arbeit aber keineswegs ohne Verdienst. Jedenfalls ist sie
charakteristisch für eine weit verbreitete Richtung. Denn der Bilder ist Legion, wo die Figuren uns den
Rücken drehen oder sich bücken n. dgl., nur um den Maler der unangenehmen Notwendigkeit zu entheben,
Charaktere und Gefühle schildern zn müssen. Das nennt man dann Impressionismus, wenn man die
ganze Malerei in ein bloßes Spiel von Tönen anflöst! Ein anderer Künstler, der Kasseler Lieberg, hat uns
Jeremias vor einem Hansen moderner Schacherjnden vorgeführt, die nicht übel Lust haben, ihn dnrchznprügeln
für seine Prophezeiungen. Das ist aber um so begreiflicher, als er ganz und gar ihnen gleicht und sich nicht einmal
durch reinere Wüsche unterscheidet von denen, welchen er doch eben den Kopf zu waschen sich heransnimmt. Talentlos
ist diese Arbeit aber darum auch nicht, nur hat der Künstler sich im Stoff wie im Stil gleich furchtbar vergriffen.
Überhaupt frägt man sich oft, ob denn unserer jungen Malergcneration, die noch viel weniger zu lesen
scheint als die alte, der historische Sinn ebenso abhanden gekommen sei, als der vaterländische? Und doch ver-
dankt Hugo Vogels vortreffliches Bild, einen guten Teil seiner Vorzüge lediglich dem Umstand, daß der
Maler hier seine Landsleute, also Menschen schilderte, die er genau kannte und vollständig begriff, daher auch
glaubwürdig schildern konnte. Leider hat er aber in der Schilderung vaterländischer Geschichte außer Lindenschmit nur
einen einzigen würdigen Genossen gefunden: Ludwig Herter ich, dessen Johanna Stegen die den tapferen Verteidigern
von Lüneburg die Patronen zuträgt, welche sie in einem französischen Mnnitionskarren gefunden, eine ungewöhnlich
reizvoll gelungene Figur ist. (Abb. s. Heft -l.) Auch die Verteidiger sind gut, wenn auch ein wenig übertrieben charakteri-
siert, das Bild ist überdies; auch so glücklich in der Wirkung, daß es gewiß zn denen gehört, vor welchen man am liebsten
zu weilen vermag. Aber Gustav Freytag, dem Herterich seinen Stoff entnahm, scheint für unsere meisten Maler
so wenig vorhanden zu sein, als der doch so plastische Scheffel oder Fritz Reuter. Denn die deutsche Dichtung
und Sage hat ihnen ebenso selten den Stoff geliefert, als unsere daran doch überreiche Geschichte. — Dagegen
sind wir sehr gesegnet mit schlechten Nachahmungen Alma Tademas und verunglückten Italienerinnen oder
Orientalinnen wie zweideutigen Nymphen aller Art! — Ebenso selten sind die Allegorien oder Personifikationen
von Begriffen, die doch der Kunst aller Zeiten die dankbarsten Stoffe geliefert haben und die Entfaltung freier
malerischer Schönheit so sehr begünstigen. Hier hat fast nur A. Geiger, der die Kuppel des Vestibüls mit
vier Bildern verzierte, Bedeutenderes geleistet. Sie stellen 1. die Enthüllung der Schönheit, 2. die der Schönheit
huldigenden Künste, 3. das Streben nach dem Ideal und 4. Gedanke und Empfindung im Gemüte des Künstlers
dar und machen im Geschmack der späteren Venezianer ausgeführt, eine so gute farbige Wirkung, wie sie von
solchen rasch ausgeführten dekorativen Arbeiten nur immer zu verlangen ist. Geigers „Venus mit Amor", in
welchem er so glücklich an Paolo erinnert, kennen unsere Leser ohnehin schon.
George von Hößlin hat noch mehrere Personifikationen so den „Deutschen Frieden", dann „Pan-
dora" und „Ein Loblied" nicht ohne Talent und tiefe Empfindung gegeben, die in ihrer schlichten, sich an die
Altdeutschen anschließenden Art sehr sympathisch berühren.