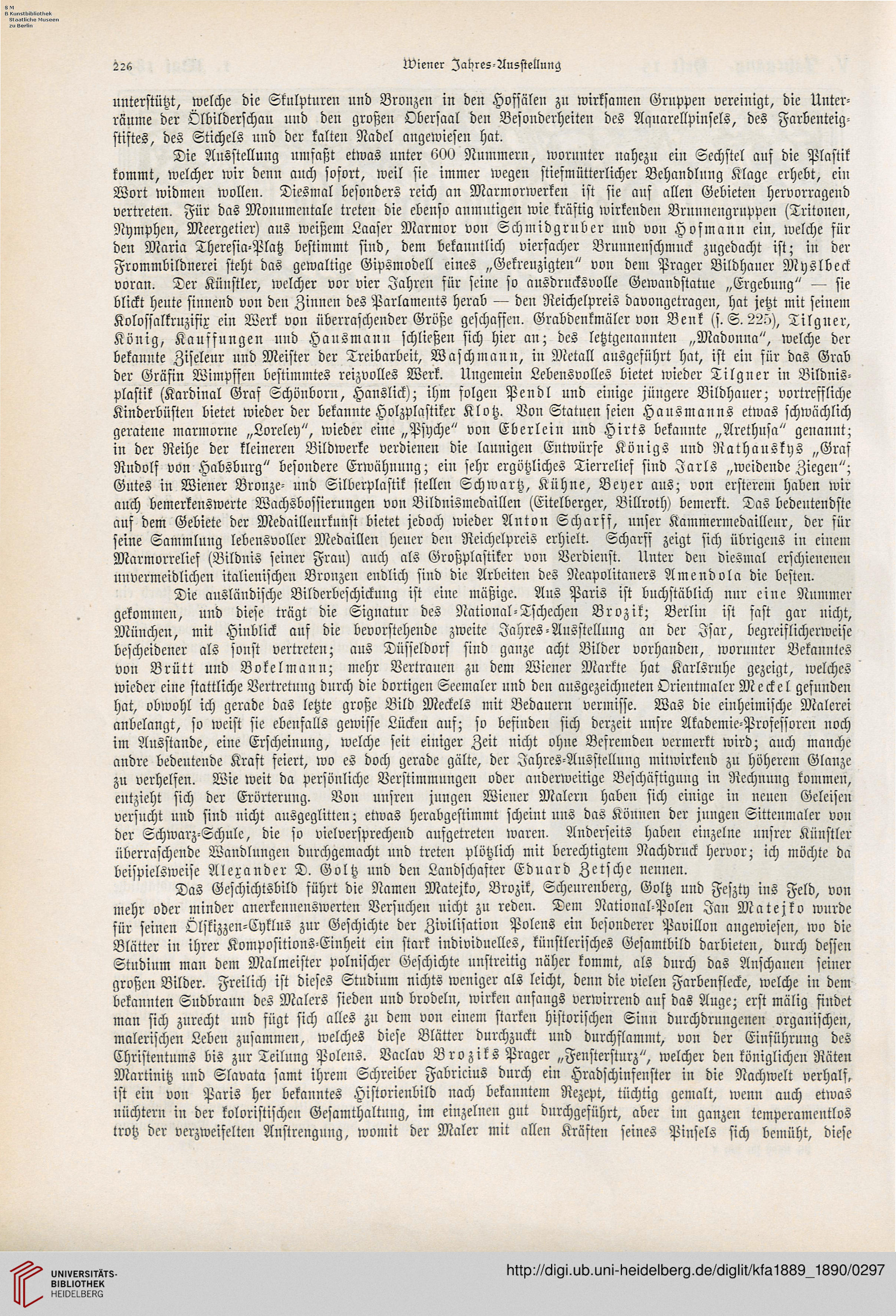Wiener Iahres-Ausstellung
226
unterstützt, welche die Skulpturen und Bronzen in den Hofsälen zu wirksamen Gruppen vereinigt, die Unter-
räume der Ölbilderschau und den großen Obersaal den Besonderheiten des Aguarellpinsels, des Farbenteig-
stiftes, des Stichels und der kalten Nadel angewiesen hat.
Die Ausstellung umfaßt etwas unter 600 Nummern, worunter nahezu ein Sechstel auf die Plastik
kommt, welcher wir denn auch sofort, weil sie immer wegen stiefmütterlicher Behandlung Klage erhebt, ein
Wort widmen wollen. Diesmal besonders reich an Marmorwerken ist sie ans allen Gebieten hervorragend
vertreten. Für das Monumentale treten die ebenso anmutigen wie kräftig wirkenden Brunnengruppen (Tritonen,
Nymphen, Meergetier) aus weißem Laaser Marmor von Schmidgruber und von Hofmann ein, welche für
den Maria Theresia-Platz bestimmt sind, dem bekanntlich vierfacher Brunnenschmuck zugedacht ist; in der
Frommbildnerei steht das gewaltige Gipsmodell eines „Gekreuzigten" von dem Prager Bildhauer Myslbeck
voran. Der Künstler, welcher vor vier Jahren für seine so ausdrucksvolle Gewandstatue „Ergebung" — sie
blickt heute sinnend von den Zinnen des Parlaments herab — den Reichelpreis davongetragen, hat jetzt mit seinem
Kolossalkruzifix ein Werk von überraschender Größe geschaffen. Grabdenkmäler von Benk (s. S. 220), Tilgner,
König, Kauffungen und Hausmann schließen sich hier an; des letztgenannten „Madonna", welche der
bekannte Ziseleur und Meister der Treibarbeit, Waschmann, in Metall ausgeführt hat, ist ein für das Grab
der Gräfin Wimpffen bestimmtes reizvolles Werk. Ungemein Lebensvolles bietet wieder Tilgner in Bildnis-
plastik (Kardinal Graf Schönborn, Hcmslick); ihm folgen Pen dl und einige jüngere Bildhauer; vortreffliche
Kinderbüsten bietet wieder der bekannte Holzplastiker Klotz. Von Statuen seien Hausmanns etwas schwächlich
geratene marmorne „Loreley", wieder eine „Psyche" von Eberlein und Hirts bekannte „Arethusa" genannt;
in der Reihe der kleineren Bildwerke verdienen die launigen Entwürfe Königs und Rathauskys „Graf
Rudolf von Habsburg" besondere Erwähnung; ein sehr ergötzliches Tierrelief sind Jarls „weidende Ziegen";
Gutes in Wiener Bronze- und Silberplastik stellen Schwartz, Kühne, Beyer ans; von ersterem haben wir
auch bemerkenswerte Wachsbossierungen von Bildnismedaillen (Eitelberger, Billroth) bemerkt. Das bedeutendste
auf dem Gebiete der Medailleurkunst bietet jedoch wieder Anton Scharfs, unser Kammermedailleur, der für
seine Sammlung lebensvoller Medaillen Heuer den Reichelpreis erhielt. Scharst zeigt sich übrigens in einem
Marmorrelief (Bildnis seiner Frau) auch als Großplastiker von Verdienst. Unter den diesmal erschienenen
unvermeidlichen italienischen Bronzen endlich sind die Arbeiten des Neapolitaners Amendola die besten.
Die ausländische Bilderbeschickung ist eine mäßige. Aus Paris ist buchstäblich nur eine Nummer
gekommen, und diese trägt die Signatur des National-Tschechen Brozik; Berlin ist fast gar nicht,
München, mit Hinblick auf die bevorstehende zweite Jahres-Ausstellung an der Isar, begreiflicherweise
bescheidener als sonst vertreten; aus Düsseldorf sind ganze acht Bilder vorhanden, worunter Bekanntes
von Brütt und Bokelmann; mehr Vertrauen zu dem Wiener Markte hat Karlsruhe gezeigt, welches
wieder eine stattliche Vertretung durch die dortigen Seemaler und den ausgezeichneten Orientmaler Meckel gefunden
hat, obwohl ich gerade das letzte große Bild Meckels mit Bedauern vermisse. Was die einheimische Malerei
anbelangt, so weist sie ebenfalls gewisse Lücken auf; so befinden sich derzeit unsre Akademie-Professoren noch
im Ausstande, eine Erscheinung, welche seit einiger Zeit nicht ohne Befremden vermerkt wird; auch manche
andre bedeutende Kraft feiert, wo es doch gerade gälte, der Jahres-Ausstellung milwirkend zu höherem Glanze
zu verhelfen. Wie weit da persönliche Verstimmungen oder anderweitige Beschäftigung in Rechnung kommen,
entzieht sich der Erörterung. Von unsren jungen Wiener Malern haben sich einige in neuen Geleisen
versucht und sind nicht ausgeglitten; etwas herabgestimmt scheint uns das Können der jungen Sittenmaler von
der Schwarz-Schule, die so vielversprechend aufgetreten waren. Anderseits haben einzelne unsrer Künstler
überraschende Wandlungen durchgemacht und treten plötzlich mit berechtigtem Nachdruck hervor; ich möchte da
beispielsweise Alexander D. Goltz und den Landschafter Eduard Zetsche nennen.
Das Geschichtsbild führt die Namen Matejko, Brozik, Scheurenberg, Goltz und Feszty ins Feld, von
mehr oder minder anerkennenswerten Versuchen nicht zu reden. Dem National-Polen Jan Matejko wurde
für seinen Ölskizzen-Cyklus zur Geschichte der Zivilisation Polens ein besonderer Pavillon angewiesen, wo die
Blätter in ihrer Kompositions-Einheit ein stark individuelles, künstlerisches Gesamtbild darbieten, durch dessen
Studium man dem Malmeister polnischer Geschichte unstreitig näher kommt, als durch das Anschauen seiner
großen Bilder. Freilich ist dieses Studium nichts weniger als leicht, denn die vielen Farbenflecke, welche in dem
bekannten Sudbraun des Malers sieden und brodeln, wirken anfangs verwirrend auf das Auge; erst mälig findet
man sich zurecht und fügt sich alles zu dem von einem starken historischen Sinn durchdrungenen organischen,
malerischen Leben zusammen, welches diese Blätter durchzuckt und durchslammt, von der Einführung des
Christentums bis zur Teilung Polens. Vaclav Broziks Prager „Fenstersturz", welcher den königlichen Räten
Martinitz und Slavata samt ihrem Schreiber Fabricius durch ein Hradschinfenster in die Nachwelt verhalf,
ist ein von Paris her bekanntes Historienbild nach bekanntem Rezept, tüchtig gemalt, wenn auch etwas
nüchtern in der koloristischen Gesamthaltung, im einzelnen gut durchgeführt, aber im ganzen temperamentlos
trotz der verzweifelten Anstrengung, womit der Maler mit allen Kräften seines Pinsels sich bemüht, diese
226
unterstützt, welche die Skulpturen und Bronzen in den Hofsälen zu wirksamen Gruppen vereinigt, die Unter-
räume der Ölbilderschau und den großen Obersaal den Besonderheiten des Aguarellpinsels, des Farbenteig-
stiftes, des Stichels und der kalten Nadel angewiesen hat.
Die Ausstellung umfaßt etwas unter 600 Nummern, worunter nahezu ein Sechstel auf die Plastik
kommt, welcher wir denn auch sofort, weil sie immer wegen stiefmütterlicher Behandlung Klage erhebt, ein
Wort widmen wollen. Diesmal besonders reich an Marmorwerken ist sie ans allen Gebieten hervorragend
vertreten. Für das Monumentale treten die ebenso anmutigen wie kräftig wirkenden Brunnengruppen (Tritonen,
Nymphen, Meergetier) aus weißem Laaser Marmor von Schmidgruber und von Hofmann ein, welche für
den Maria Theresia-Platz bestimmt sind, dem bekanntlich vierfacher Brunnenschmuck zugedacht ist; in der
Frommbildnerei steht das gewaltige Gipsmodell eines „Gekreuzigten" von dem Prager Bildhauer Myslbeck
voran. Der Künstler, welcher vor vier Jahren für seine so ausdrucksvolle Gewandstatue „Ergebung" — sie
blickt heute sinnend von den Zinnen des Parlaments herab — den Reichelpreis davongetragen, hat jetzt mit seinem
Kolossalkruzifix ein Werk von überraschender Größe geschaffen. Grabdenkmäler von Benk (s. S. 220), Tilgner,
König, Kauffungen und Hausmann schließen sich hier an; des letztgenannten „Madonna", welche der
bekannte Ziseleur und Meister der Treibarbeit, Waschmann, in Metall ausgeführt hat, ist ein für das Grab
der Gräfin Wimpffen bestimmtes reizvolles Werk. Ungemein Lebensvolles bietet wieder Tilgner in Bildnis-
plastik (Kardinal Graf Schönborn, Hcmslick); ihm folgen Pen dl und einige jüngere Bildhauer; vortreffliche
Kinderbüsten bietet wieder der bekannte Holzplastiker Klotz. Von Statuen seien Hausmanns etwas schwächlich
geratene marmorne „Loreley", wieder eine „Psyche" von Eberlein und Hirts bekannte „Arethusa" genannt;
in der Reihe der kleineren Bildwerke verdienen die launigen Entwürfe Königs und Rathauskys „Graf
Rudolf von Habsburg" besondere Erwähnung; ein sehr ergötzliches Tierrelief sind Jarls „weidende Ziegen";
Gutes in Wiener Bronze- und Silberplastik stellen Schwartz, Kühne, Beyer ans; von ersterem haben wir
auch bemerkenswerte Wachsbossierungen von Bildnismedaillen (Eitelberger, Billroth) bemerkt. Das bedeutendste
auf dem Gebiete der Medailleurkunst bietet jedoch wieder Anton Scharfs, unser Kammermedailleur, der für
seine Sammlung lebensvoller Medaillen Heuer den Reichelpreis erhielt. Scharst zeigt sich übrigens in einem
Marmorrelief (Bildnis seiner Frau) auch als Großplastiker von Verdienst. Unter den diesmal erschienenen
unvermeidlichen italienischen Bronzen endlich sind die Arbeiten des Neapolitaners Amendola die besten.
Die ausländische Bilderbeschickung ist eine mäßige. Aus Paris ist buchstäblich nur eine Nummer
gekommen, und diese trägt die Signatur des National-Tschechen Brozik; Berlin ist fast gar nicht,
München, mit Hinblick auf die bevorstehende zweite Jahres-Ausstellung an der Isar, begreiflicherweise
bescheidener als sonst vertreten; aus Düsseldorf sind ganze acht Bilder vorhanden, worunter Bekanntes
von Brütt und Bokelmann; mehr Vertrauen zu dem Wiener Markte hat Karlsruhe gezeigt, welches
wieder eine stattliche Vertretung durch die dortigen Seemaler und den ausgezeichneten Orientmaler Meckel gefunden
hat, obwohl ich gerade das letzte große Bild Meckels mit Bedauern vermisse. Was die einheimische Malerei
anbelangt, so weist sie ebenfalls gewisse Lücken auf; so befinden sich derzeit unsre Akademie-Professoren noch
im Ausstande, eine Erscheinung, welche seit einiger Zeit nicht ohne Befremden vermerkt wird; auch manche
andre bedeutende Kraft feiert, wo es doch gerade gälte, der Jahres-Ausstellung milwirkend zu höherem Glanze
zu verhelfen. Wie weit da persönliche Verstimmungen oder anderweitige Beschäftigung in Rechnung kommen,
entzieht sich der Erörterung. Von unsren jungen Wiener Malern haben sich einige in neuen Geleisen
versucht und sind nicht ausgeglitten; etwas herabgestimmt scheint uns das Können der jungen Sittenmaler von
der Schwarz-Schule, die so vielversprechend aufgetreten waren. Anderseits haben einzelne unsrer Künstler
überraschende Wandlungen durchgemacht und treten plötzlich mit berechtigtem Nachdruck hervor; ich möchte da
beispielsweise Alexander D. Goltz und den Landschafter Eduard Zetsche nennen.
Das Geschichtsbild führt die Namen Matejko, Brozik, Scheurenberg, Goltz und Feszty ins Feld, von
mehr oder minder anerkennenswerten Versuchen nicht zu reden. Dem National-Polen Jan Matejko wurde
für seinen Ölskizzen-Cyklus zur Geschichte der Zivilisation Polens ein besonderer Pavillon angewiesen, wo die
Blätter in ihrer Kompositions-Einheit ein stark individuelles, künstlerisches Gesamtbild darbieten, durch dessen
Studium man dem Malmeister polnischer Geschichte unstreitig näher kommt, als durch das Anschauen seiner
großen Bilder. Freilich ist dieses Studium nichts weniger als leicht, denn die vielen Farbenflecke, welche in dem
bekannten Sudbraun des Malers sieden und brodeln, wirken anfangs verwirrend auf das Auge; erst mälig findet
man sich zurecht und fügt sich alles zu dem von einem starken historischen Sinn durchdrungenen organischen,
malerischen Leben zusammen, welches diese Blätter durchzuckt und durchslammt, von der Einführung des
Christentums bis zur Teilung Polens. Vaclav Broziks Prager „Fenstersturz", welcher den königlichen Räten
Martinitz und Slavata samt ihrem Schreiber Fabricius durch ein Hradschinfenster in die Nachwelt verhalf,
ist ein von Paris her bekanntes Historienbild nach bekanntem Rezept, tüchtig gemalt, wenn auch etwas
nüchtern in der koloristischen Gesamthaltung, im einzelnen gut durchgeführt, aber im ganzen temperamentlos
trotz der verzweifelten Anstrengung, womit der Maler mit allen Kräften seines Pinsels sich bemüht, diese