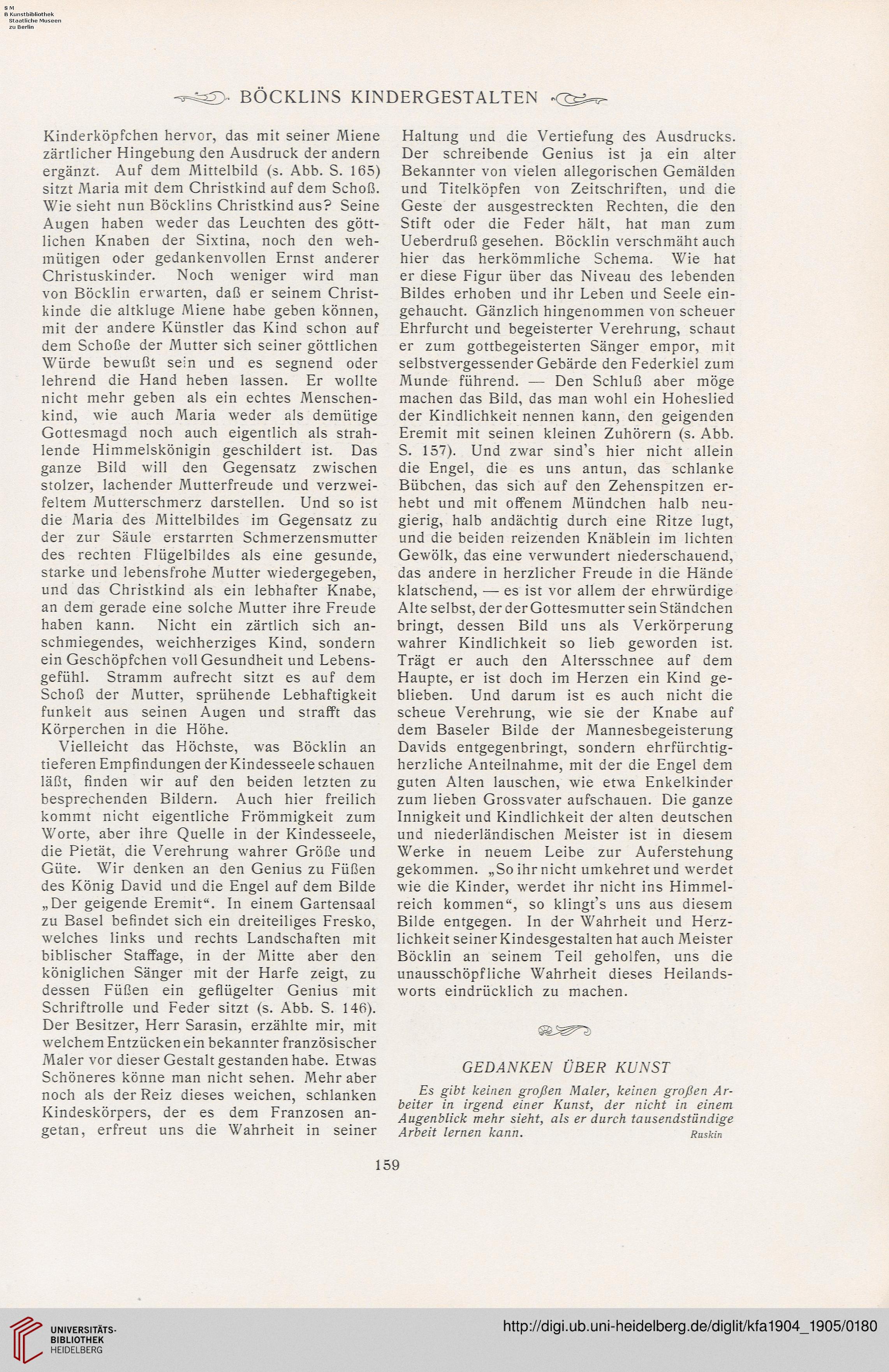BOCKLINS KINDERGESTALTEN <^=^
Kinderköpfchen hervor, das mit seiner Miene
zärtlicher Hingebung den Ausdruck der andern
ergänzt. Auf dem Mittelbild (s. Abb. S. 165)
sitzt Maria mit dem Christkind auf dem Schoß.
Wie sieht nun Böcküns Christkind aus? Seine
Augen haben weder das Leuchten des gött-
lichen Knaben der Sixtina, noch den weh-
mütigen oder gedankenvollen Ernst anderer
Christuskinder. Noch weniger wird man
von Böcklin erwarten, daß er seinem Christ-
kinde die altkluge Miene habe geben können,
mit der andere Künstler das Kind schon auf
dem Schöße der Mutter sich seiner göttlichen
Würde bewußt sein und es segnend oder
lehrend die Hand heben lassen. Er wollte
nicht mehr geben als ein echtes Menschen-
kind, wie auch Maria weder als demütige
Gottesmagd noch auch eigentlich als strah-
lende Himmelskönigin geschildert ist. Das
ganze Bild will den Gegensatz zwischen
stolzer, lachender Mutterfreude und verzwei-
feltem Mutterschmerz darstellen. Und so ist
die Maria des Mittelbildes im Gegensatz zu
der zur Säule erstarrten Schmerzensmutter
des rechten Flügelbildes als eine gesunde,
starke und lebensfrohe Mutter wiedergegeben,
und das Christkind als ein lebhafter Knabe,
an dem gerade eine solche Mutter ihre Freude
haben kann. Nicht ein zärtlich sich an-
schmiegendes, weichherziges Kind, sondern
ein Geschöpfchen voll Gesundheit und Lebens-
gefühl. Stramm aufrecht sitzt es auf dem
Schoß der Mutter, sprühende Lebhaftigkeit
funkelt aus seinen Augen und strafft das
Körperchen in die Höhe.
Vielleicht das Höchste, was Böcklin an
tieferen Empfindungen derKindesseele schauen
läßt, finden wir auf den beiden letzten zu
besprechenden Bildern. Auch hier freilich
kommt nicht eigentliche Frömmigkeit zum
Worte, aber ihre Quelle in der Kindesseele,
die Pietät, die Verehrung wahrer Größe und
Güte. Wir denken an den Genius zu Füßen
des König David und die Engel auf dem Bilde
„Der geigende Eremit". In einem Gartensaal
zu Basel befindet sich ein dreiteiliges Fresko,
welches links und rechts Landschaften mit
biblischer Staffage, in der Mitte aber den
königlichen Sänger mit der Harfe zeigt, zu
dessen Füßen ein geflügelter Genius mit
Schriftrolle und Feder sitzt (s. Abb. S. 146).
Der Besitzer, Herr Sarasin, erzählte mir, mit
welchem Entzücken ein bekannter französischer
Maler vor dieser Gestalt gestanden habe. Etwas
Schöneres könne man nicht sehen. Mehr aber
noch als der Reiz dieses weichen, schlanken
Kindeskörpers, der es dem Franzosen an-
getan, erfreut uns die Wahrheit in seiner
Haltung und die Vertiefung des Ausdrucks.
Der schreibende Genius ist ja ein alter
Bekannter von vielen allegorischen Gemälden
und Titelköpfen von Zeitschriften, und die
Geste der ausgestreckten Rechten, die den
Stift oder die Feder hält, hat man zum
Ueberdruß gesehen. Böcklin verschmähtauch
hier das herkömmliche Schema. Wie hat
er diese Figur über das Niveau des lebenden
Bildes erhoben und ihr Leben und Seele ein-
gehaucht. Gänzlich hingenommen von scheuer
Ehrfurcht und begeisterter Verehrung, schaut
er zum gottbegeisterten Sänger empor, mit
selbstvergessender Gebärde den Federkiel zum
Munde führend. — Den Schluß aber möge
machen das Bild, das man wohl ein Hoheslied
der Kindlichkeit nennen kann, den geigenden
Eremit mit seinen kleinen Zuhörern (s. Abb.
S. 157). Und zwar sind's hier nicht allein
die Engel, die es uns antun, das schlanke
Bübchen, das sich auf den Zehenspitzen er-
hebt und mit offenem Mündchen halb neu-
gierig, halb andächtig durch eine Ritze lugt,
und die beiden reizenden Knäblein im lichten
Gewölk, das eine verwundert niederschauend,
das andere in herzlicher Freude in die Hände
klatschend, — es ist vor allem der ehrwürdige
Alte selbst, der der Gottesmutter sein Ständchen
bringt, dessen Bild uns als Verkörperung
wahrer Kindlichkeit so lieb geworden ist.
Trägt er auch den Altersschnee auf dem
Haupte, er ist doch im Herzen ein Kind ge-
blieben. Und darum ist es auch nicht die
scheue Verehrung, wie sie der Knabe auf
dem Baseler Bilde der Mannesbegeisterung
Davids entgegenbringt, sondern ehrfürchtig-
herzliche Anteilnahme, mit der die Engel dem
guten Alten lauschen, wie etwa Enkelkinder
zum lieben Grossvater aufschauen. Die ganze
Innigkeit und Kindlichkeit der alten deutschen
und niederländischen Meister ist in diesem
Werke in neuem Leibe zur Auferstehung
gekommen. „So ihr nicht umkehret und werdet
wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmel-
reich kommen", so klingt's uns aus diesem
Bilde entgegen. In der Wahrheit und Herz-
lichkeit seiner Kindesgestalten hat auch Meister
Böcklin an seinem Teil geholfen, uns die
unausschöpfliehe Wahrheit dieses Heilands-
worts eindrücklich zu machen.
GEDANKEN ÜBER KUNST
Es gibt keinen großen Maler, keinen großen Ar-
beiter in irgend einer Kunst, der nicht in einem
Augenblick mehr sieht, als er durch tausendständige
Arbeit lernen kann. Ruskin
159
Kinderköpfchen hervor, das mit seiner Miene
zärtlicher Hingebung den Ausdruck der andern
ergänzt. Auf dem Mittelbild (s. Abb. S. 165)
sitzt Maria mit dem Christkind auf dem Schoß.
Wie sieht nun Böcküns Christkind aus? Seine
Augen haben weder das Leuchten des gött-
lichen Knaben der Sixtina, noch den weh-
mütigen oder gedankenvollen Ernst anderer
Christuskinder. Noch weniger wird man
von Böcklin erwarten, daß er seinem Christ-
kinde die altkluge Miene habe geben können,
mit der andere Künstler das Kind schon auf
dem Schöße der Mutter sich seiner göttlichen
Würde bewußt sein und es segnend oder
lehrend die Hand heben lassen. Er wollte
nicht mehr geben als ein echtes Menschen-
kind, wie auch Maria weder als demütige
Gottesmagd noch auch eigentlich als strah-
lende Himmelskönigin geschildert ist. Das
ganze Bild will den Gegensatz zwischen
stolzer, lachender Mutterfreude und verzwei-
feltem Mutterschmerz darstellen. Und so ist
die Maria des Mittelbildes im Gegensatz zu
der zur Säule erstarrten Schmerzensmutter
des rechten Flügelbildes als eine gesunde,
starke und lebensfrohe Mutter wiedergegeben,
und das Christkind als ein lebhafter Knabe,
an dem gerade eine solche Mutter ihre Freude
haben kann. Nicht ein zärtlich sich an-
schmiegendes, weichherziges Kind, sondern
ein Geschöpfchen voll Gesundheit und Lebens-
gefühl. Stramm aufrecht sitzt es auf dem
Schoß der Mutter, sprühende Lebhaftigkeit
funkelt aus seinen Augen und strafft das
Körperchen in die Höhe.
Vielleicht das Höchste, was Böcklin an
tieferen Empfindungen derKindesseele schauen
läßt, finden wir auf den beiden letzten zu
besprechenden Bildern. Auch hier freilich
kommt nicht eigentliche Frömmigkeit zum
Worte, aber ihre Quelle in der Kindesseele,
die Pietät, die Verehrung wahrer Größe und
Güte. Wir denken an den Genius zu Füßen
des König David und die Engel auf dem Bilde
„Der geigende Eremit". In einem Gartensaal
zu Basel befindet sich ein dreiteiliges Fresko,
welches links und rechts Landschaften mit
biblischer Staffage, in der Mitte aber den
königlichen Sänger mit der Harfe zeigt, zu
dessen Füßen ein geflügelter Genius mit
Schriftrolle und Feder sitzt (s. Abb. S. 146).
Der Besitzer, Herr Sarasin, erzählte mir, mit
welchem Entzücken ein bekannter französischer
Maler vor dieser Gestalt gestanden habe. Etwas
Schöneres könne man nicht sehen. Mehr aber
noch als der Reiz dieses weichen, schlanken
Kindeskörpers, der es dem Franzosen an-
getan, erfreut uns die Wahrheit in seiner
Haltung und die Vertiefung des Ausdrucks.
Der schreibende Genius ist ja ein alter
Bekannter von vielen allegorischen Gemälden
und Titelköpfen von Zeitschriften, und die
Geste der ausgestreckten Rechten, die den
Stift oder die Feder hält, hat man zum
Ueberdruß gesehen. Böcklin verschmähtauch
hier das herkömmliche Schema. Wie hat
er diese Figur über das Niveau des lebenden
Bildes erhoben und ihr Leben und Seele ein-
gehaucht. Gänzlich hingenommen von scheuer
Ehrfurcht und begeisterter Verehrung, schaut
er zum gottbegeisterten Sänger empor, mit
selbstvergessender Gebärde den Federkiel zum
Munde führend. — Den Schluß aber möge
machen das Bild, das man wohl ein Hoheslied
der Kindlichkeit nennen kann, den geigenden
Eremit mit seinen kleinen Zuhörern (s. Abb.
S. 157). Und zwar sind's hier nicht allein
die Engel, die es uns antun, das schlanke
Bübchen, das sich auf den Zehenspitzen er-
hebt und mit offenem Mündchen halb neu-
gierig, halb andächtig durch eine Ritze lugt,
und die beiden reizenden Knäblein im lichten
Gewölk, das eine verwundert niederschauend,
das andere in herzlicher Freude in die Hände
klatschend, — es ist vor allem der ehrwürdige
Alte selbst, der der Gottesmutter sein Ständchen
bringt, dessen Bild uns als Verkörperung
wahrer Kindlichkeit so lieb geworden ist.
Trägt er auch den Altersschnee auf dem
Haupte, er ist doch im Herzen ein Kind ge-
blieben. Und darum ist es auch nicht die
scheue Verehrung, wie sie der Knabe auf
dem Baseler Bilde der Mannesbegeisterung
Davids entgegenbringt, sondern ehrfürchtig-
herzliche Anteilnahme, mit der die Engel dem
guten Alten lauschen, wie etwa Enkelkinder
zum lieben Grossvater aufschauen. Die ganze
Innigkeit und Kindlichkeit der alten deutschen
und niederländischen Meister ist in diesem
Werke in neuem Leibe zur Auferstehung
gekommen. „So ihr nicht umkehret und werdet
wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Himmel-
reich kommen", so klingt's uns aus diesem
Bilde entgegen. In der Wahrheit und Herz-
lichkeit seiner Kindesgestalten hat auch Meister
Böcklin an seinem Teil geholfen, uns die
unausschöpfliehe Wahrheit dieses Heilands-
worts eindrücklich zu machen.
GEDANKEN ÜBER KUNST
Es gibt keinen großen Maler, keinen großen Ar-
beiter in irgend einer Kunst, der nicht in einem
Augenblick mehr sieht, als er durch tausendständige
Arbeit lernen kann. Ruskin
159