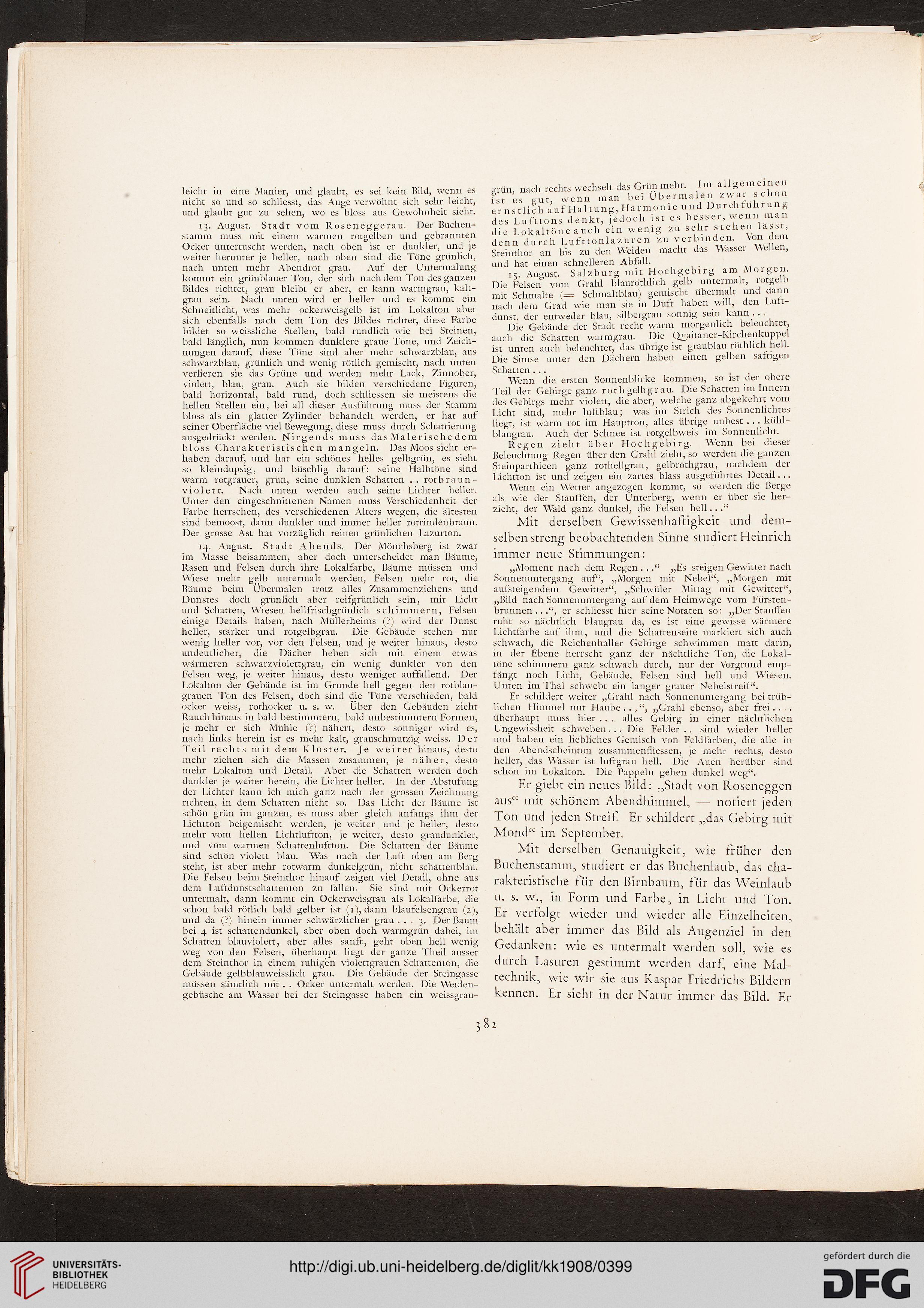leicht in eine Manier, und glaubt, es sei kein Bild, wenn es
nicht so und so schliesst, das Auge verwöhnt sich sehr leicht,
und glaubt gut zu sehen, wo es bloss aus Gewohnheit sieht.
13. August. Stadt vom Roseneggerau. Der Buchen-
stamm muss mit einem warmen rotgelben und gebrannten
Ocker untertuscht werden, nach oben ist er dunkler, und je
weiter herunter je heller, nach oben sind die 'Jone grünlich,
nach unten mehr Abendrot grau. Auf der Untermalung
kommt ein grünblauer Ton, der sich nachdem Ton des ganzen
Bildes richtet, grau bleibt er aber, er kann warmgrau, kalt-
grau sein. Nach unten wird er heller und es kommt ein
Schneiflicht, was mehr ockerweisgelb ist im Lokalton aber
sich ebenfalls nach dem Ton des Bildes richtet, diese Farbe
bildet so weissliche Stellen, bald rundlich wie bei Steinen,
bald länglich, nun kommen dunklere graue Töne, und Zeich-
nungen darauf, diese Töne sind aber mehr schwarzblau, aus
schwarzblau, grünlich und wenig rötlich gemischt, nach unten
verlieren sie das Grüne und werden mehr Lack, Zinnober,
violett, blau, grau. Auch sie bilden verschiedene Figuren,
bald horizontal, bald rund, doch schliessen sie meistens die
hellen Stellen ein, bei all dieser Ausführung muss der Stamm
bloss als ein glatter Zylinder behandelt werden, er hat auf
seiner Oberfläche viel Bewegung, diese muss durch Schattierung
ausgedrückt werden. Nirgends muss d a s M a 1 e r i s c h e d e m
bloss Charakteristischen mangeln. Das iVloos sieht er-
haben darauf, und hat ein schönes helles gelbgrün, es sieht
so kleindupsig, und büschlig darauf: seine Halbtöne sind
warm rotgrauer, grün, seine dunklen Schatten .. rotbraun-
violett. Nach unten werden auch seine Lichter heller.
Unter den eingeschnittenen Namen muss Verschiedenheit der
Farbe herrschen, des verschiedenen Alters wegen, die ältesten
sind bemoost, dann dunkler und immer heller rotrindenbraun.
Der grosse Ast hat vorzüglich reinen grünlichen Lazurton.
14. August. Stadt Abends. Der Mönchsberg ist zwar
im Masse beisammen, aber doch unterscheidet man Bäume,
Rasen und Felsen durch ihre Lokalfarbe, Bäume müssen und
Wiese mehr gelb untermalt werden, Felsen mehr rot, die
Bäume beim Übermalen trotz alles Zusammenziehens und
Dunstes doch grünlich aber reifgrünlich sein, mit Licht
und Schatten, Wiesen hellfrischgrünlich schimmern, Felsen
einige Details haben, nach Müllerheims (?) wird der Dunst
heller, stärker und rotgelbgrau. Die Gebäude stehen nur
wenig heller vor, vor den Felsen, und je weiter hinaus, desto
undeutlicher, die Dächer heben sich mit einem etwas
wärmeren schwarzviolettgrau, ein wenig dunkler von den
Felsen weg, je weiter hinaus, desto weniger auffallend. Der
Lokalton der Gebäude ist im Grunde hell gegen den rotblau-
grauen Ton des Felsen, doch sind die Töne verschieden, bald
ocker weiss, rothocker u. s. w. Über den Gebäuden zieht
Rauch hinaus in bald bestimmtem, bald unbestimmtem Formen,
je mehr er sich Mühle (?) nähert, desto sonniger wird es,
nach links herein ist es mehr kalt, grauschmutzig weiss. Der
'Feil rechts mit dem Kloster. Je weiter hinaus, desto
mehr ziehen sich die Massen zusammen, je näher, desto
mehr Lokalton und Detail. Aber die Schatten werden doch
dunkler je weiter herein, die Lichter heller. In der Abstufung
der Lichter kann ich mich ganz nach der grossen Zeichnung
richten, in dem Schatten nicht so. Das Licht der Bäume ist
schön grün im ganzen, es muss aber gleich anfangs ihm der
Lichtton beigemischt werden, je weiter und je heller, desto
mehr vom hellen Lichtluftton, je weiter, desto graudunkler,
und vom warmen Schattenluftton. Die Schatten der Bäume
sind schön violett blau. Was nach der Luft oben am Berg
steht, ist aber mehr rotwarm dunkelgrün, nicht schattenblau.
Die Felsen beim Steinthor hinauf zeigen viel Detail, ohne aus
dem Luftdunstschattenton zu fallen. Sie sind mit Ockerrot
untermalt, dann kommt ein Ockerweisgrau als Lokalfarbe, die
schon bald rötlich bald gelber ist (1), dann blaufelsengrau (2),
und da (?) hinein immer schwärzlicher grau ... 3. Der Baum
bei 4 ist schattendunkel, aber oben doch warmgrün dabei, im
Schatten blauviolett, aber alles sanft, geht oben hell wenig
weg von den Felsen, überhaupt liegt der ganze Theil ausser
dem Steinthor in einem ruhigen violettgrauen Schattenton, die
Gebäude gelbblauweisslich grau. Die Gebäude der Steingasse
müssen sämtlich mit . . Ocker untermalt werden. Die Weiden-
gebüsche am Wasser bei der Steingasse haben ein weissgrau-
grün, „ach rechts wechselt das Grün mehr. Im allgemeinen
ist es gut, wenn man bei Übermalen zwar schon
ernstlich auf Haltung, Harmonie und Durchfuhrung
des Lufttons denkt, jedoch ist es besser, wenn man
die Lokaltöncauch ein wenig zu sehr stehen asst
denn durch Lufttonlazuren zu verbinden. Von dem
Steinthor an bis zu den Weiden macht das Wisser Wellen,
und hat einen schnelleren Abfall.
k. August. Salzburg mit Hochgebirg am Morgen.
Die Felsen vom Grahl blauröthlich gelb untermalt, rotgelb
mit Schmälte (= Schmaltblau) gemischt übermalt und dann
nach dem Grad wie man sie in Duft haben will, den Lutt-
dunst, der entweder blau, silbergrau sonnig sein kann ...
Die Gebäude der Stadt recht warm morgenlich beleuchtet,
auch die Schatten warmgrau. Die (^aitaner-Kirchenkuppel
ist unten auch beleuchtet, das übrigeist graublau rofhhch hell.
Die Simse unter den Dächern haben einen gelben saftigen
Schatten... .
Wenn die ersten Sonnenblicke kommen, so ist der obere
Teil der Gebirge ganz rot h gelbgrau. Die Schatten im Innern
des Gebirgs mehr violett, die aber, welche ganz abgekehrt vom
Licht sind, mehr luftblau; was im Strich des Sonnenlichtes
liegt, ist wann rot im Hauptton, alles übrige unbest ... kühl-
blaugrau. Auch der Schnee ist rotgelbweis im Sonnenlicht.
Regen zieht über Hochgebirg. Wenn bei dieser
Beleuchtung Regen über den Grahl zieht, so werden die ganzen
Steinparthieen ganz rothellgrau, gelbrothgrau, nachdem der
Lichtton ist und zeigen ein zartes blass ausgeführtes Detail. ..
Wenn ein Wetter angezogen kommt, so werden die Berge
als wie der Stauffen, der Unterberg, wenn er über sie her-
zieht, der Wald ganz dunkel, die Felsen hell. . ."
Mit derselben Gewissenhaftigkeit und dem-
selben streng beobachtenden Sinne studiert Heinrich
immer neue Stimmungen:
„Moment nach dem Regen . . ." „Fs steigen Gewitter nach
Sonnenuntergang auf", „Morgen mit Nebel", „Morgen mit
aufsteigendem Gewitter", „Schwüler Mittag mit Gewitter",
„Bild nach Sonnenuntergang auf dem Heimwege vom Fürsten-
brunnen .. .", er schliesst hier seine Notaten so: „Der Stauffen
ruht so nächtlich blaugrau da, es ist eine gewisse wärmere
Lichtfarbe auf ihm, und die Schattenseite markiert sich auch
schwach, die Reichenhaller Gebirge schwimmen matt darin,
in der Ebene herrscht ganz der nächtliche Ton, die Lokal-
töne schimmern ganz schwach durch, nur der Vorgrund emp-
fängt noch Licht, Gebäude, Felsen sind hell und Wiesen.
Unten im Thal schwebt ein langer grauer Nebelstreif".
Er schildert weiter „Grahl nach Sonnenuntergang bei trüb-
lichen Himmel mit Haube . . ,", „Grahl ebenso, aber frei....
überhaupt muss hier . . . alles Gebirg in einer nächtlichen
Ungewissheit schweben... Die Felder., sind wieder heller
und haben ein liebliches Gemisch von Feldfarben, die alle in
den Abendscheinton zusammenmessen, je mehr rechts, desto
heller, das Wasser ist luftgrau hell. Die Auen herüber sind
schon im Lokalton. Die Pappeln gehen dunkel weg".
Er giebt ein neues Bild: „Stadt von Roseneggen
aus" mit schönem Abendhimmel, — notiert jeden
Ton und jeden Streif. Er schildert „das Gebirg mit
Mond" im September.
Mit derselben Genauigkeit, wie früher den
Buchenstamm, studiert er das Buchenlaub, das cha-
rakteristische für den Birnbaum, für das Weinlaub
u. s. w., in Form und Farbe, in Licht und Ton.
Er verfolgt wieder und wieder alle Einzelheiten,
behält aber immer das Bild als Augenziel in den
Gedanken: wie es untermalt werden soll, wie es
durch Lasuren gestimmt werden darf, eine Mal-
technik, wie wir sie aus Kaspar Friedrichs Bildern
kennen. Er sieht in der Natur immer das Bild. Er
nicht so und so schliesst, das Auge verwöhnt sich sehr leicht,
und glaubt gut zu sehen, wo es bloss aus Gewohnheit sieht.
13. August. Stadt vom Roseneggerau. Der Buchen-
stamm muss mit einem warmen rotgelben und gebrannten
Ocker untertuscht werden, nach oben ist er dunkler, und je
weiter herunter je heller, nach oben sind die 'Jone grünlich,
nach unten mehr Abendrot grau. Auf der Untermalung
kommt ein grünblauer Ton, der sich nachdem Ton des ganzen
Bildes richtet, grau bleibt er aber, er kann warmgrau, kalt-
grau sein. Nach unten wird er heller und es kommt ein
Schneiflicht, was mehr ockerweisgelb ist im Lokalton aber
sich ebenfalls nach dem Ton des Bildes richtet, diese Farbe
bildet so weissliche Stellen, bald rundlich wie bei Steinen,
bald länglich, nun kommen dunklere graue Töne, und Zeich-
nungen darauf, diese Töne sind aber mehr schwarzblau, aus
schwarzblau, grünlich und wenig rötlich gemischt, nach unten
verlieren sie das Grüne und werden mehr Lack, Zinnober,
violett, blau, grau. Auch sie bilden verschiedene Figuren,
bald horizontal, bald rund, doch schliessen sie meistens die
hellen Stellen ein, bei all dieser Ausführung muss der Stamm
bloss als ein glatter Zylinder behandelt werden, er hat auf
seiner Oberfläche viel Bewegung, diese muss durch Schattierung
ausgedrückt werden. Nirgends muss d a s M a 1 e r i s c h e d e m
bloss Charakteristischen mangeln. Das iVloos sieht er-
haben darauf, und hat ein schönes helles gelbgrün, es sieht
so kleindupsig, und büschlig darauf: seine Halbtöne sind
warm rotgrauer, grün, seine dunklen Schatten .. rotbraun-
violett. Nach unten werden auch seine Lichter heller.
Unter den eingeschnittenen Namen muss Verschiedenheit der
Farbe herrschen, des verschiedenen Alters wegen, die ältesten
sind bemoost, dann dunkler und immer heller rotrindenbraun.
Der grosse Ast hat vorzüglich reinen grünlichen Lazurton.
14. August. Stadt Abends. Der Mönchsberg ist zwar
im Masse beisammen, aber doch unterscheidet man Bäume,
Rasen und Felsen durch ihre Lokalfarbe, Bäume müssen und
Wiese mehr gelb untermalt werden, Felsen mehr rot, die
Bäume beim Übermalen trotz alles Zusammenziehens und
Dunstes doch grünlich aber reifgrünlich sein, mit Licht
und Schatten, Wiesen hellfrischgrünlich schimmern, Felsen
einige Details haben, nach Müllerheims (?) wird der Dunst
heller, stärker und rotgelbgrau. Die Gebäude stehen nur
wenig heller vor, vor den Felsen, und je weiter hinaus, desto
undeutlicher, die Dächer heben sich mit einem etwas
wärmeren schwarzviolettgrau, ein wenig dunkler von den
Felsen weg, je weiter hinaus, desto weniger auffallend. Der
Lokalton der Gebäude ist im Grunde hell gegen den rotblau-
grauen Ton des Felsen, doch sind die Töne verschieden, bald
ocker weiss, rothocker u. s. w. Über den Gebäuden zieht
Rauch hinaus in bald bestimmtem, bald unbestimmtem Formen,
je mehr er sich Mühle (?) nähert, desto sonniger wird es,
nach links herein ist es mehr kalt, grauschmutzig weiss. Der
'Feil rechts mit dem Kloster. Je weiter hinaus, desto
mehr ziehen sich die Massen zusammen, je näher, desto
mehr Lokalton und Detail. Aber die Schatten werden doch
dunkler je weiter herein, die Lichter heller. In der Abstufung
der Lichter kann ich mich ganz nach der grossen Zeichnung
richten, in dem Schatten nicht so. Das Licht der Bäume ist
schön grün im ganzen, es muss aber gleich anfangs ihm der
Lichtton beigemischt werden, je weiter und je heller, desto
mehr vom hellen Lichtluftton, je weiter, desto graudunkler,
und vom warmen Schattenluftton. Die Schatten der Bäume
sind schön violett blau. Was nach der Luft oben am Berg
steht, ist aber mehr rotwarm dunkelgrün, nicht schattenblau.
Die Felsen beim Steinthor hinauf zeigen viel Detail, ohne aus
dem Luftdunstschattenton zu fallen. Sie sind mit Ockerrot
untermalt, dann kommt ein Ockerweisgrau als Lokalfarbe, die
schon bald rötlich bald gelber ist (1), dann blaufelsengrau (2),
und da (?) hinein immer schwärzlicher grau ... 3. Der Baum
bei 4 ist schattendunkel, aber oben doch warmgrün dabei, im
Schatten blauviolett, aber alles sanft, geht oben hell wenig
weg von den Felsen, überhaupt liegt der ganze Theil ausser
dem Steinthor in einem ruhigen violettgrauen Schattenton, die
Gebäude gelbblauweisslich grau. Die Gebäude der Steingasse
müssen sämtlich mit . . Ocker untermalt werden. Die Weiden-
gebüsche am Wasser bei der Steingasse haben ein weissgrau-
grün, „ach rechts wechselt das Grün mehr. Im allgemeinen
ist es gut, wenn man bei Übermalen zwar schon
ernstlich auf Haltung, Harmonie und Durchfuhrung
des Lufttons denkt, jedoch ist es besser, wenn man
die Lokaltöncauch ein wenig zu sehr stehen asst
denn durch Lufttonlazuren zu verbinden. Von dem
Steinthor an bis zu den Weiden macht das Wisser Wellen,
und hat einen schnelleren Abfall.
k. August. Salzburg mit Hochgebirg am Morgen.
Die Felsen vom Grahl blauröthlich gelb untermalt, rotgelb
mit Schmälte (= Schmaltblau) gemischt übermalt und dann
nach dem Grad wie man sie in Duft haben will, den Lutt-
dunst, der entweder blau, silbergrau sonnig sein kann ...
Die Gebäude der Stadt recht warm morgenlich beleuchtet,
auch die Schatten warmgrau. Die (^aitaner-Kirchenkuppel
ist unten auch beleuchtet, das übrigeist graublau rofhhch hell.
Die Simse unter den Dächern haben einen gelben saftigen
Schatten... .
Wenn die ersten Sonnenblicke kommen, so ist der obere
Teil der Gebirge ganz rot h gelbgrau. Die Schatten im Innern
des Gebirgs mehr violett, die aber, welche ganz abgekehrt vom
Licht sind, mehr luftblau; was im Strich des Sonnenlichtes
liegt, ist wann rot im Hauptton, alles übrige unbest ... kühl-
blaugrau. Auch der Schnee ist rotgelbweis im Sonnenlicht.
Regen zieht über Hochgebirg. Wenn bei dieser
Beleuchtung Regen über den Grahl zieht, so werden die ganzen
Steinparthieen ganz rothellgrau, gelbrothgrau, nachdem der
Lichtton ist und zeigen ein zartes blass ausgeführtes Detail. ..
Wenn ein Wetter angezogen kommt, so werden die Berge
als wie der Stauffen, der Unterberg, wenn er über sie her-
zieht, der Wald ganz dunkel, die Felsen hell. . ."
Mit derselben Gewissenhaftigkeit und dem-
selben streng beobachtenden Sinne studiert Heinrich
immer neue Stimmungen:
„Moment nach dem Regen . . ." „Fs steigen Gewitter nach
Sonnenuntergang auf", „Morgen mit Nebel", „Morgen mit
aufsteigendem Gewitter", „Schwüler Mittag mit Gewitter",
„Bild nach Sonnenuntergang auf dem Heimwege vom Fürsten-
brunnen .. .", er schliesst hier seine Notaten so: „Der Stauffen
ruht so nächtlich blaugrau da, es ist eine gewisse wärmere
Lichtfarbe auf ihm, und die Schattenseite markiert sich auch
schwach, die Reichenhaller Gebirge schwimmen matt darin,
in der Ebene herrscht ganz der nächtliche Ton, die Lokal-
töne schimmern ganz schwach durch, nur der Vorgrund emp-
fängt noch Licht, Gebäude, Felsen sind hell und Wiesen.
Unten im Thal schwebt ein langer grauer Nebelstreif".
Er schildert weiter „Grahl nach Sonnenuntergang bei trüb-
lichen Himmel mit Haube . . ,", „Grahl ebenso, aber frei....
überhaupt muss hier . . . alles Gebirg in einer nächtlichen
Ungewissheit schweben... Die Felder., sind wieder heller
und haben ein liebliches Gemisch von Feldfarben, die alle in
den Abendscheinton zusammenmessen, je mehr rechts, desto
heller, das Wasser ist luftgrau hell. Die Auen herüber sind
schon im Lokalton. Die Pappeln gehen dunkel weg".
Er giebt ein neues Bild: „Stadt von Roseneggen
aus" mit schönem Abendhimmel, — notiert jeden
Ton und jeden Streif. Er schildert „das Gebirg mit
Mond" im September.
Mit derselben Genauigkeit, wie früher den
Buchenstamm, studiert er das Buchenlaub, das cha-
rakteristische für den Birnbaum, für das Weinlaub
u. s. w., in Form und Farbe, in Licht und Ton.
Er verfolgt wieder und wieder alle Einzelheiten,
behält aber immer das Bild als Augenziel in den
Gedanken: wie es untermalt werden soll, wie es
durch Lasuren gestimmt werden darf, eine Mal-
technik, wie wir sie aus Kaspar Friedrichs Bildern
kennen. Er sieht in der Natur immer das Bild. Er