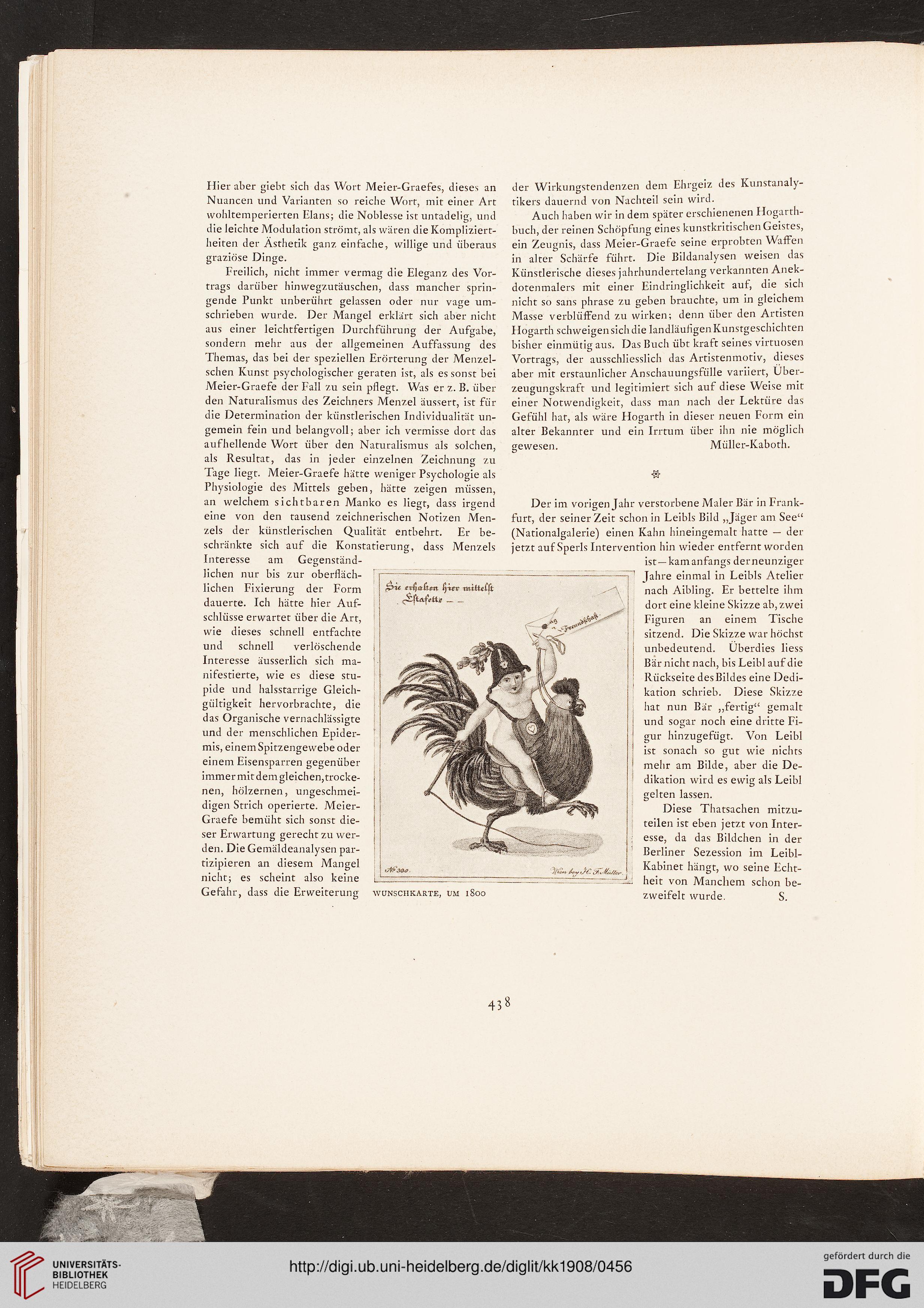Hier aber giebt sich das Wort Meier-Graefes, dieses an
Nuancen und Varianten so reiche Wort, mit einer Art
wohltemperierten Elans; die Noblesse ist untadelig, und
die leichte Modulation strömt, als wären die Kompliziert-
heiten der Ästhetik ganz einfache, willige und überaus
graziöse Dinge.
Freilich, nicht immer vermag die Eleganz des Vor-
trags darüber hinwegzutäuschen, dass mancher sprin-
gende Punkt unberührt gelassen oder nur vage um-
schrieben wurde. Der Mangel erklärt sich aber nicht
aus einer leichtfertigen Durchführung der Aufgabe,
sondern mehr aus der allgemeinen Auffassung des
Themas, das bei der speziellen Erörterung der Menzel-
schen Kunst psychologischer geraten ist, als es sonst bei
Meier-Graefe der Fall zu sein pflegt. Was er z. B. über
den Naturalismus des Zeichners Menzel äussert, ist für
die Determination der künstlerischen Individualität un-
gemein fein und belangvoll; aber ich vermisse dort das
aufhellende Wort über den Naturalismus als solchen,
als Resultat, das in jeder einzelnen Zeichnung zu
Tage liegt. Meier-Graefe hätte weniger Psychologie als
Physiologie des Mittels geben, hätte zeigen müssen,
an welchem sichtbaren Manko es liegt, dass irgend
eine von den tausend zeichnerischen Notizen Men-
zels der künstlerischen Qualität entbehrt. Er be-
schränkte sich auf die Konstatierung, dass Menzels
Interesse am Gegenständ-
lichen nur bis zur oberfläch-
lichen Fixierung der Form
dauerte. Ich hätte hier Auf-
schlüsse erwartet über die Art,
wie dieses schnell entfachte
und schnell verlöschende
Interesse äusserlich sich ma-
nifestierte, wie es diese stu-
pide und halsstarrige Gleich-
gültigkeit hervorbrachte, die
das Organische vernachlässigte
und der menschlichen Epider-
mis, einem Spitzengewebe oder
einem Eisensparren gegenüber
immer mit dem gleichen,trocke-
nen, hölzernen, ungeschmei-
digen Strich operierte. Meier-
Graefe bemüht sich sonst die-
ser Erwartung gerecht zu wer-
den. Die Gemäldeanalysen par-
tizipieren an diesem Mangel
nicht; es scheint also keine
Gefahr, dass die Erweiterung wunschkarte, um 1800
der Wirkungstendenzen dem Ehrgeiz des Kunstanaly-
tikers dauernd von Nachteil sein wird.
Auch haben wir in dem später erschienenen Hogarth-
buch, der reinen Schöpfung eines kunstkritischen Geistes,
ein Zeugnis, dass Meier-Graefe seine erprobten Waffen
in alter Schärfe führt. Die Bildanalysen weisen das
Künstlerische dieses jahrhundertelang verkannten Anek-
dotenmalers mit einer Eindringlichkeit auf, die sich
nicht so sans phrase zu geben brauchte, um in gleichem
Masse verblüffend zu wirken; denn über den Artisten
Hogarth schweigen sich die landläufigen Kunstgeschichten
bisher einmütig aus. Das Buch übt kraft seines virtuosen
Vortrags, der ausschliesslich das Artistenmotiv, dieses
aber mit erstaunlicher Anschauungsfülle variiert, Über-
zeugungskraft und legitimiert sich auf diese Weise mit
einer Notwendigkeit, dass man nach der Lektüre das
Gefühl hat, als wäre Hogarth in dieser neuen Form ein
alter Bekannter und ein Irrtum über ihn nie möglich
o-ewesen. Müller-Kaboth.
•&
Der im vorigen Jahr verstorbene Maler Bär in Frank-
furt, der seiner Zeit schon in Leibls Bild „Jäger am See"
(Nationalgalerie) einen Kahn hineingemalt hatte - der
jetzt auf Sperls Intervention hin wieder entfernt worden
ist—kamanfangs derneunziger
Jahre einmal in Leibls Atelier
nach Aibling. Er bettelte ihm
dort eine kleine Skizze ab, zwei
Figuren an einem Tische
sitzend. Die Skizze war höchst
unbedeutend. Überdies Hess
Bär nicht nach, bis Leibl auf die
Rückseite desBildes eine Dedi-
kation schrieb. Diese Skizze
hat nun Bär „fertig" gemalt
und sogar noch eine dritte Fi-
gur hinzugefügt. Von Leibl
ist sonach so gut wie nichts
mehr am Bilde, aber die De-
dikation wird es ewig als Leibl
gelten lassen.
Diese Thatsachen mitzu-
teilen ist eben jetzt von Inter-
esse, da das Bildchen in der
Berliner Sezession im Leibl-
Kabinet hängt, wo seine Echt-
heit von Manchem schon be-
zweifelt wurde. S.
438
Nuancen und Varianten so reiche Wort, mit einer Art
wohltemperierten Elans; die Noblesse ist untadelig, und
die leichte Modulation strömt, als wären die Kompliziert-
heiten der Ästhetik ganz einfache, willige und überaus
graziöse Dinge.
Freilich, nicht immer vermag die Eleganz des Vor-
trags darüber hinwegzutäuschen, dass mancher sprin-
gende Punkt unberührt gelassen oder nur vage um-
schrieben wurde. Der Mangel erklärt sich aber nicht
aus einer leichtfertigen Durchführung der Aufgabe,
sondern mehr aus der allgemeinen Auffassung des
Themas, das bei der speziellen Erörterung der Menzel-
schen Kunst psychologischer geraten ist, als es sonst bei
Meier-Graefe der Fall zu sein pflegt. Was er z. B. über
den Naturalismus des Zeichners Menzel äussert, ist für
die Determination der künstlerischen Individualität un-
gemein fein und belangvoll; aber ich vermisse dort das
aufhellende Wort über den Naturalismus als solchen,
als Resultat, das in jeder einzelnen Zeichnung zu
Tage liegt. Meier-Graefe hätte weniger Psychologie als
Physiologie des Mittels geben, hätte zeigen müssen,
an welchem sichtbaren Manko es liegt, dass irgend
eine von den tausend zeichnerischen Notizen Men-
zels der künstlerischen Qualität entbehrt. Er be-
schränkte sich auf die Konstatierung, dass Menzels
Interesse am Gegenständ-
lichen nur bis zur oberfläch-
lichen Fixierung der Form
dauerte. Ich hätte hier Auf-
schlüsse erwartet über die Art,
wie dieses schnell entfachte
und schnell verlöschende
Interesse äusserlich sich ma-
nifestierte, wie es diese stu-
pide und halsstarrige Gleich-
gültigkeit hervorbrachte, die
das Organische vernachlässigte
und der menschlichen Epider-
mis, einem Spitzengewebe oder
einem Eisensparren gegenüber
immer mit dem gleichen,trocke-
nen, hölzernen, ungeschmei-
digen Strich operierte. Meier-
Graefe bemüht sich sonst die-
ser Erwartung gerecht zu wer-
den. Die Gemäldeanalysen par-
tizipieren an diesem Mangel
nicht; es scheint also keine
Gefahr, dass die Erweiterung wunschkarte, um 1800
der Wirkungstendenzen dem Ehrgeiz des Kunstanaly-
tikers dauernd von Nachteil sein wird.
Auch haben wir in dem später erschienenen Hogarth-
buch, der reinen Schöpfung eines kunstkritischen Geistes,
ein Zeugnis, dass Meier-Graefe seine erprobten Waffen
in alter Schärfe führt. Die Bildanalysen weisen das
Künstlerische dieses jahrhundertelang verkannten Anek-
dotenmalers mit einer Eindringlichkeit auf, die sich
nicht so sans phrase zu geben brauchte, um in gleichem
Masse verblüffend zu wirken; denn über den Artisten
Hogarth schweigen sich die landläufigen Kunstgeschichten
bisher einmütig aus. Das Buch übt kraft seines virtuosen
Vortrags, der ausschliesslich das Artistenmotiv, dieses
aber mit erstaunlicher Anschauungsfülle variiert, Über-
zeugungskraft und legitimiert sich auf diese Weise mit
einer Notwendigkeit, dass man nach der Lektüre das
Gefühl hat, als wäre Hogarth in dieser neuen Form ein
alter Bekannter und ein Irrtum über ihn nie möglich
o-ewesen. Müller-Kaboth.
•&
Der im vorigen Jahr verstorbene Maler Bär in Frank-
furt, der seiner Zeit schon in Leibls Bild „Jäger am See"
(Nationalgalerie) einen Kahn hineingemalt hatte - der
jetzt auf Sperls Intervention hin wieder entfernt worden
ist—kamanfangs derneunziger
Jahre einmal in Leibls Atelier
nach Aibling. Er bettelte ihm
dort eine kleine Skizze ab, zwei
Figuren an einem Tische
sitzend. Die Skizze war höchst
unbedeutend. Überdies Hess
Bär nicht nach, bis Leibl auf die
Rückseite desBildes eine Dedi-
kation schrieb. Diese Skizze
hat nun Bär „fertig" gemalt
und sogar noch eine dritte Fi-
gur hinzugefügt. Von Leibl
ist sonach so gut wie nichts
mehr am Bilde, aber die De-
dikation wird es ewig als Leibl
gelten lassen.
Diese Thatsachen mitzu-
teilen ist eben jetzt von Inter-
esse, da das Bildchen in der
Berliner Sezession im Leibl-
Kabinet hängt, wo seine Echt-
heit von Manchem schon be-
zweifelt wurde. S.
438