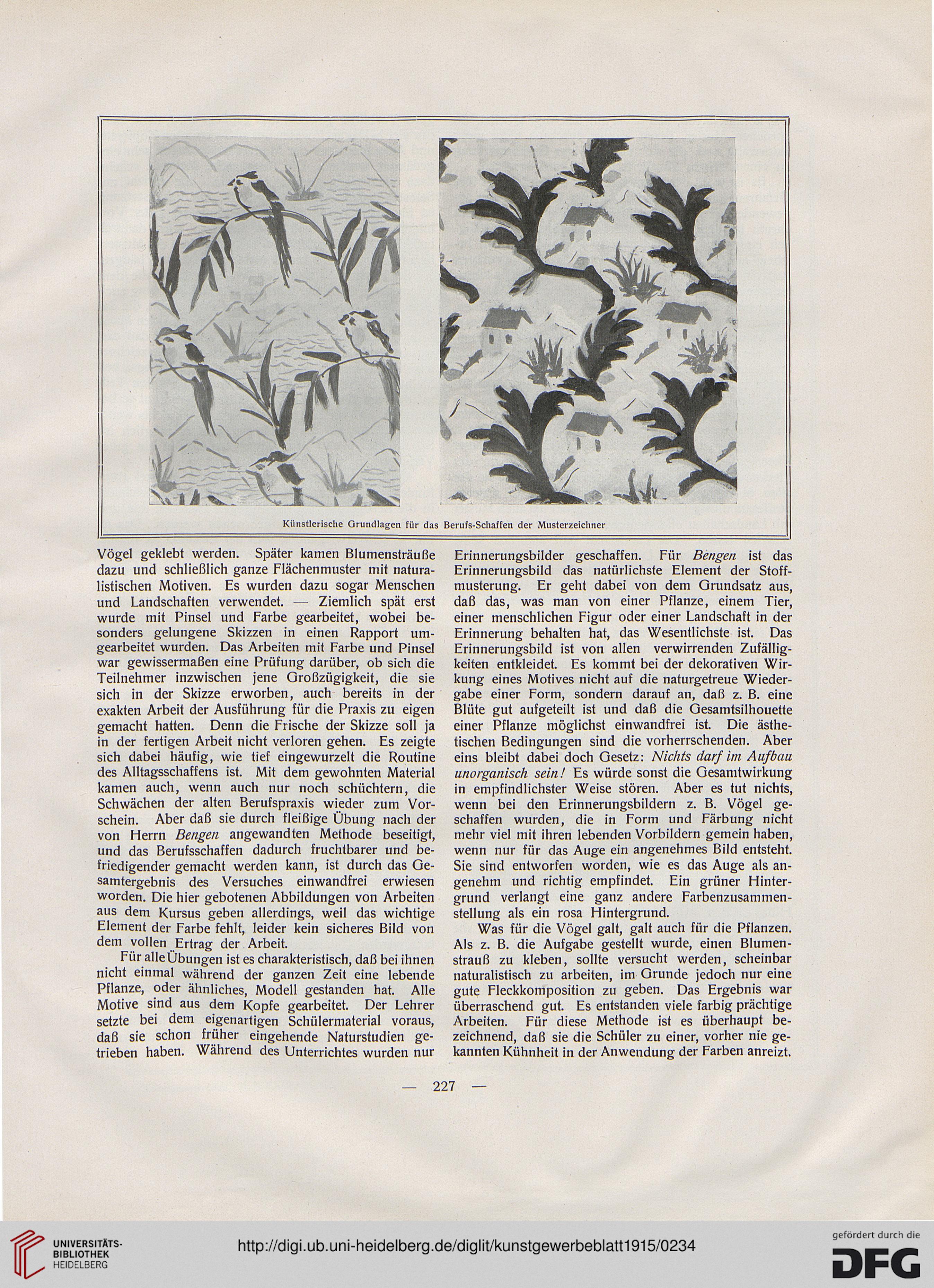Künstlerische Grundlagen für das Berufs-Schaffen der Musterzeichner
Vögel geklebt werden. Später kamen Blumensträuße
dazu und schließlich ganze Flächenmuster mit natura-
listischen Motiven. Es wurden dazu sogar Menschen
und Landschaften verwendet. — Ziemlich spät erst
wurde mit Pinsel und Farbe gearbeitet, wobei be-
sonders gelungene Skizzen in einen Rapport um-
gearbeitet wurden. Das Arbeiten mit Farbe und Pinsel
war gewissermaßen eine Prüfung darüber, ob sich die
Teilnehmer inzwischen jene Großzügigkeit, die sie
sich in der Skizze erworben, auch bereits in der
exakten Arbeit der Ausführung für die Praxis zu eigen
gemacht hatten. Denn die Frische der Skizze soll ja
in der fertigen Arbeit nicht verloren gehen. Es zeigte
sich dabei häufig, wie tief eingewurzelt die Routine
des Alltagsschaffens ist. Mit dem gewohnten Material
kamen auch, wenn auch nur noch schüchtern, die
Schwächen der alten Berufspraxis wieder zum Vor-
schein. Aber daß sie durch fleißige Übung nach der
von Herrn Bengen angewandten Methode beseitigt,
und das Berufsschaffen dadurch fruchtbarer und be-
friedigender gemacht werden kann, ist durch das Ge-
samtergebnis des Versuches einwandfrei erwiesen
worden. Die hier gebotenen Abbildungen von Arbeiten
aus dem Kursus geben allerdings, weil das wichtige
Element der Farbe fehlt, leider kein sicheres Bild von
dem vollen Ertrag der Arbeit.
Für alle Übungen ist es charakteristisch, daß bei ihnen
nicht einmal während der ganzen Zeit eine lebende
Pflanze, oder ähnliches, Modell gestanden hat. Alle
Motive sind aus dem Kopfe gearbeitet. Der Lehrer
setzte bei dem eigenartigen Schülermaterial voraus,
daß sie schon früher eingehende Naturstudien ge-
trieben haben. Während des Unterrichtes wurden nur
Erinnerungsbilder geschaffen. Für Bengen ist das
Erinnerungsbild das natürlichste Element der Stoff-
musterung. Er geht dabei von dem Grundsatz aus,
daß das, was man von einer Pflanze, einem Tier,
einer menschlichen Figur oder einer Landschaft in der
Erinnerung behalten hat, das Wesentlichste ist. Das
Erinnerungsbild ist von allen verwirrenden Zufällig-
keiten entkleidet. Es kommt bei der dekorativen Wir-
kung eines Motives nicht auf die naturgetreue Wieder-
gabe einer Form, sondern darauf an, daß z. B. eine
Blüte gut aufgeteilt ist und daß die Gesamtsilhouette
einer Pflanze möglichst einwandfrei ist. Die ästhe-
tischen Bedingungen sind die vorherrschenden. Aber
eins bleibt dabei doch Gesetz: Nichts darf im Aufbau
unorganisch sein! Es würde sonst die Gesamtwirkung
in empfindlichster Weise stören. Aber es tut nichts,
wenn bei den Erinnerungsbildern z. B. Vögel ge-
schaffen wurden, die in Form und Färbung nicht
mehr viel mit ihren lebenden Vorbildern gemein haben,
wenn nur für das Auge ein angenehmes Bild entsteht.
Sie sind entworfen worden, wie es das Auge als an-
genehm und richtig empfindet. Ein grüner Hinter-
grund verlangt eine ganz andere Farbenzusammen-
stellung als ein rosa Hintergrund.
Was für die Vögel galt, galt auch für die Pflanzen.
Als z. B. die Aufgabe gestellt wurde, einen Blumen-
strauß zu kleben, sollte versucht werden, scheinbar
naturalistisch zu arbeiten, im Grunde jedoch nur eine
gute Fleckkomposition zu geben. Das Ergebnis war
überraschend gut. Es entstanden viele farbig prächtige
Arbeiten. Für diese Methode ist es überhaupt be-
zeichnend, daß sie die Schüler zu einer, vorher nie ge-
kannten Kühnheit in der Anwendung der Farben anreizt.
— 227
Vögel geklebt werden. Später kamen Blumensträuße
dazu und schließlich ganze Flächenmuster mit natura-
listischen Motiven. Es wurden dazu sogar Menschen
und Landschaften verwendet. — Ziemlich spät erst
wurde mit Pinsel und Farbe gearbeitet, wobei be-
sonders gelungene Skizzen in einen Rapport um-
gearbeitet wurden. Das Arbeiten mit Farbe und Pinsel
war gewissermaßen eine Prüfung darüber, ob sich die
Teilnehmer inzwischen jene Großzügigkeit, die sie
sich in der Skizze erworben, auch bereits in der
exakten Arbeit der Ausführung für die Praxis zu eigen
gemacht hatten. Denn die Frische der Skizze soll ja
in der fertigen Arbeit nicht verloren gehen. Es zeigte
sich dabei häufig, wie tief eingewurzelt die Routine
des Alltagsschaffens ist. Mit dem gewohnten Material
kamen auch, wenn auch nur noch schüchtern, die
Schwächen der alten Berufspraxis wieder zum Vor-
schein. Aber daß sie durch fleißige Übung nach der
von Herrn Bengen angewandten Methode beseitigt,
und das Berufsschaffen dadurch fruchtbarer und be-
friedigender gemacht werden kann, ist durch das Ge-
samtergebnis des Versuches einwandfrei erwiesen
worden. Die hier gebotenen Abbildungen von Arbeiten
aus dem Kursus geben allerdings, weil das wichtige
Element der Farbe fehlt, leider kein sicheres Bild von
dem vollen Ertrag der Arbeit.
Für alle Übungen ist es charakteristisch, daß bei ihnen
nicht einmal während der ganzen Zeit eine lebende
Pflanze, oder ähnliches, Modell gestanden hat. Alle
Motive sind aus dem Kopfe gearbeitet. Der Lehrer
setzte bei dem eigenartigen Schülermaterial voraus,
daß sie schon früher eingehende Naturstudien ge-
trieben haben. Während des Unterrichtes wurden nur
Erinnerungsbilder geschaffen. Für Bengen ist das
Erinnerungsbild das natürlichste Element der Stoff-
musterung. Er geht dabei von dem Grundsatz aus,
daß das, was man von einer Pflanze, einem Tier,
einer menschlichen Figur oder einer Landschaft in der
Erinnerung behalten hat, das Wesentlichste ist. Das
Erinnerungsbild ist von allen verwirrenden Zufällig-
keiten entkleidet. Es kommt bei der dekorativen Wir-
kung eines Motives nicht auf die naturgetreue Wieder-
gabe einer Form, sondern darauf an, daß z. B. eine
Blüte gut aufgeteilt ist und daß die Gesamtsilhouette
einer Pflanze möglichst einwandfrei ist. Die ästhe-
tischen Bedingungen sind die vorherrschenden. Aber
eins bleibt dabei doch Gesetz: Nichts darf im Aufbau
unorganisch sein! Es würde sonst die Gesamtwirkung
in empfindlichster Weise stören. Aber es tut nichts,
wenn bei den Erinnerungsbildern z. B. Vögel ge-
schaffen wurden, die in Form und Färbung nicht
mehr viel mit ihren lebenden Vorbildern gemein haben,
wenn nur für das Auge ein angenehmes Bild entsteht.
Sie sind entworfen worden, wie es das Auge als an-
genehm und richtig empfindet. Ein grüner Hinter-
grund verlangt eine ganz andere Farbenzusammen-
stellung als ein rosa Hintergrund.
Was für die Vögel galt, galt auch für die Pflanzen.
Als z. B. die Aufgabe gestellt wurde, einen Blumen-
strauß zu kleben, sollte versucht werden, scheinbar
naturalistisch zu arbeiten, im Grunde jedoch nur eine
gute Fleckkomposition zu geben. Das Ergebnis war
überraschend gut. Es entstanden viele farbig prächtige
Arbeiten. Für diese Methode ist es überhaupt be-
zeichnend, daß sie die Schüler zu einer, vorher nie ge-
kannten Kühnheit in der Anwendung der Farben anreizt.
— 227