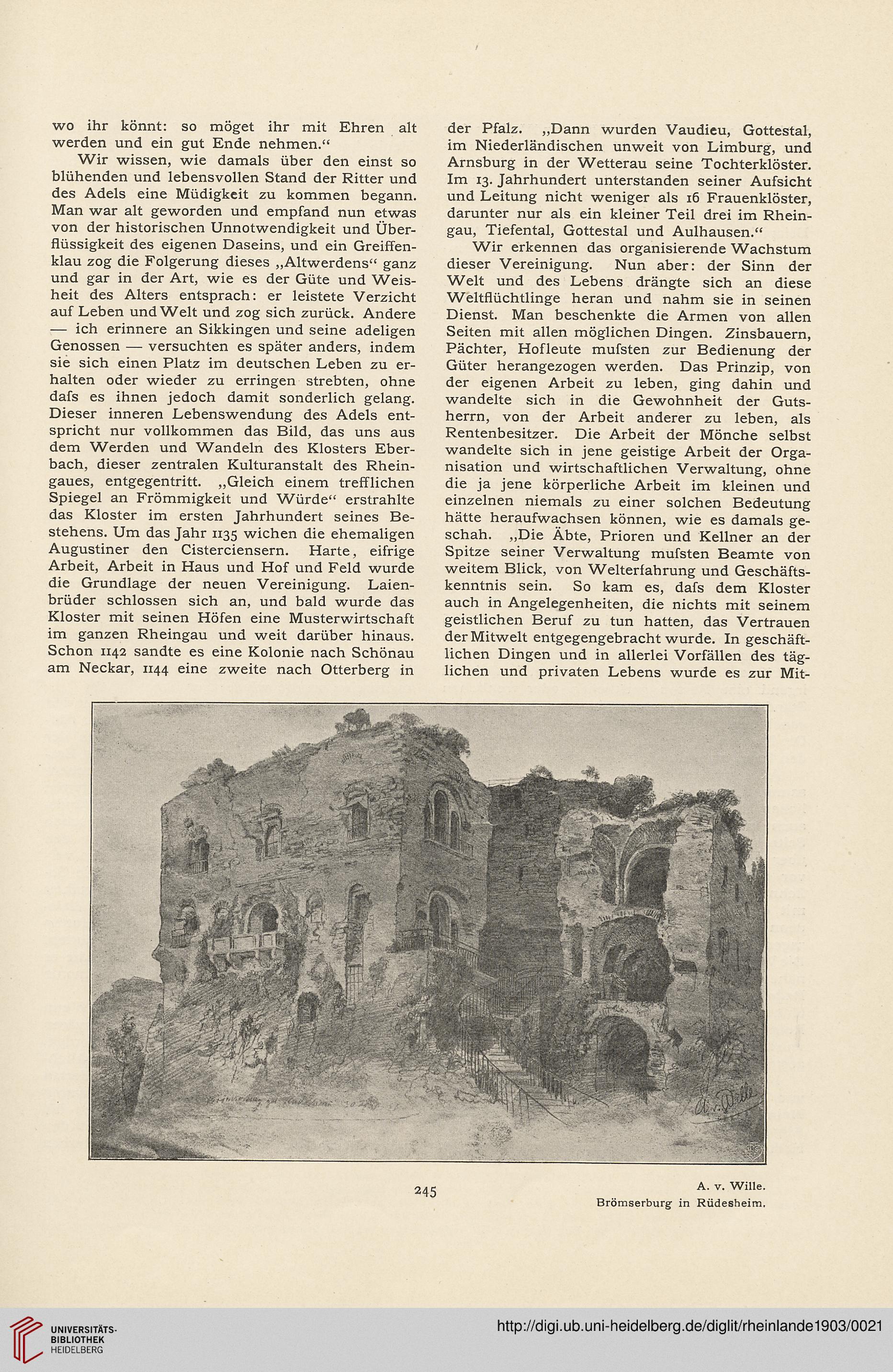wo ihr könnt: so möget ihr mit Ehren alt
werden und ein gut Ende nehmen.“
Wir wissen, wie damals über den einst so
blühenden und lebensvollen Stand der Ritter und
des Adels eine Müdigkeit zu kommen begann.
Man war alt geworden und empfand nun etwas
von der historischen Unnotwendigkeit und Über-
ssüssigkeit des eigenen Daseins, und ein Greiffen-
klau zog die Folgerung dieses „Altwerdens“ ganz
und gar in der Art, wie es der Güte und Weis-
heit des Alters entsprach: er leistete Verzicht
auf Leben und Welt und zog sich zurück. Andere
— ich erinnere an Sikkingen und seine adeligen
Genossen — versuchten es später anders, indem
sie sich einen Platz im deutschen Leben zu er-
halten oder wieder zu erringen strebten, ohne
dass es ihnen jedoch damit sonderlich gelang.
Dieser inneren Lebenswendung des Adels ent-
spricht nur vollkommen das Bild, das uns aus
dem Werden und Wandeln des Klosters Eber-
bach, dieser zentralen Kulturanstalt des Rhein-
gaues, entgegentritt. „Gleich einem trefflichen
Spiegel an Frömmigkeit und Würde“ erstrahlte
das Kloster im ersten Jahrhundert seines Be-
stehens. Um das Jahr 1135 wichen die ehemaligen
Augustiner den Cisterciensern. Harte, eifrige
Arbeit, Arbeit in Haus und Hof und Feld wurde
die Grundlage der neuen Vereinigung. Laien-
brüder schlossen sich an, und bald wurde das
Kloster mit seinen Höfen eine Musterwirtschaft
im ganzen Rheingau und weit darüber hinaus.
Schon 1142 sandte es eine Kolonie nach Schönau
am Neckar, 1144 eine zweite nach Otterberg in
der Pfalz. „Dann wurden Vaudicu, Gottestal,
im Niederländischen unweit von Limburg, und
Arnsburg in der Wetterau seine Tochterklöster.
Im 13. Jahrhundert unterstanden seiner Aufsicht
und Leitung nicht weniger als 16 Frauenklöster,
darunter nur als ein kleiner Teil drei im Rhein-
gau, Tiefental, Gottestal und Aulhausen.“
Wir erkennen das organisierende Wachstum
dieser Vereinigung. Nun aber: der Sinn der
Welt und des Lebens drängte sich an diese
Weltssüchtlinge heran und nahm sie in seinen
Dienst. Man beschenkte die Armen von allen
Seiten mit allen möglichen Dingen. Zinsbauern,
Pächter, Hofleute mussten zur Bedienung der
Güter herangezogen werden. Das Prinzip, von
der eigenen Arbeit zu leben, ging dahin und
wandelte sich in die Gewohnheit der Guts-
herrn, von der Arbeit anderer zu leben, als
Rentenbesitzer. Die Arbeit der Mönche selbst
wandelte sich in jene geistige Arbeit der Orga-
nisation und wirtschaftlichen Verwaltung, ohne
die ja jene körperliche Arbeit im kleinen und
einzelnen niemals zu einer solchen Bedeutung
hätte heraufwachsen können, wie es damals ge-
schah. „Die Äbte, Prioren und Kellner an der
Spitze seiner Verwaltung mussten Beamte von
weitem Blick, von Welterfahrung und Geschäfts-
kenntnis sein. So kam es, dass dem Kloster
auch in Angelegenheiten, die nichts mit seinem
geistlichen Beruf zu tun hatten, das Vertrauen
der Mitwelt entgegengebracht wurde. In geschäft-
lichen Dingen und in allerlei Vorfällen des täg-
lichen und privaten Lebens wurde es zur Mit-
245
A. v. Wille.
Brömserburg in Rüdesheim.
werden und ein gut Ende nehmen.“
Wir wissen, wie damals über den einst so
blühenden und lebensvollen Stand der Ritter und
des Adels eine Müdigkeit zu kommen begann.
Man war alt geworden und empfand nun etwas
von der historischen Unnotwendigkeit und Über-
ssüssigkeit des eigenen Daseins, und ein Greiffen-
klau zog die Folgerung dieses „Altwerdens“ ganz
und gar in der Art, wie es der Güte und Weis-
heit des Alters entsprach: er leistete Verzicht
auf Leben und Welt und zog sich zurück. Andere
— ich erinnere an Sikkingen und seine adeligen
Genossen — versuchten es später anders, indem
sie sich einen Platz im deutschen Leben zu er-
halten oder wieder zu erringen strebten, ohne
dass es ihnen jedoch damit sonderlich gelang.
Dieser inneren Lebenswendung des Adels ent-
spricht nur vollkommen das Bild, das uns aus
dem Werden und Wandeln des Klosters Eber-
bach, dieser zentralen Kulturanstalt des Rhein-
gaues, entgegentritt. „Gleich einem trefflichen
Spiegel an Frömmigkeit und Würde“ erstrahlte
das Kloster im ersten Jahrhundert seines Be-
stehens. Um das Jahr 1135 wichen die ehemaligen
Augustiner den Cisterciensern. Harte, eifrige
Arbeit, Arbeit in Haus und Hof und Feld wurde
die Grundlage der neuen Vereinigung. Laien-
brüder schlossen sich an, und bald wurde das
Kloster mit seinen Höfen eine Musterwirtschaft
im ganzen Rheingau und weit darüber hinaus.
Schon 1142 sandte es eine Kolonie nach Schönau
am Neckar, 1144 eine zweite nach Otterberg in
der Pfalz. „Dann wurden Vaudicu, Gottestal,
im Niederländischen unweit von Limburg, und
Arnsburg in der Wetterau seine Tochterklöster.
Im 13. Jahrhundert unterstanden seiner Aufsicht
und Leitung nicht weniger als 16 Frauenklöster,
darunter nur als ein kleiner Teil drei im Rhein-
gau, Tiefental, Gottestal und Aulhausen.“
Wir erkennen das organisierende Wachstum
dieser Vereinigung. Nun aber: der Sinn der
Welt und des Lebens drängte sich an diese
Weltssüchtlinge heran und nahm sie in seinen
Dienst. Man beschenkte die Armen von allen
Seiten mit allen möglichen Dingen. Zinsbauern,
Pächter, Hofleute mussten zur Bedienung der
Güter herangezogen werden. Das Prinzip, von
der eigenen Arbeit zu leben, ging dahin und
wandelte sich in die Gewohnheit der Guts-
herrn, von der Arbeit anderer zu leben, als
Rentenbesitzer. Die Arbeit der Mönche selbst
wandelte sich in jene geistige Arbeit der Orga-
nisation und wirtschaftlichen Verwaltung, ohne
die ja jene körperliche Arbeit im kleinen und
einzelnen niemals zu einer solchen Bedeutung
hätte heraufwachsen können, wie es damals ge-
schah. „Die Äbte, Prioren und Kellner an der
Spitze seiner Verwaltung mussten Beamte von
weitem Blick, von Welterfahrung und Geschäfts-
kenntnis sein. So kam es, dass dem Kloster
auch in Angelegenheiten, die nichts mit seinem
geistlichen Beruf zu tun hatten, das Vertrauen
der Mitwelt entgegengebracht wurde. In geschäft-
lichen Dingen und in allerlei Vorfällen des täg-
lichen und privaten Lebens wurde es zur Mit-
245
A. v. Wille.
Brömserburg in Rüdesheim.