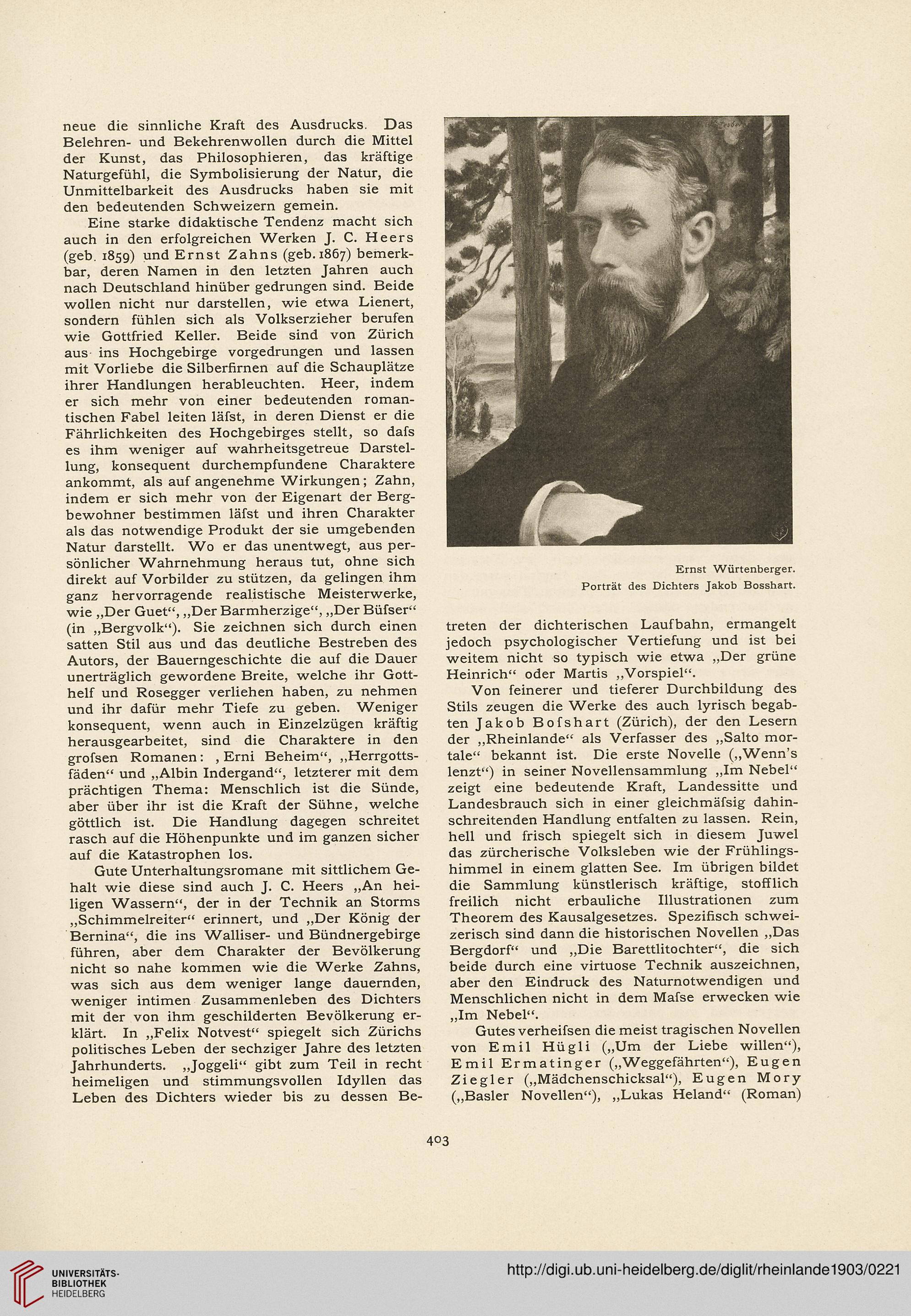neue die sinnliche Kraft des Ausdrucks. Das
Belehren- und Bekehrenwollen durch die Mittel
der Kunst, das Philosophieren, das kräftige
Naturgefühl, die Symbolisierung der Natur, die
Unmittelbarkeit des Ausdrucks haben sie mit
den bedeutenden Schweizern gemein.
Eine starke didaktische Tendenz macht sich
auch in den erfolgreichen Werken J. C. Heers
(geb. 1859) und Ernst Zahns (geb. 1867) bemerk-
bar, deren Namen in den letzten Jahren auch
nach Deutschland hinüber gedrungen sind. Beide
wollen nicht nur darstellen, wie etwa Lienert,
sondern fühlen sich als Volkserzieher berufen
wie Gottfried Keller. Beide sind von Zürich
aus ins Hochgebirge vorgedrungen und lassen
mit Vorliebe die Silberfirnen auf die Schauplätze
ihrer Handlungen herableuchten. Heer, indem
er sich mehr von einer bedeutenden roman-
tischen Fabel leiten lässt, in deren Dienst er die
Fährlichkeiten des Hochgebirges stellt, so dass
es ihm weniger auf wahrheitsgetreue Darstel-
lung, konsequent durchempfundene Charaktere
ankommt, als auf angenehme Wirkungen; Zahn,
indem er sich mehr von der Eigenart der Berg-
bewohner bestimmen lässt und ihren Charakter
als das notwendige Produkt der sie umgebenden
Natur darstellt. Wo er das unentwegt, aus per-
sönlicher Wahrnehmung heraus tut, ohne sich
direkt auf Vorbilder zu stützen, da gelingen ihm
ganz hervorragende realistische Meisterwerke,
wie „Der Guet“, „Der Barmherzige“, „Der Büsser“
(in „Bergvolk“). Sie zeichnen sich durch einen
satten Stil aus und das deutliche Bestreben des
Autors, der Bauerngeschichte die auf die Dauer
unerträglich gewordene Breite, welche ihr Gott-
helf und Rosegger verliehen haben, zu nehmen
und ihr dafür mehr Tiefe zu geben. Weniger
konsequent, wenn auch in Einzelzügen kräftig
herausgearbeitet, sind die Charaktere in den
grossen Romanen: , Erni Beheim“, „Herrgotts-
fäden“ und „Albin Indergand“, letzterer mit dem
prächtigen Thema: Menschlich ist die Sünde,
aber über ihr ist die Kraft der Sühne, welche
göttlich ist. Die Handlung dagegen schreitet
rasch auf die Höhenpunkte und im ganzen sicher
auf die Katastrophen los.
Gute Unterhaltungsromane mit sittlichem Ge-
halt wie diese sind auch J. C. Heers „An hei-
ligen Wassern“, der in der Technik an Storms
„Schimmelreiter“ erinnert, und „Der König der
Bernina“, die ins Walliser- und Bündnergebirge
führen, aber dem Charakter der Bevölkerung
nicht so nahe kommen wie die Werke Zahns,
was sich aus dem weniger lange dauernden,
weniger intimen Zusammenleben des Dichters
mit der von ihm geschilderten Bevölkerung er-
klärt. In „Felix Notvest“ spiegelt sich Zürichs
politisches Leben der sechziger Jahre des letzten
Jahrhunderts. „Joggeli“ gibt zum Teil in recht
heimeligen und stimmungsvollen Idyllen das
Leben des Dichters wieder bis zu dessen Be-
Ernst Würtenberger.
Porträt des Dichters Jakob Bosshart.
treten der dichterischen Laufbahn, ermangelt
jedoch psychologischer Vertiefung und ist bei
weitem nicht so typisch wie etwa „Der grüne
Heinrich“ oder Martis „Vorspiel“.
Von seinerer und tieferer Durchbildung des
Stils zeugen die Werke des auch lyrisch begab-
ten Jakob Bosshart (Zürich), der den Lesern
der „Rheinlande“ als Verfasser des „Salto mor-
tale“ bekannt ist. Die erste Novelle („Wenn’s
lenzt“) in seiner Novellensammlung „Im Nebel“
zeigt eine bedeutende Kraft, Landessitte und
Landesbrauch sich in einer gleichmässig dahin-
schreitenden Handlung entfalten zu lassen. Rein,
hell und frisch spiegelt sich in diesem Juwel
das zürcherische Volksleben wie der Frühlings-
himmel in einem glatten See. Im übrigen bildet
die Sammlung künstlerisch kräftige, stofflich
freilich nicht erbauliche Illustrationen zum
Theorem des Kausalgesetzes. Spezifisch schwei-
zerisch sind dann die historischen Novellen „Das
Bergdorf“ und „Die Barettlitochter“, die sich
beide durch eine virtuose Technik auszeichnen,
aber den Eindruck des Naturnotwendigen und
Menschlichen nicht in dem Masse erwecken wie
„Im Nebel“.
Gutes verheissen die meist tragischen Novellen
von Emil Hügli („Um der Liebe willen“),
Emil Ermatinger („Weggefährten“), Eugen
Ziegler („Mädchenschicksal“), Eugen Mory
(„Basler Novellen“), „Lukas Heland“ (Roman)
403
Belehren- und Bekehrenwollen durch die Mittel
der Kunst, das Philosophieren, das kräftige
Naturgefühl, die Symbolisierung der Natur, die
Unmittelbarkeit des Ausdrucks haben sie mit
den bedeutenden Schweizern gemein.
Eine starke didaktische Tendenz macht sich
auch in den erfolgreichen Werken J. C. Heers
(geb. 1859) und Ernst Zahns (geb. 1867) bemerk-
bar, deren Namen in den letzten Jahren auch
nach Deutschland hinüber gedrungen sind. Beide
wollen nicht nur darstellen, wie etwa Lienert,
sondern fühlen sich als Volkserzieher berufen
wie Gottfried Keller. Beide sind von Zürich
aus ins Hochgebirge vorgedrungen und lassen
mit Vorliebe die Silberfirnen auf die Schauplätze
ihrer Handlungen herableuchten. Heer, indem
er sich mehr von einer bedeutenden roman-
tischen Fabel leiten lässt, in deren Dienst er die
Fährlichkeiten des Hochgebirges stellt, so dass
es ihm weniger auf wahrheitsgetreue Darstel-
lung, konsequent durchempfundene Charaktere
ankommt, als auf angenehme Wirkungen; Zahn,
indem er sich mehr von der Eigenart der Berg-
bewohner bestimmen lässt und ihren Charakter
als das notwendige Produkt der sie umgebenden
Natur darstellt. Wo er das unentwegt, aus per-
sönlicher Wahrnehmung heraus tut, ohne sich
direkt auf Vorbilder zu stützen, da gelingen ihm
ganz hervorragende realistische Meisterwerke,
wie „Der Guet“, „Der Barmherzige“, „Der Büsser“
(in „Bergvolk“). Sie zeichnen sich durch einen
satten Stil aus und das deutliche Bestreben des
Autors, der Bauerngeschichte die auf die Dauer
unerträglich gewordene Breite, welche ihr Gott-
helf und Rosegger verliehen haben, zu nehmen
und ihr dafür mehr Tiefe zu geben. Weniger
konsequent, wenn auch in Einzelzügen kräftig
herausgearbeitet, sind die Charaktere in den
grossen Romanen: , Erni Beheim“, „Herrgotts-
fäden“ und „Albin Indergand“, letzterer mit dem
prächtigen Thema: Menschlich ist die Sünde,
aber über ihr ist die Kraft der Sühne, welche
göttlich ist. Die Handlung dagegen schreitet
rasch auf die Höhenpunkte und im ganzen sicher
auf die Katastrophen los.
Gute Unterhaltungsromane mit sittlichem Ge-
halt wie diese sind auch J. C. Heers „An hei-
ligen Wassern“, der in der Technik an Storms
„Schimmelreiter“ erinnert, und „Der König der
Bernina“, die ins Walliser- und Bündnergebirge
führen, aber dem Charakter der Bevölkerung
nicht so nahe kommen wie die Werke Zahns,
was sich aus dem weniger lange dauernden,
weniger intimen Zusammenleben des Dichters
mit der von ihm geschilderten Bevölkerung er-
klärt. In „Felix Notvest“ spiegelt sich Zürichs
politisches Leben der sechziger Jahre des letzten
Jahrhunderts. „Joggeli“ gibt zum Teil in recht
heimeligen und stimmungsvollen Idyllen das
Leben des Dichters wieder bis zu dessen Be-
Ernst Würtenberger.
Porträt des Dichters Jakob Bosshart.
treten der dichterischen Laufbahn, ermangelt
jedoch psychologischer Vertiefung und ist bei
weitem nicht so typisch wie etwa „Der grüne
Heinrich“ oder Martis „Vorspiel“.
Von seinerer und tieferer Durchbildung des
Stils zeugen die Werke des auch lyrisch begab-
ten Jakob Bosshart (Zürich), der den Lesern
der „Rheinlande“ als Verfasser des „Salto mor-
tale“ bekannt ist. Die erste Novelle („Wenn’s
lenzt“) in seiner Novellensammlung „Im Nebel“
zeigt eine bedeutende Kraft, Landessitte und
Landesbrauch sich in einer gleichmässig dahin-
schreitenden Handlung entfalten zu lassen. Rein,
hell und frisch spiegelt sich in diesem Juwel
das zürcherische Volksleben wie der Frühlings-
himmel in einem glatten See. Im übrigen bildet
die Sammlung künstlerisch kräftige, stofflich
freilich nicht erbauliche Illustrationen zum
Theorem des Kausalgesetzes. Spezifisch schwei-
zerisch sind dann die historischen Novellen „Das
Bergdorf“ und „Die Barettlitochter“, die sich
beide durch eine virtuose Technik auszeichnen,
aber den Eindruck des Naturnotwendigen und
Menschlichen nicht in dem Masse erwecken wie
„Im Nebel“.
Gutes verheissen die meist tragischen Novellen
von Emil Hügli („Um der Liebe willen“),
Emil Ermatinger („Weggefährten“), Eugen
Ziegler („Mädchenschicksal“), Eugen Mory
(„Basler Novellen“), „Lukas Heland“ (Roman)
403