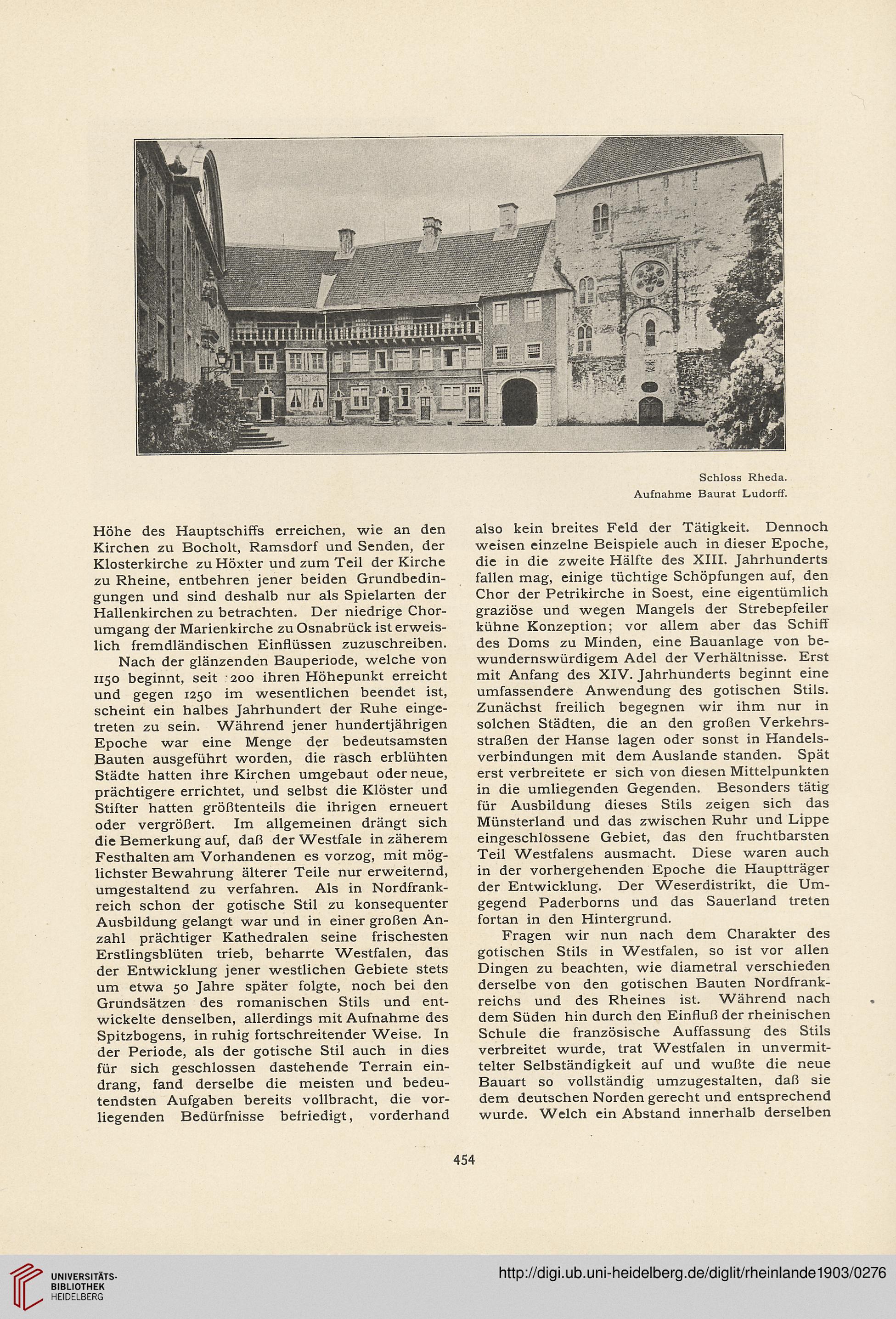Schloss Rheda.
Aufnahme Baurat Ludorff.
Höhe des Hauptschiffs erreichen, wie an den
Kirchen zu Bocholt, Ramsdorf und Senden, der
Klosterkirche zu Höxter und zum Teil der Kirche
zu Rheine, entbehren jener beiden Grundbedin-
gungen und sind deshalb nur als Spielarten der
Hallenkirchen zu betrachten. Der niedrige Chor-
umgang der Marienkirche zu Osnabrück ist erweis-
lich fremdländischen Einflüssen zuzuschreiben.
Nach der glänzenden Bauperiode, welche von
1150 beginnt, seit 200 ihren Höhepunkt erreicht
und gegen 1250 im wesentlichen beendet ist,
scheint ein halbes Jahrhundert der Ruhe einge-
treten zu sein. Während jener hundertjährigen
Epoche war eine Menge der bedeutsamsten
Bauten ausgeführt worden, die rasch erblühten
Städte hatten ihre Kirchen umgebaut oder neue,
prächtigere errichtet, und selbst die Klöster und
Stifter hatten größtenteils die ihrigen erneuert
oder vergrößert. Im allgemeinen drängt sich
die Bemerkung auf, daß der Westfale in zäherem
Festhalten am Vorhandenen es vorzog, mit mög-
lichster Bewahrung älterer Teile nur erweiternd,
umgestaltend zu verfahren. Als in Nordfrank-
reich schon der gotische Stil zu konsequenter
Ausbildung gelangt war und in einer großen An-
zahl prächtiger Kathedralen seine frischesten
Erstlingsblüten trieb, beharrte Westfalen, das
der Entwicklung jener westlichen Gebiete stets
um etwa 50 Jahre später folgte, noch bei den
Grundsätzen des romanischen Stils und ent-
wickelte denselben, allerdings mit Aufnahme des
Spitzbogens, in ruhig fortschreitender Weise. In
der Periode, als der gotische Stil auch in dies
sür sich geschlossen dastehende Terrain ein-
drang, fand derselbe die meisten und bedeu-
tendsten Aufgaben bereits vollbracht, die vor-
liegenden Bedürfnisse befriedigt, vorderhand
also kein breites Feld der Tätigkeit. Dennoch
weisen einzelne Beispiele auch in dieser Epoche,
die in die zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts
fallen mag, einige tüchtige Schöpfungen auf, den
Chor der Petrikirche in Soest, eine eigentümlich
graziöse und wegen Mangels der Strebepfeiler
kühne Konzeption; vor allem aber das Schiff
des Doms zu Minden, eine Bauanlage von be-
wundernswürdigem Adel der Verhältnisse. Erst
mit Anfang des XIV. Jahrhunderts beginnt eine
umfassendere Anwendung des gotischen Stils.
Zunächst freilich begegnen wir ihm nur in
solchen Städten, die an den großen Verkehrs-
straßen der Hanse lagen oder sonst in Handels-
verbindungen mit dem Auslande standen. Spät
erst verbreitete er sich von diesen Mittelpunkten
in die umliegenden Gegenden. Besonders tätig
für Ausbildung dieses Stils zeigen sich das
Münsterland und das zwischen Ruhr und Lippe
eingeschlossene Gebiet, das den fruchtbarsten
Teil Westfalens ausmacht. Diese waren auch
in der vorhergehenden Epoche die Hauptträger
der Entwicklung. Der Weserdistrikt, die Um-
gegend Paderborns und das Sauerland treten
fortan in den Hintergrund.
Fragen wir nun nach dem Charakter des
gotischen Stils in Westfalen, so ist vor allen
Dingen zu beachten, wie diametral verschieden
derselbe von den gotischen Bauten Nordfrank-
reichs und des Rheines ist. Während nach
dem Süden hin durch den Einssuß der rheinischen
Schule die französische Auffassung des Stils
verbreitet wurde, trat Westfalen in unvermit-
telter Selbständigkeit auf und wußte die neue
Bauart so vollständig umzugestalten, daß sie
dem deutschen Norden gerecht und entsprechend
wurde. Welch ein Abstand innerhalb derselben
454