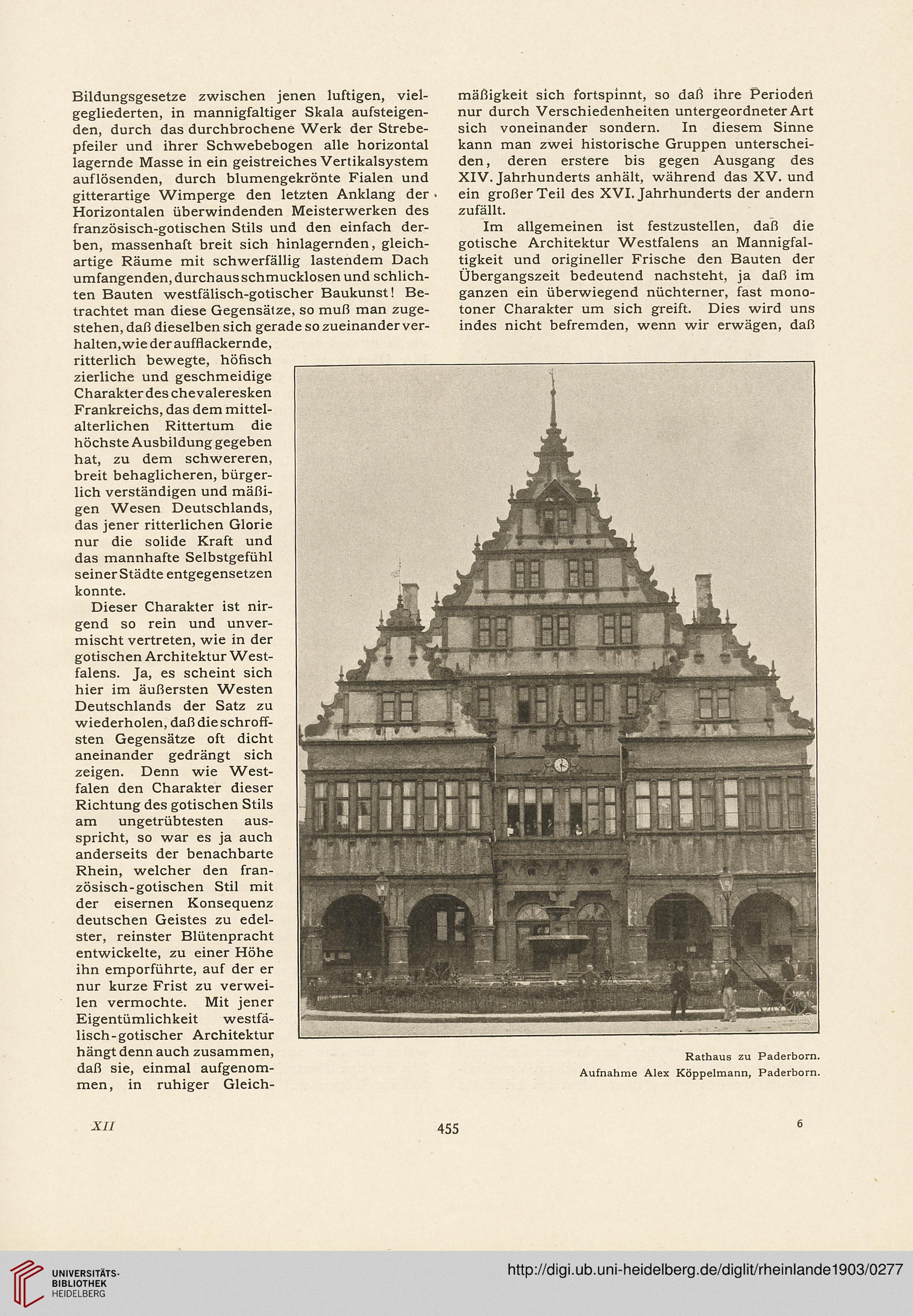Bildungsgesetze zwischen jenen luftigen, viel-
gegliederten, in mannigfaltiger Skala aufsteigen-
den, durch das durchbrochene Werk der Strebe-
pfeiler und ihrer Schwebebogen alle horizontal
lagernde Masse in ein geistreiches Vertikalsystem
auf lösenden, durch blumengekrönte Fialen und
gitterartige Wimperge den letzten Anklang der •
Horizontalen überwindenden Meisterwerken des
französisch-gotischen Stils und den einfach der-
ben, massenhast breit sich hinlagernden, gleich-
artige Räume mit schwerfällig lastendem Dach
umfangenden, durchaus schmucklosen und schlich-
ten Bauten westfälisch-gotischer Baukunst! Be-
trachtet man diese Gegensätze, so muß man zuge-
stehen, daß dieselben sich gerade so zueinander ver-
halten, wie der aufflackernde,
ritterlich bewegte, höfisch
zierliche und geschmeidige
Charakter des chevaleresken
Frankreichs, das dem mittel-
alterlichen Rittertum die
höchste Ausbildung gegeben
hat, zu dem schwereren,
breit behaglicheren, bürger-
lich verständigen und mäßi-
gen Wesen Deutschlands,
das jener ritterlichen Glorie
nur die solide Kraft und
das mannhafte Selbstgefühl
seiner Städte entgegensetzen
konnte.
Dieser Charakter ist nir-
gend so rein und unver-
mischt vertreten, wie in der
gotischen Architektur West-
falens. Ja, es scheint sich
hier im äußersten Westen
Deutschlands der Satz zu
wiederholen, daß die schrosf-
sten Gegensätze ost dicht
aneinander gedrängt sich
zeigen. Denn wie West-
falen den Charakter dieser
Richtung des gotischen Stils
am ungetrübtesten aus-
spricht, so war es ja auch
anderseits der benachbarte
Rhein, welcher den fran-
zösisch-gotischen Stil mit
der eisernen Konsequenz
deutschen Geistes zu edel-
ster, reinster Blütenpracht
entwickelte, zu einer Höhe
ihn emporführte, auf der er
nur kurze Frist zu verwei-
len vermochte. Mit jener
Eigentümlichkeit westfä-
lisch-gotischer Architektur
hängt denn auch zusammen,
daß sie, einmal aufgenom-
men, in ruhiger Gleich-
mäßigkeit sich fortspinnt, so daß ihre Perioden
nur durch Verschiedenheiten untergeordneter Art
sich voneinander sondern. In diesem Sinne
kann man zwei historische Gruppen unterschei-
den , deren erstere bis gegen Ausgang des
XIV. Jahrhunderts anhält, während das XV. und
ein großer Teil des XVI. Jahrhunderts der andern
zufällt.
Im allgemeinen ist festzustellen, daß die
gotische Architektur Westfalens an Mannigfal-
tigkeit und origineller Frische den Bauten der
Übergangszeit bedeutend nachsteht, ja daß im
ganzen ein überwiegend nüchterner, fast mono-
toner Charakter um sich greift. Dies wird uns
indes nicht befremden, wenn wir erwägen, daß
Rathaus zu Paderborn.
Aufnahme Alex Köppelmann, Paderborn.
XII
455
6
gegliederten, in mannigfaltiger Skala aufsteigen-
den, durch das durchbrochene Werk der Strebe-
pfeiler und ihrer Schwebebogen alle horizontal
lagernde Masse in ein geistreiches Vertikalsystem
auf lösenden, durch blumengekrönte Fialen und
gitterartige Wimperge den letzten Anklang der •
Horizontalen überwindenden Meisterwerken des
französisch-gotischen Stils und den einfach der-
ben, massenhast breit sich hinlagernden, gleich-
artige Räume mit schwerfällig lastendem Dach
umfangenden, durchaus schmucklosen und schlich-
ten Bauten westfälisch-gotischer Baukunst! Be-
trachtet man diese Gegensätze, so muß man zuge-
stehen, daß dieselben sich gerade so zueinander ver-
halten, wie der aufflackernde,
ritterlich bewegte, höfisch
zierliche und geschmeidige
Charakter des chevaleresken
Frankreichs, das dem mittel-
alterlichen Rittertum die
höchste Ausbildung gegeben
hat, zu dem schwereren,
breit behaglicheren, bürger-
lich verständigen und mäßi-
gen Wesen Deutschlands,
das jener ritterlichen Glorie
nur die solide Kraft und
das mannhafte Selbstgefühl
seiner Städte entgegensetzen
konnte.
Dieser Charakter ist nir-
gend so rein und unver-
mischt vertreten, wie in der
gotischen Architektur West-
falens. Ja, es scheint sich
hier im äußersten Westen
Deutschlands der Satz zu
wiederholen, daß die schrosf-
sten Gegensätze ost dicht
aneinander gedrängt sich
zeigen. Denn wie West-
falen den Charakter dieser
Richtung des gotischen Stils
am ungetrübtesten aus-
spricht, so war es ja auch
anderseits der benachbarte
Rhein, welcher den fran-
zösisch-gotischen Stil mit
der eisernen Konsequenz
deutschen Geistes zu edel-
ster, reinster Blütenpracht
entwickelte, zu einer Höhe
ihn emporführte, auf der er
nur kurze Frist zu verwei-
len vermochte. Mit jener
Eigentümlichkeit westfä-
lisch-gotischer Architektur
hängt denn auch zusammen,
daß sie, einmal aufgenom-
men, in ruhiger Gleich-
mäßigkeit sich fortspinnt, so daß ihre Perioden
nur durch Verschiedenheiten untergeordneter Art
sich voneinander sondern. In diesem Sinne
kann man zwei historische Gruppen unterschei-
den , deren erstere bis gegen Ausgang des
XIV. Jahrhunderts anhält, während das XV. und
ein großer Teil des XVI. Jahrhunderts der andern
zufällt.
Im allgemeinen ist festzustellen, daß die
gotische Architektur Westfalens an Mannigfal-
tigkeit und origineller Frische den Bauten der
Übergangszeit bedeutend nachsteht, ja daß im
ganzen ein überwiegend nüchterner, fast mono-
toner Charakter um sich greift. Dies wird uns
indes nicht befremden, wenn wir erwägen, daß
Rathaus zu Paderborn.
Aufnahme Alex Köppelmann, Paderborn.
XII
455
6