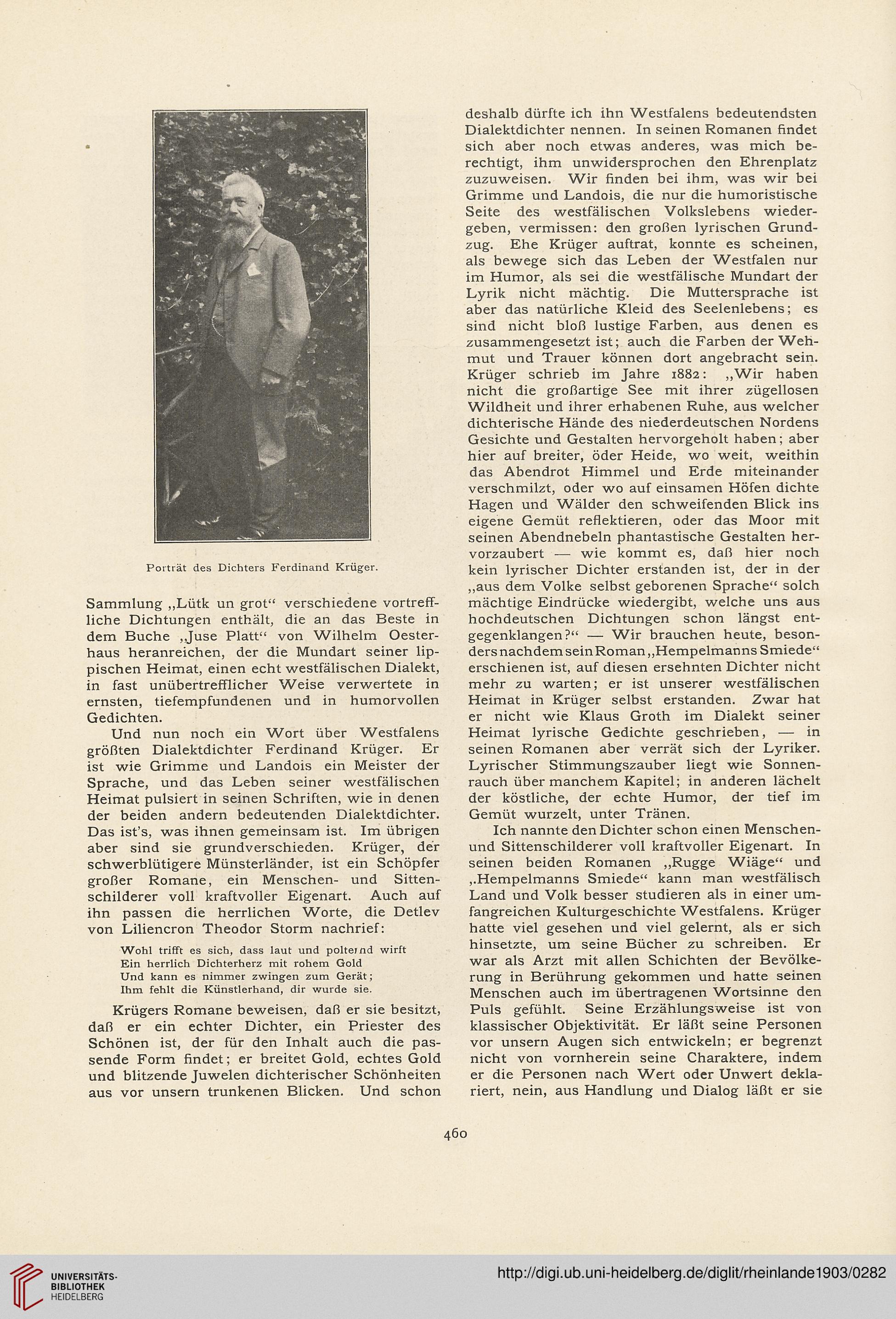Porträt des Dichters Ferdinand Krüger.
Sammlung „Lütk un grot“ verschiedene vortreff-
liche Dichtungen enthält, die an das Beste in
dem Buche ,Juse Platt“ von Wilhelm Oester-
haus heranreichen, der die Mundart seiner lip-
pischen Heimat, einen echt westfälischen Dialekt,
in fast unübertrefflicher Weise verwertete in
ernsten, tiefempfundenen und in humorvollen
Gedichten.
Und nun noch ein Wort über Westfalens
größten Dialektdichter Ferdinand Krüger. Er
ist wie Grimme und Landois ein Meister der
Sprache, und das Leben seiner westfälischen
Heimat pulsiert in seinen Schriften, wie in denen
der beiden andern bedeutenden Dialektdichter.
Das ist’s, was ihnen gemeinsam ist. Im übrigen
aber sind sie grundverschieden. Krüger, der
schwerblütigere Münsterländer, ist ein Schöpfer
großer Romane, ein Menschen- und Sitten-
schilderer voll kraftvoller Eigenart. Auch auf
ihn passen die herrlichen Worte, die Detlev
von Liliencron Theodor Storm nachrief:
Wohl trisft es sich, dass laut und polternd wirft
Ein herrlich Dichterherz mit rohem Gold
Und kann es nimmer zwingen zum Gerät;
Ihm fehlt die Künstlerhand, dir wurde sie.
Krügers Romane beweisen, daß er sie besitzt,
daß er ein echter Dichter, ein Priester des
Schönen ist, der für den Inhalt auch die pas-
sende Form findet; er breitet Gold, echtes Gold
und blitzende Juwelen dichterischer Schönheiten
aus vor unsern trunkenen Blicken. Und schon
deshalb dürfte ich ihn Westfalens bedeutendsten
Dialektdichter nennen. In seinen Romanen findet
sich aber noch etwas anderes, was mich be-
rechtigt, ihm unwidersprochen den Ehrenplatz
zuzuweisen. Wir finden bei ihm, was wir bei
Grimme und Landois, die nur die humoristische
Seite des westfälischen Volkslebens wieder-
geben, vermissen: den großen lyrischen Grund-
zug. Ehe Krüger auftrat, konnte es scheinen,
als bewege sich das Leben der Westfalen nur
im Humor, als sei die westfälische Mundart der
Lyrik nicht mächtig. Die Muttersprache ist
aber das natürliche Kleid des Seelenlebens; es
sind nicht bloß lustige Farben, aus denen es
zusammengesetzt ist; auch die Farben der Weh-
mut und Trauer können dort angebracht sein.
Krüger schrieb im Jahre 1882: „Wir haben
nicht die großartige See mit ihrer zügellosen
Wildheit und ihrer erhabenen Ruhe, aus welcher
dichterische Hände des niederdeutschen Nordens
Gesichte und Gestalten hervorgeholt haben; aber
hier auf breiter, öder Heide, wo weit, weithin
das Abendrot Himmel und Erde miteinander
verschmilzt, oder wo auf einsamen Höfen dichte
Hagen und Wälder den schweifenden Blick ins
eigene Gemüt ressektieren, oder das Moor mit
seinen Abendnebeln phantastische Gestalten her-
vorzaubert — wie kommt es, daß hier noch
kein lyrischer Dichter erstanden ist, der in der
„aus dem Volke selbst geborenen Sprache“ solch
mächtige Eindrücke wiedergibt, welche uns aus
hochdeutschen Dichtungen schon längst ent-
gegenklangen?“ — Wir brauchen heute, beson-
ders nachdem sein Roman,,Hempelmanns Smiede“
erschienen ist, auf diesen ersehnten Dichter nicht
mehr zu warten; er ist unserer westfälischen
Heimat in Krüger selbst erstanden. Zwar hat
er nicht wie Klaus Groth im Dialekt seiner
Heimat lyrische Gedichte geschrieben, — in
seinen Romanen aber verrät sich der Lyriker.
Lyrischer Stimmungszauber liegt wie Sonnen-
rauch über manchem Kapitel; in anderen lächelt
der köstliche, der echte Humor, der tief im
Gemüt wurzelt, unter Tränen.
Ich nannte den Dichter schon einen Menschen-
und Sittenschilderer voll kraftvoller Eigenart. In
seinen beiden Romanen „Rugge Wiäge“ und
„Hempelmanns Smiede“ kann man westfälisch
Land und Volk besser studieren als in einer um-
fangreichen Kulturgeschichte Westfalens. Krüger
hatte viel gesehen und viel gelernt, als er sich
hinsetzte, um seine Bücher zu schreiben. Er
war als Arzt mit allen Schichten der Bevölke-
rung in Berührung gekommen und hatte seinen
Menschen auch im übertragenen Wortsinne den
Puls gefühlt. Seine Erzählungsweise ist von
klassischer Objektivität. Er läßt seine Personen
vor unsern Augen sich entwickeln; er begrenzt
nicht von vornherein seine Charaktere, indem
er die Personen nach Wert oder Unwert dekla-
riert, nein, aus Handlung und Dialog läßt er sie
4Ö0