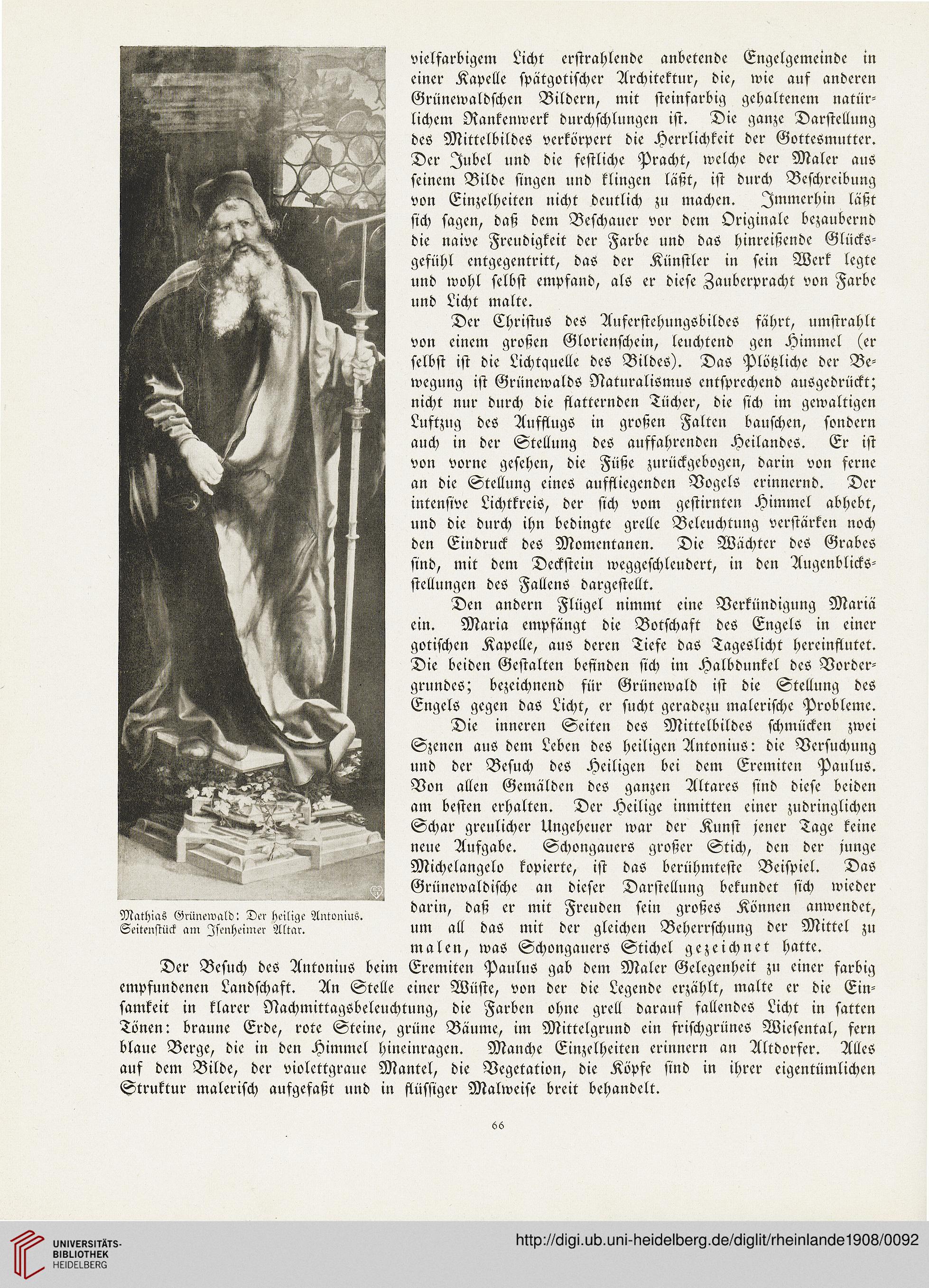vielfarbigem Licht erzählende anbetende Engelgemeinde in
einer Kapelle spätgotischer Architektur, die, wie auf anderen
Grünewaldschen Bildern, mit steinfarbig gehaltenem natür-
lichem Rankenwerk dnrchschlnngen ist. Die ganze Darstellung
des Mittelbildes verkörpert die Herrlichkeit der Gottesmutter.
Der Jubel und die festliche Pracht, welche der Maler aus
seinen. Bilde singen und klingen läßt, ist durch Beschreibung
von Einzelheiten nicht deutlich zu machen. Immerhin läßt
sich sagen, daß dem Beschauer vor dem Originale bezaubernd
die naive Freudigkeit der Farbe und das hinreißende Glücks-
gefühl entgegentritt, das der Künstler in sein Werk legte
und wohl selbst empfand, als er diese Zauberpracht von Farbe
und Licht malte.
Der Christus des Auferstehungsbildes fährt, umstrahlt
von einem großen Glorienschein, leuchtend gen Himmel (er
selbst ist die Lichtquelle des Bildes). Das Plötzliche der Be-
wegung ist Grünewalds Naturalismus entsprechend ausgedrückt;
nicht nur durch die flatternden Tücher, die sich im gewaltigen
Luftzug des Aufflugs in großen Falten bauschen, sondern
auch in der Stellung des auffahrenden Heilandes. Er ist
von vorne gesehen, die Füße zurückgebogen, darin von ferne
an die Stellung eines auffliegcnden Vogels erinnernd. Der
intensive Lichtkreis, der sich vom gestirnten Himmel abbebt,
und die durch ihn bedingte grelle Beleuchtung verstärken noch
den Eindruck des Momentanen. Die Wächter des Grabes
sind, mit dem Deckstein weggeschleudert, in den Angenblicks-
stellungen des Fallens dargcstellt.
Den andern Flügel nimmt eine Verkündigung Mariä
ein. Maria empfängt die Botschaft deö Engels in einer-
gotischen Kapelle, ans deren Tiefe das Tageslicht hereinflntet.
Die beiden Gestalten befinden sich im Halbdunkel des Vorder-
grundes; bezeichnend für Grünewald ist die Stellung des
Engels gegen das Licht, er sucht geradezu malerische Probleme.
Die inneren Seiten des Mittelbildcs schmücken zwei
Szenen anödem Leben des heiligen Antonius: die Versuchung
und der Besuch des Heiligen bei dem Eremiten Paulus.
Von allen Gemälden des ganzen Altares sind diese beiden
am besten erhalten. Der Heilige inmitten einer zudringlichen
Schar greulicher Ungeheuer war der Kunst jener Tage keine
neue Aufgabe. Schongauers großer Stich, den der junge
Michelangelo kopierte, ist das berühmteste Beispiel. Das
Grünewaldische an dieser Darstellung bekundet sich wieder
darin, daß er mit Freuden sein großes Können anwendet,
um all das mir der gleichen Beherrschung der Mittel zu
malen, was Schongauers Stichel gezeichnet harre.
Der Besuch des Antonius beim Eremiten Paulus gab dem Maler Gelegenheit zu einer farbig
empfundenen Landschaft. An Stelle einer Wüste, von der die Legende erzählt, malte er die Ein-
samkeit in klarer Nachmittagsbeleuchtung, die Farben ohne grell darauf fallendes Licht in satten
Tönen: braune Erde, rote Steine, grüne Bäume, im Mittelgrund ein frischgrünes Wiesenral, fern
blaue Berge, die in den Himmel hineinragen. Manche Einzelheiten erinnern an Altdorfer. Alles
auf dem Bilde, der violettgraue Mantel, die Vegetation, die Köpfe sind in ihrer eigentümlichen
Struktur malerisch aufgefaßt und in flüssiger Malweise breit behandelt.
Mathias Grünewald: Der heilige Antonius.
Seitenstück am Aenheimer Altar.