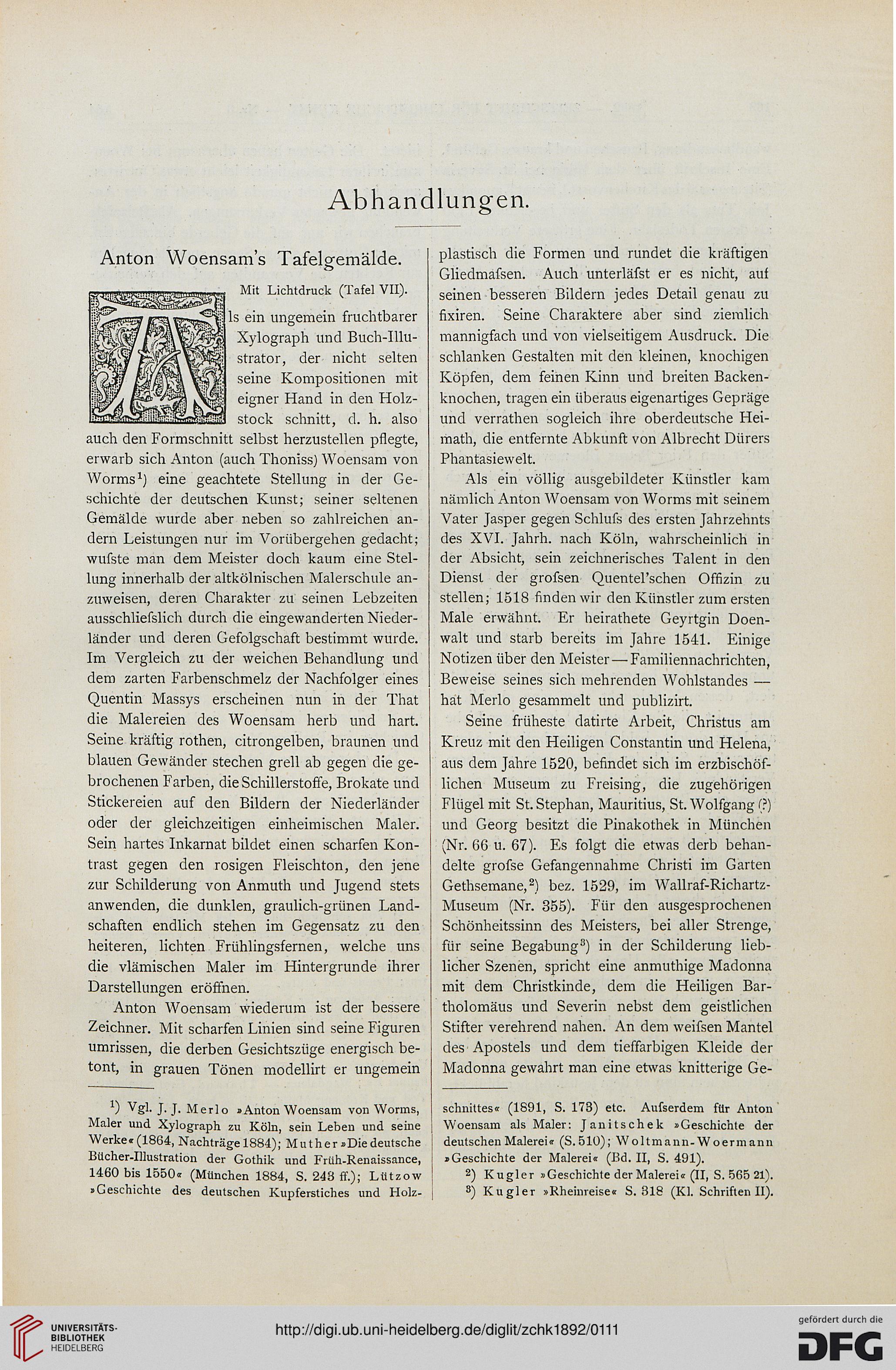Abhandlungen.
Anton Woensam's Tafelg-emälde.
Mit Lichtdruck (Tafel VII).
ls ein ungemein fruchtbarer
Xylograph und Buch-Illu-
strator, der nicht selten
seine Kompositionen mit
|j§ eigner Hand in den Holz-
stock schnitt, d. h. also
auch den Formschnitt selbst herzustellen pflegte,
erwarb sich Anton (auch Thoniss) Woensam von
Worms1) eine geachtete Stellung in der Ge-
schichte der deutschen Kunst; seiner seltenen
Gemälde wurde aber neben so zahlreichen an-
dern Leistungen nur im Vorübergehen gedacht;
wufste man dem Meister doch kaum eine Stel-
lung innerhalb der altkölnischen Malerschule an-
zuweisen, deren Charakter zu seinen Lebzeiten
ausschliefslich durch die eingewanderten Nieder-
länder und deren Gefolgschaft bestimmt wurde.
Im Vergleich zu der weichen Behandlung und
dem zarten Farbenschmelz der Nachfolger eines
Quentin Massys erscheinen nun in der That
die Malereien des Woensam herb und hart.
Seine kräftig rothen, citrongelben, braunen und
blauen Gewänder stechen grell ab gegen die ge-
brochenen Farben, die Schillerstoffe, Brokate und
Stickereien auf den Bildern der Niederländer
oder der gleichzeitigen einheimischen Maler.
Sein hartes Inkarnat bildet einen scharfen Kon-
trast gegen den rosigen Fleischton, den jene
zur Schilderung von Anmuth und Jugend stets
anwenden, die dunklen, graulich-grünen Land-
schaften endlich stehen im Gegensatz zu den
heiteren, lichten Frühlingsfernen, welche uns
die vlämischen Maler im Hintergrunde ihrer
Darstellungen eröffnen.
Anton Woensam wiederum ist der bessere
Zeichner. Mit scharfen Linien sind seine Figuren
umrissen, die derben Gesichtszüge energisch be-
tont, in grauen Tönen modellirt er ungemein
') Vgl- J-J. Merlo »Anton Woensam von Worms,
Maler und Xylograph zu Köln, sein Leben und seine
Werke«(1864, Nachträge 1884); Muther»Diedeutsche
Bücher-Illustration der Gothik und Friih-Renaissance,
1460 bis 1550» (München 1884, S. 243 ff.); Littzow
»Geschichte des deutschen Kupferstiches und Holz-
plastisch die Formen und rundet die kräftigen
Gliedmafsen. Auch unterläfst er es nicht, auf
seinen besseren Bildern jedes Detail genau zu
fixiren. Seine Charaktere aber sind ziemlich
mannigfach und von vielseitigem Ausdruck. Die
schlanken Gestalten mit den kleinen, knochigen
Köpfen, dem feinen Kinn und breiten Backen-
knochen, tragen ein überaus eigenartiges Gepräge
und verrathen sogleich ihre oberdeutsche Hei-
math, die entfernte Abkunft von Albrecht Dürers
Phantasiewelt.
Als ein völlig ausgebildeter Künstler kam
nämlich Anton Woensam von Worms mit seinem
Vater Jasper gegen Schlufs des ersten Jahrzehnts
des XVI. Jahrh. nach Köln, wahrscheinlich in
der Absicht, sein zeichnerisches Talent in den
Dienst der grofsen Quentel'schen Offizin zu
stellen; 1518 finden wir den Künstler zum ersten
Male erwähnt. Er heirathete Geyrtgin Doen-
walt und starb bereits im Jahre 1541. Einige
Notizen über den Meister — Familiennachrichten,
Beweise seines sich mehrenden Wohlstandes —
hat Merlo gesammelt und publizirt.
Seine früheste datirte Arbeit, Christus am
Kreuz mit den Heiligen Constantin und Helena,
aus dem Jahre 1520, befindet sich im erzbischöf-
lichen Museum zu Freising, die zugehörigen
Flügel mit St. Stephan, Mauritius, St. Wolfgang (?)
und Georg besitzt die Pinakothek in München
(Nr. 66 u. 67). Es folgt die etwas derb behan-
delte grofse Gefangennahme Christi im Garten
Gethsemane,2) bez. 1529, im Wallraf-Richartz-
Museum (Nr. 355). Für den ausgesprochenen
Schönheitssinn des Meisters, bei aller Strenge,
für seine Begabung8) in der Schilderung lieb-
licher Szenen, spricht eine anmuthige Madonna
mit dem Christkinde, dem die Heiligen Bar-
tholomäus und Severin nebst dem geistlichen
Stifter verehrend nahen. An dem weifsen Mantel
des Apostels und dem tieffarbigen Kleide der
Madonna gewahrt man eine etwas knitterige Ge-
schnittes« (1891, S. 173) etc. Aufserdem für Anton
Woensam als Maler: Janitschek »Geschichte der
deutschen Malerei« (S.510); Woltmann-Woermann
»Geschichte der Malerei« (Bd. II, S. 491).
2) Kugler »Geschichte der Malerei« (II, S. 565 21).
3) Kugler »Rheinreise« S. 318 (Kl. Schriften II).
Anton Woensam's Tafelg-emälde.
Mit Lichtdruck (Tafel VII).
ls ein ungemein fruchtbarer
Xylograph und Buch-Illu-
strator, der nicht selten
seine Kompositionen mit
|j§ eigner Hand in den Holz-
stock schnitt, d. h. also
auch den Formschnitt selbst herzustellen pflegte,
erwarb sich Anton (auch Thoniss) Woensam von
Worms1) eine geachtete Stellung in der Ge-
schichte der deutschen Kunst; seiner seltenen
Gemälde wurde aber neben so zahlreichen an-
dern Leistungen nur im Vorübergehen gedacht;
wufste man dem Meister doch kaum eine Stel-
lung innerhalb der altkölnischen Malerschule an-
zuweisen, deren Charakter zu seinen Lebzeiten
ausschliefslich durch die eingewanderten Nieder-
länder und deren Gefolgschaft bestimmt wurde.
Im Vergleich zu der weichen Behandlung und
dem zarten Farbenschmelz der Nachfolger eines
Quentin Massys erscheinen nun in der That
die Malereien des Woensam herb und hart.
Seine kräftig rothen, citrongelben, braunen und
blauen Gewänder stechen grell ab gegen die ge-
brochenen Farben, die Schillerstoffe, Brokate und
Stickereien auf den Bildern der Niederländer
oder der gleichzeitigen einheimischen Maler.
Sein hartes Inkarnat bildet einen scharfen Kon-
trast gegen den rosigen Fleischton, den jene
zur Schilderung von Anmuth und Jugend stets
anwenden, die dunklen, graulich-grünen Land-
schaften endlich stehen im Gegensatz zu den
heiteren, lichten Frühlingsfernen, welche uns
die vlämischen Maler im Hintergrunde ihrer
Darstellungen eröffnen.
Anton Woensam wiederum ist der bessere
Zeichner. Mit scharfen Linien sind seine Figuren
umrissen, die derben Gesichtszüge energisch be-
tont, in grauen Tönen modellirt er ungemein
') Vgl- J-J. Merlo »Anton Woensam von Worms,
Maler und Xylograph zu Köln, sein Leben und seine
Werke«(1864, Nachträge 1884); Muther»Diedeutsche
Bücher-Illustration der Gothik und Friih-Renaissance,
1460 bis 1550» (München 1884, S. 243 ff.); Littzow
»Geschichte des deutschen Kupferstiches und Holz-
plastisch die Formen und rundet die kräftigen
Gliedmafsen. Auch unterläfst er es nicht, auf
seinen besseren Bildern jedes Detail genau zu
fixiren. Seine Charaktere aber sind ziemlich
mannigfach und von vielseitigem Ausdruck. Die
schlanken Gestalten mit den kleinen, knochigen
Köpfen, dem feinen Kinn und breiten Backen-
knochen, tragen ein überaus eigenartiges Gepräge
und verrathen sogleich ihre oberdeutsche Hei-
math, die entfernte Abkunft von Albrecht Dürers
Phantasiewelt.
Als ein völlig ausgebildeter Künstler kam
nämlich Anton Woensam von Worms mit seinem
Vater Jasper gegen Schlufs des ersten Jahrzehnts
des XVI. Jahrh. nach Köln, wahrscheinlich in
der Absicht, sein zeichnerisches Talent in den
Dienst der grofsen Quentel'schen Offizin zu
stellen; 1518 finden wir den Künstler zum ersten
Male erwähnt. Er heirathete Geyrtgin Doen-
walt und starb bereits im Jahre 1541. Einige
Notizen über den Meister — Familiennachrichten,
Beweise seines sich mehrenden Wohlstandes —
hat Merlo gesammelt und publizirt.
Seine früheste datirte Arbeit, Christus am
Kreuz mit den Heiligen Constantin und Helena,
aus dem Jahre 1520, befindet sich im erzbischöf-
lichen Museum zu Freising, die zugehörigen
Flügel mit St. Stephan, Mauritius, St. Wolfgang (?)
und Georg besitzt die Pinakothek in München
(Nr. 66 u. 67). Es folgt die etwas derb behan-
delte grofse Gefangennahme Christi im Garten
Gethsemane,2) bez. 1529, im Wallraf-Richartz-
Museum (Nr. 355). Für den ausgesprochenen
Schönheitssinn des Meisters, bei aller Strenge,
für seine Begabung8) in der Schilderung lieb-
licher Szenen, spricht eine anmuthige Madonna
mit dem Christkinde, dem die Heiligen Bar-
tholomäus und Severin nebst dem geistlichen
Stifter verehrend nahen. An dem weifsen Mantel
des Apostels und dem tieffarbigen Kleide der
Madonna gewahrt man eine etwas knitterige Ge-
schnittes« (1891, S. 173) etc. Aufserdem für Anton
Woensam als Maler: Janitschek »Geschichte der
deutschen Malerei« (S.510); Woltmann-Woermann
»Geschichte der Malerei« (Bd. II, S. 491).
2) Kugler »Geschichte der Malerei« (II, S. 565 21).
3) Kugler »Rheinreise« S. 318 (Kl. Schriften II).