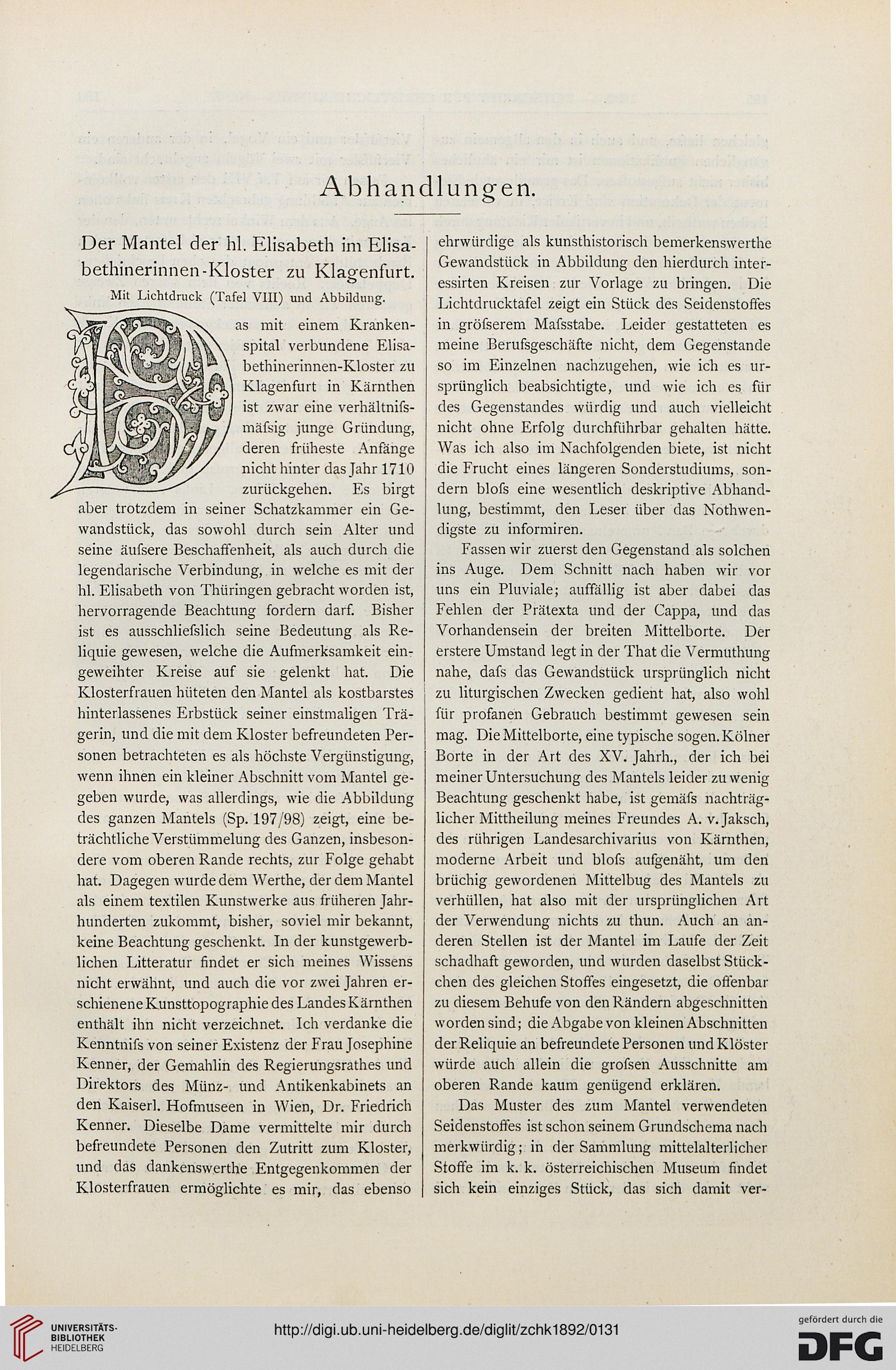Abhandlungen.
Der Mantel der hl. Elisabeth im Elisa-
bethinerinnen-Kloster zu Klagenfurt.
Mit Lichtdruck (Tafel VIII) und Abbildung.
as mit einem Kranken-
spital verbundene Elisa-
bethinerinnen-Kloster zu
Klagenfurt in Kärnthen
ist zwar eine verhältnifs-
mäfsig junge Gründung,
deren früheste Anfänge
nicht hinter das Jahr 1710
zurückgehen. Es birgt
aber trotzdem in seiner Schatzkammer ein Ge-
wandstück, das sowohl durch sein Alter und
seine äufsere Beschaffenheit, als auch durch die
legendarische Verbindung, in welche es mit der
hl. Elisabeth von Thüringen gebracht worden ist,
hervorragende Beachtung fordern darf. Bisher
ist es ausschliefslich seine Bedeutung als Re-
liquie gewesen, welche die Aufmerksamkeit ein-
geweihter Kreise auf sie gelenkt hat. Die
Klosterfrauen hüteten den Mantel als kostbarstes
hinterlassenes Erbstück seiner einstmaligen Trä-
gerin, und die mit dem Kloster befreundeten Per-
sonen betrachteten es als höchste Vergünstigung,
wenn ihnen ein kleiner Abschnitt vom Mantel ge-
geben wurde, was allerdings, wie die Abbildung
des ganzen Mantels (Sp. 197/98) zeigt, eine be-
trächtliche Verstümmelung des Ganzen, insbeson-
dere vom oberen Rande rechts, zur Folge gehabt
hat. Dagegen wurde dem Werthe, der dem Mantel
als einem textilen Kunstwerke aus früheren Jahr-
hunderten zukommt, bisher, soviel mir bekannt,
keine Beachtung geschenkt. In der kunstgewerb-
lichen Litteratur findet er sich meines Wissens
nicht erwähnt, und auch die vor zwei Jahren er-
schienene Kunsttopographie des Landes Kärnthen
enthält ihn nicht verzeichnet. Ich verdanke die
Kenntnifs von seiner Existenz der Frau Josephine
Kenner, der Gemahlin des Regierungsrathes und
Direktors des Münz- und Antikenkabinets an
den Kaiserl. Hofmuseen in Wien, Dr. Friedrich
Kenner. Dieselbe Dame vermittelte mir durch
befreundete Personen den Zutritt zum Kloster,
und das dankenswerthe Entgegenkommen der
Klosterfrauen ermöglichte es mir, das ebenso
ehrwürdige als kunsthistolisch bemerkenswerthe
Gewandstück in Abbildung den hierdurch inter-
essirten Kreisen zur Vorlage zu bringen. Die
Lichtdrucktafel zeigt ein Stück des Seidenstoffes
in gröfserem Mafsstabe. Leider gestatteten es
meine Berufsgeschäfte nicht, dem Gegenstande
so im Einzelnen nachzugehen, wie ich es ur-
sprünglich beabsichtigte, und wie ich es für
des Gegenstandes würdig und auch vielleicht
nicht ohne Erfolg durchführbar gehalten hätte.
Was ich also im Nachfolgenden biete, ist nicht
die Frucht eines längeren Sonderstudiums, son-
dern blofs eine wesentlich deskriptive Abhand-
lung, bestimmt, den Leser über das Nothwen-
digste zu informiren.
Fassen wir zuerst den Gegenstand als solchen
ins Auge. Dem Schnitt nach haben wir vor
uns ein Pluviale; auffällig ist aber dabei das
Fehlen der Prätexta und der Cappa, und das
Vorhandensein der breiten Mittelborte. Der
erstere Umstand legt in der That die Vermuthung
nahe, dafs das Gewandstück ursprünglich nicht
zu liturgischen Zwecken gedient hat, also wohl
für profanen Gebrauch bestimmt gewesen sein
mag. Die Mittelborte, eine typische sogen. Kölner
Borte in der Art des XV. Jahrh., der ich bei
meiner Untersuchung des Mantels leider zuwenig
Beachtung geschenkt habe, ist gemäfs nachträg-
licher Mittheilung meines Freundes A. v.Jaksch,
des rührigen Landesarchivarius von Kärnthen,
moderne Arbeit und blofs aufgenäht, um den
brüchig gewordenen Mittelbug des Mantels zu
verhüllen, hat also mit der ursprünglichen Art
der Verwendung nichts zu thun. Auch an an-
deren Stellen ist der Mantel im Laufe der Zeit
schadhaft geworden, und wurden daselbst Stück-
chen des gleichen Stoffes eingesetzt, die offenbar
zu diesem Behufe von den Rändern abgeschnitten
worden sind; die Abgabe von kleinen Abschnitten
der Reliquie an befreundete Personen und Klöster
würde auch allein die grofsen Ausschnitte am
oberen Rande kaum genügend erklären.
Das Muster des zum Mantel verwendeten
Seidenstoffes ist schon seinem Grundschema nach
merkwürdig; in der Sammlung mittelalterlicher
Stoffe im k. k. österreichischen Museum findet
sich kein einziges Stück, das sich damit ver-
Der Mantel der hl. Elisabeth im Elisa-
bethinerinnen-Kloster zu Klagenfurt.
Mit Lichtdruck (Tafel VIII) und Abbildung.
as mit einem Kranken-
spital verbundene Elisa-
bethinerinnen-Kloster zu
Klagenfurt in Kärnthen
ist zwar eine verhältnifs-
mäfsig junge Gründung,
deren früheste Anfänge
nicht hinter das Jahr 1710
zurückgehen. Es birgt
aber trotzdem in seiner Schatzkammer ein Ge-
wandstück, das sowohl durch sein Alter und
seine äufsere Beschaffenheit, als auch durch die
legendarische Verbindung, in welche es mit der
hl. Elisabeth von Thüringen gebracht worden ist,
hervorragende Beachtung fordern darf. Bisher
ist es ausschliefslich seine Bedeutung als Re-
liquie gewesen, welche die Aufmerksamkeit ein-
geweihter Kreise auf sie gelenkt hat. Die
Klosterfrauen hüteten den Mantel als kostbarstes
hinterlassenes Erbstück seiner einstmaligen Trä-
gerin, und die mit dem Kloster befreundeten Per-
sonen betrachteten es als höchste Vergünstigung,
wenn ihnen ein kleiner Abschnitt vom Mantel ge-
geben wurde, was allerdings, wie die Abbildung
des ganzen Mantels (Sp. 197/98) zeigt, eine be-
trächtliche Verstümmelung des Ganzen, insbeson-
dere vom oberen Rande rechts, zur Folge gehabt
hat. Dagegen wurde dem Werthe, der dem Mantel
als einem textilen Kunstwerke aus früheren Jahr-
hunderten zukommt, bisher, soviel mir bekannt,
keine Beachtung geschenkt. In der kunstgewerb-
lichen Litteratur findet er sich meines Wissens
nicht erwähnt, und auch die vor zwei Jahren er-
schienene Kunsttopographie des Landes Kärnthen
enthält ihn nicht verzeichnet. Ich verdanke die
Kenntnifs von seiner Existenz der Frau Josephine
Kenner, der Gemahlin des Regierungsrathes und
Direktors des Münz- und Antikenkabinets an
den Kaiserl. Hofmuseen in Wien, Dr. Friedrich
Kenner. Dieselbe Dame vermittelte mir durch
befreundete Personen den Zutritt zum Kloster,
und das dankenswerthe Entgegenkommen der
Klosterfrauen ermöglichte es mir, das ebenso
ehrwürdige als kunsthistolisch bemerkenswerthe
Gewandstück in Abbildung den hierdurch inter-
essirten Kreisen zur Vorlage zu bringen. Die
Lichtdrucktafel zeigt ein Stück des Seidenstoffes
in gröfserem Mafsstabe. Leider gestatteten es
meine Berufsgeschäfte nicht, dem Gegenstande
so im Einzelnen nachzugehen, wie ich es ur-
sprünglich beabsichtigte, und wie ich es für
des Gegenstandes würdig und auch vielleicht
nicht ohne Erfolg durchführbar gehalten hätte.
Was ich also im Nachfolgenden biete, ist nicht
die Frucht eines längeren Sonderstudiums, son-
dern blofs eine wesentlich deskriptive Abhand-
lung, bestimmt, den Leser über das Nothwen-
digste zu informiren.
Fassen wir zuerst den Gegenstand als solchen
ins Auge. Dem Schnitt nach haben wir vor
uns ein Pluviale; auffällig ist aber dabei das
Fehlen der Prätexta und der Cappa, und das
Vorhandensein der breiten Mittelborte. Der
erstere Umstand legt in der That die Vermuthung
nahe, dafs das Gewandstück ursprünglich nicht
zu liturgischen Zwecken gedient hat, also wohl
für profanen Gebrauch bestimmt gewesen sein
mag. Die Mittelborte, eine typische sogen. Kölner
Borte in der Art des XV. Jahrh., der ich bei
meiner Untersuchung des Mantels leider zuwenig
Beachtung geschenkt habe, ist gemäfs nachträg-
licher Mittheilung meines Freundes A. v.Jaksch,
des rührigen Landesarchivarius von Kärnthen,
moderne Arbeit und blofs aufgenäht, um den
brüchig gewordenen Mittelbug des Mantels zu
verhüllen, hat also mit der ursprünglichen Art
der Verwendung nichts zu thun. Auch an an-
deren Stellen ist der Mantel im Laufe der Zeit
schadhaft geworden, und wurden daselbst Stück-
chen des gleichen Stoffes eingesetzt, die offenbar
zu diesem Behufe von den Rändern abgeschnitten
worden sind; die Abgabe von kleinen Abschnitten
der Reliquie an befreundete Personen und Klöster
würde auch allein die grofsen Ausschnitte am
oberen Rande kaum genügend erklären.
Das Muster des zum Mantel verwendeten
Seidenstoffes ist schon seinem Grundschema nach
merkwürdig; in der Sammlung mittelalterlicher
Stoffe im k. k. österreichischen Museum findet
sich kein einziges Stück, das sich damit ver-