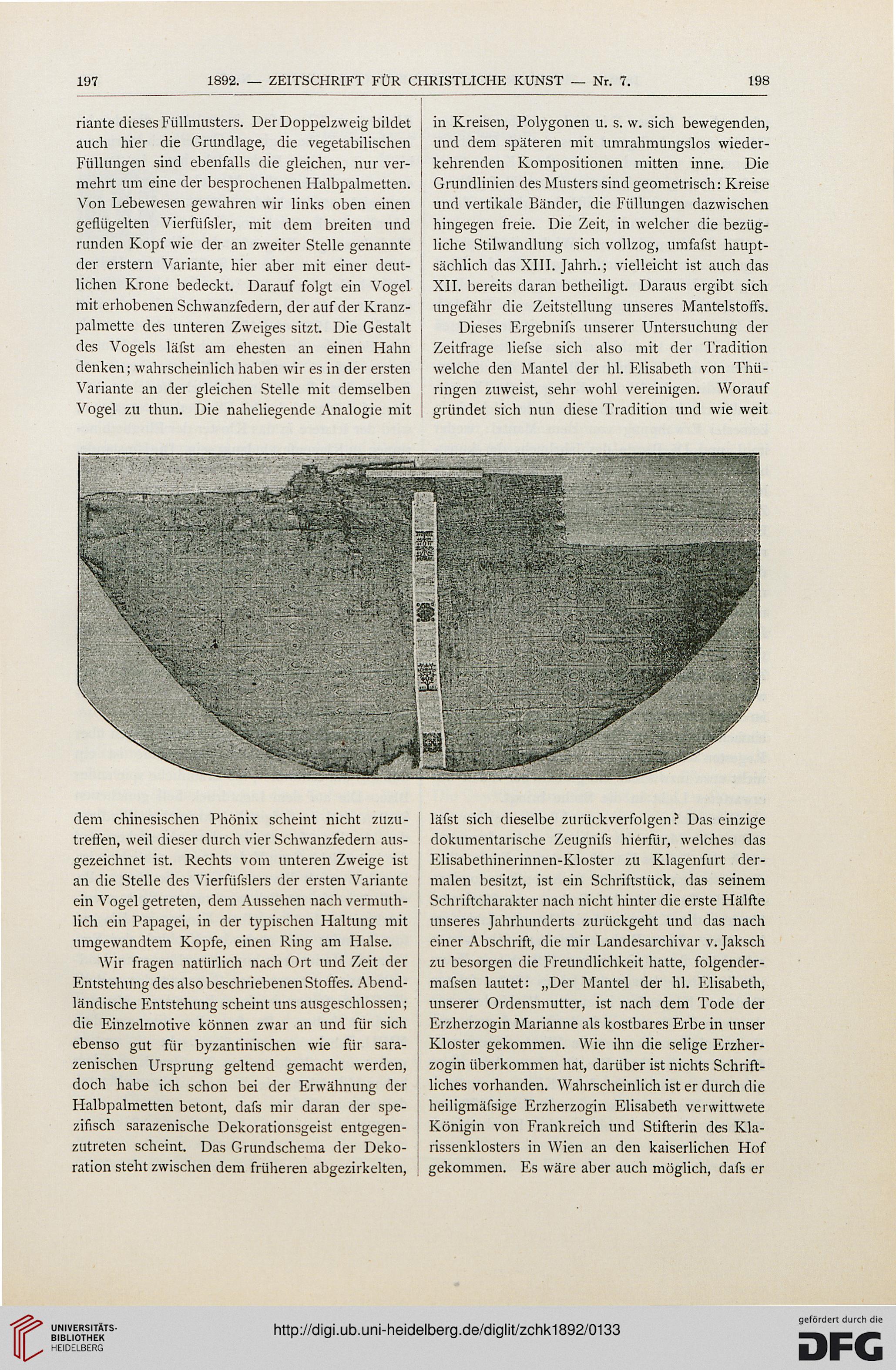197
1892.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
198
riante dieses Füllmusters. Der Doppelzweig bildet
auch hier die Grundlage, die vegetabilischen
Füllungen sind ebenfalls die gleichen, nur ver-
mehrt um eine der besprochenen Halbpalmetten.
Von Lebewesen gewahren wir links oben einen
geflügelten Vierfüfsler, mit dem breiten und
runden Kopf wie der an zweiter Stelle genannte
der erstem Variante, hier aber mit einer deut-
lichen Krone bedeckt. Darauf folgt ein Vogel
mit erhobenen Schwanzfedern, der auf der Kranz-
palmette des unteren Zweiges sitzt. Die Gestalt
des Vogels läfst am ehesten an einen Hahn
denken; wahrscheinlich haben wir es in der ersten
Variante an der gleichen Stelle mit demselben
Vogel zu thun. Die naheliegende Analogie mit
in Kreisen, Polygonen u. s. w. sich bewegenden,
und dem späteren mit umrahmungslos wieder-
kehrenden Kompositionen mitten inne. Die
Grundlinien des Musters sind geometrisch: Kreise
und vertikale Bänder, die Füllungen dazwischen
hingegen freie. Die Zeit, in welcher die bezüg-
liche Stilwandlung sich vollzog, umfafst haupt-
sächlich das XIII. Jahrh.; vielleicht ist auch das
XII. bereits daran betheiligt. Daraus ergibt sich
ungefähr die Zeitstellung unseres Mantelstoffs.
Dieses Ergebnifs unserer Untersuchung der
Zeitfrage liefse sich also mit der Tradition
welche den Mantel der hl. Elisabeth von Thü-
ringen zuweist, sehr wohl vereinigen. Worauf
gründet sich nun diese Tradition und wie weit
fc
TÄ*-*^
*^S6s*&
iSC
^M
dem chinesischen Phönix scheint nicht zuzu-
treffen, weil dieser durch vier Schwanzfedern aus-
gezeichnet ist. Rechts vom unteren Zweige ist
an die Stelle des Vierfüfslers der ersten Variante
ein Vogel getreten, dem Aussehen nach vermuth-
lich ein Papagei, in der typischen Haltung mit
umgewandtem Kopfe, einen Ring am Halse.
Wir fragen natürlich nach Ort und Zeit der
Entstehung des also beschriebenen Stoffes. Abend-
ländische Entstehung scheint uns ausgeschlossen;
die Einzehnotive können zwar an und für sich
ebenso gut für byzantinischen wie für sara-
zenischen Ursprung geltend gemacht werden,
doch habe ich schon bei der Erwähnung der
Halbpalmetten betont, dafs mir daran der spe-
zifisch sarazenische Dekorationsgeist entgegen-
zutreten scheint. Das Grundschema der Deko-
ration steht zwischen dem früheren abgezirkelten,
läfst sich dieselbe zurückverfolgen? Das einzige
dokumentarische Zeugnifs hierfür, welches das
Elisabethinerinnen-Kloster zu Klagenfurt der-
malen besitzt, ist ein Schriftstück, das seinem
Schriftcharakter nach nicht hinter die erste Hälfte
unseres Jahrhunderts zurückgeht und das nach
einer Abschrift, die mir Landesarchivar v. Jaksch
zu besorgen die Freundlichkeit hatte, folgender-
mafsen lautet: „Der Mantel der hl. Elisabeth,
unserer Ordensmutter, ist nach dem Tode der
Erzherzogin Marianne als kostbares Erbe in unser
Kloster gekommen. Wie ihn die selige Erzher-
zogin überkommen hat, darüber ist nichts Schrift-
liches vorhanden. Wahrscheinlich ist er durch die
heiligmäfsige Erzherzogin Elisabeth verwittwete
Königin von Frankreich und Stifterin des Kla-
rissenklosters in Wien an den kaiserlichen Hof
gekommen. Es wäre aber auch möglich, dafs er
1892.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 7.
198
riante dieses Füllmusters. Der Doppelzweig bildet
auch hier die Grundlage, die vegetabilischen
Füllungen sind ebenfalls die gleichen, nur ver-
mehrt um eine der besprochenen Halbpalmetten.
Von Lebewesen gewahren wir links oben einen
geflügelten Vierfüfsler, mit dem breiten und
runden Kopf wie der an zweiter Stelle genannte
der erstem Variante, hier aber mit einer deut-
lichen Krone bedeckt. Darauf folgt ein Vogel
mit erhobenen Schwanzfedern, der auf der Kranz-
palmette des unteren Zweiges sitzt. Die Gestalt
des Vogels läfst am ehesten an einen Hahn
denken; wahrscheinlich haben wir es in der ersten
Variante an der gleichen Stelle mit demselben
Vogel zu thun. Die naheliegende Analogie mit
in Kreisen, Polygonen u. s. w. sich bewegenden,
und dem späteren mit umrahmungslos wieder-
kehrenden Kompositionen mitten inne. Die
Grundlinien des Musters sind geometrisch: Kreise
und vertikale Bänder, die Füllungen dazwischen
hingegen freie. Die Zeit, in welcher die bezüg-
liche Stilwandlung sich vollzog, umfafst haupt-
sächlich das XIII. Jahrh.; vielleicht ist auch das
XII. bereits daran betheiligt. Daraus ergibt sich
ungefähr die Zeitstellung unseres Mantelstoffs.
Dieses Ergebnifs unserer Untersuchung der
Zeitfrage liefse sich also mit der Tradition
welche den Mantel der hl. Elisabeth von Thü-
ringen zuweist, sehr wohl vereinigen. Worauf
gründet sich nun diese Tradition und wie weit
fc
TÄ*-*^
*^S6s*&
iSC
^M
dem chinesischen Phönix scheint nicht zuzu-
treffen, weil dieser durch vier Schwanzfedern aus-
gezeichnet ist. Rechts vom unteren Zweige ist
an die Stelle des Vierfüfslers der ersten Variante
ein Vogel getreten, dem Aussehen nach vermuth-
lich ein Papagei, in der typischen Haltung mit
umgewandtem Kopfe, einen Ring am Halse.
Wir fragen natürlich nach Ort und Zeit der
Entstehung des also beschriebenen Stoffes. Abend-
ländische Entstehung scheint uns ausgeschlossen;
die Einzehnotive können zwar an und für sich
ebenso gut für byzantinischen wie für sara-
zenischen Ursprung geltend gemacht werden,
doch habe ich schon bei der Erwähnung der
Halbpalmetten betont, dafs mir daran der spe-
zifisch sarazenische Dekorationsgeist entgegen-
zutreten scheint. Das Grundschema der Deko-
ration steht zwischen dem früheren abgezirkelten,
läfst sich dieselbe zurückverfolgen? Das einzige
dokumentarische Zeugnifs hierfür, welches das
Elisabethinerinnen-Kloster zu Klagenfurt der-
malen besitzt, ist ein Schriftstück, das seinem
Schriftcharakter nach nicht hinter die erste Hälfte
unseres Jahrhunderts zurückgeht und das nach
einer Abschrift, die mir Landesarchivar v. Jaksch
zu besorgen die Freundlichkeit hatte, folgender-
mafsen lautet: „Der Mantel der hl. Elisabeth,
unserer Ordensmutter, ist nach dem Tode der
Erzherzogin Marianne als kostbares Erbe in unser
Kloster gekommen. Wie ihn die selige Erzher-
zogin überkommen hat, darüber ist nichts Schrift-
liches vorhanden. Wahrscheinlich ist er durch die
heiligmäfsige Erzherzogin Elisabeth verwittwete
Königin von Frankreich und Stifterin des Kla-
rissenklosters in Wien an den kaiserlichen Hof
gekommen. Es wäre aber auch möglich, dafs er