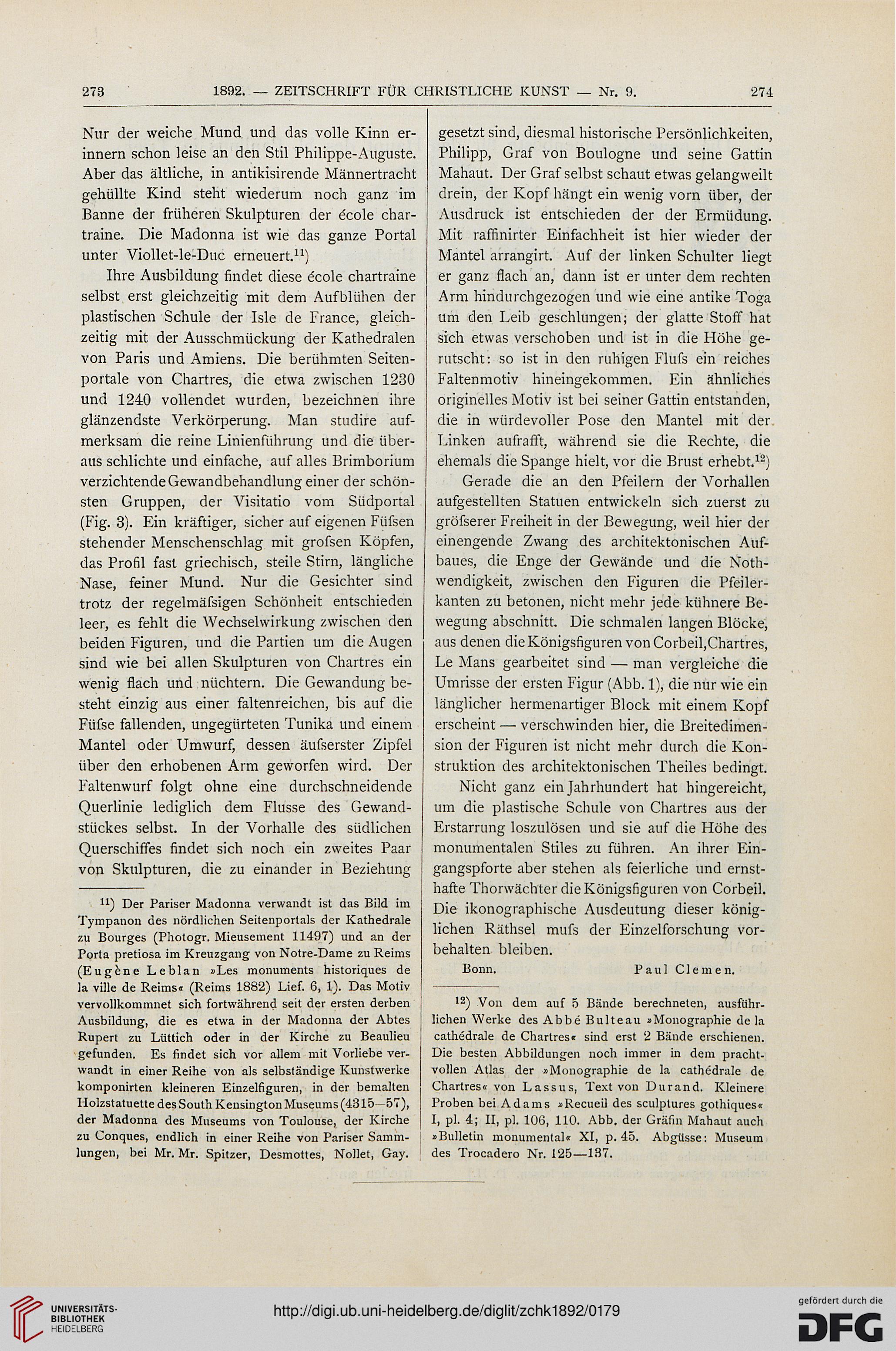273
1892. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
274
Nur der weiche Mund und das volle Kinn er-
innern schon leise an den Stil Philippe-Auguste.
Aber das ältliche, in antikisirende Männertracht
gehüllte Kind steht wiederum noch ganz im
Banne der früheren Skulpturen der dcole char-
traine. Die Madonna ist wie das ganze Portal
unter Viollet-le-Duc erneuert.11)
Ihre Ausbildung findet diese ecole chartraine
selbst erst gleichzeitig mit dem Aufblühen der
plastischen Schule der Isle de France, gleich-
zeitig mit der Ausschmückung der Kathedralen
von Paris und Amiens. Die berühmten Seiten-
portale von Chartres, die etwa zwischen 1230
und 1240 vollendet wurden, bezeichnen ihre
glänzendste Verkörperung. Man studire auf-
merksam die reine Linienführung und die über-
aus schlichte und einfache, auf alles Brimborium
verzichtende Gewandbehandlung einer der schön-
sten Gruppen, der Visitatio vom Südportal
(Fig. 3). Ein kräftiger, sicher auf eigenen Füfsen
stehender Menschenschlag mit grofsen Köpfen,
das Profil fast griechisch, steile Stirn, längliche
Nase, feiner Mund. Nur die Gesichter sind
trotz der regelmäfsigen Schönheit entschieden
leer, es fehlt die Wechselwirkung zwischen den
beiden Figuren, und die Partien um die Augen
sind wie bei allen Skulpturen von Chartres ein
wenig flach und nüchtern. Die Gewandung be-
steht einzig aus einer faltenreichen, bis auf die
Füfse fallenden, ungegürteten Tunika und einem
Mantel oder Umwurf, dessen äufserster Zipfel
über den erhobenen Arm geworfen wird. Der
Faltenwurf folgt ohne eine durchschneidende
Querlinie lediglich dem Flusse des Gewand-
stückes selbst. In der Vorhalle des südlichen
Querschiffes findet sich noch ein zweites Paar
von Skulpturen, die zu einander in Beziehung
n) Der Pariser Madonna verwandt ist das Bild im
Tympanon des nördlichen Seitenportals der Kathedrale
zu Bourges (Photogr. Mieusement 11497) und an der
Porta pretiosa im Kreuzgang von Notre-Dame zu Reims
(Eugene Leblan »Les monuments historiques de
la ville de Reims« (Reims 1882) Lief. G, 1). Das Motiv
vervollkommnet sich fortwährend seit der ersten derben
Ausbildung, die es etwa in der Madonna der Abtes
Rupert zu Lüttich oder in der Kirche zu Beaulieu
gefunden. Es findet sich vor allem mit Vorliebe ver-
wandt in einer Reihe von als selbständige Kunstwerke
komponirten kleineren Einzelfiguren, in der bemalten
Holzstatuette des South Kensington Museums (4315-57),
der Madonna des Museums von Toulouse, der Kirche
zu Conques, endlich in einer Reihe von Pariser Samm-
lungen, bei Mr. Mr. Spitzer, Desmottes, Nollet, Gay.
gesetzt sind, diesmal historische Persönlichkeiten,
Philipp, Graf von Boulogne und seine Gattin
Mahaut. Der Graf selbst schaut etwas gelangweilt
drein, der Kopf hängt ein wenig vorn über, der
Ausdruck ist entschieden der der Ermüdung.
Mit raffinirter Einfachheit ist hier wieder der
Mantel arrangirt. Auf der linken Schulter liegt
er ganz flach an, dann ist er unter dem rechten
Arm hindurchgezogen und wie eine antike Toga
um den Leib geschlungen; der glatte Stoff hat
sich etwas verschoben und ist in die Höhe ge-
rutscht: so ist in den ruhigen Flufs ein reiches
Faltenmotiv hineingekommen. Ein ähnliches
originelles Motiv ist bei seiner Gattin entstanden,
die in würdevoller Pose den Mantel mit der
Linken aufrafft, während sie die Rechte, die
ehemals die Spange hielt, vor die Brust erhebt.12)
Gerade die an den Pfeilern der Vorhallen
aufgestellten Statuen entwickeln sich zuerst zu
gröfserer Freiheit in der Bewegung, weil hier der
einengende Zwang des architektonischen Auf-
baues, die Enge der Gewände und die Noth-
wendigkeit, zwischen den Figuren die Pfeiler-
kanten zu betonen, nicht mehr jede kühnere Be-
wegung abschnitt. Die schmalen langen Blöcke,
aus denen die Königsfiguren von Corbeil,Chartres,
Le Mans gearbeitet sind — man vergleiche die
Umrisse der ersten Figur (Abb. 1), die nur wie ein
länglicher hermenartiger Block mit einem Kopf
erscheint — verschwinden hier, die Breitedimen-
sion der Figuren ist nicht mehr durch die Kon-
struktion des architektonischen Theiles bedingt.
Nicht ganz ein Jahrhundert hat hingereicht,
um die plastische Schule von Chartres aus der
Erstarrung loszulösen und sie auf die Höhe des
monumentalen Stiles zu führen. An ihrer Ein-
gangspforte aber stehen als feierliche und ernst-
hafte Thorwächter die Königsfiguren von Corbeil.
Die ikonographische Ausdeutung dieser könig-
lichen Räthsel mufs der Einzelforschung vor-
behalten bleiben.
Bonn. Paul C1 e m e n.
■2) Von dem auf 5 Bände berechneten, ausführ-
lichen Werke des Abbe Bulteau »Monographie de la
cathedrale de Chartres» sind erst 2 Bände erschienen.
Die besten Abbildungen noch immer in dem pracht-
vollen Atlas der »Monographie de la cathedrale de
Chartres« von Lassus, Text von Durand. Kleinere
Proben bei Adams »Recueil des sculptures gothiques«
I, pl. 4; II, pl. 106, 110. Abb. der Gräfin Mahaut auch
»Bulletin monumental« XI, p. 45. Abgüsse: Museum
des Trocadero Nr. 125—137.
1892. — ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 9.
274
Nur der weiche Mund und das volle Kinn er-
innern schon leise an den Stil Philippe-Auguste.
Aber das ältliche, in antikisirende Männertracht
gehüllte Kind steht wiederum noch ganz im
Banne der früheren Skulpturen der dcole char-
traine. Die Madonna ist wie das ganze Portal
unter Viollet-le-Duc erneuert.11)
Ihre Ausbildung findet diese ecole chartraine
selbst erst gleichzeitig mit dem Aufblühen der
plastischen Schule der Isle de France, gleich-
zeitig mit der Ausschmückung der Kathedralen
von Paris und Amiens. Die berühmten Seiten-
portale von Chartres, die etwa zwischen 1230
und 1240 vollendet wurden, bezeichnen ihre
glänzendste Verkörperung. Man studire auf-
merksam die reine Linienführung und die über-
aus schlichte und einfache, auf alles Brimborium
verzichtende Gewandbehandlung einer der schön-
sten Gruppen, der Visitatio vom Südportal
(Fig. 3). Ein kräftiger, sicher auf eigenen Füfsen
stehender Menschenschlag mit grofsen Köpfen,
das Profil fast griechisch, steile Stirn, längliche
Nase, feiner Mund. Nur die Gesichter sind
trotz der regelmäfsigen Schönheit entschieden
leer, es fehlt die Wechselwirkung zwischen den
beiden Figuren, und die Partien um die Augen
sind wie bei allen Skulpturen von Chartres ein
wenig flach und nüchtern. Die Gewandung be-
steht einzig aus einer faltenreichen, bis auf die
Füfse fallenden, ungegürteten Tunika und einem
Mantel oder Umwurf, dessen äufserster Zipfel
über den erhobenen Arm geworfen wird. Der
Faltenwurf folgt ohne eine durchschneidende
Querlinie lediglich dem Flusse des Gewand-
stückes selbst. In der Vorhalle des südlichen
Querschiffes findet sich noch ein zweites Paar
von Skulpturen, die zu einander in Beziehung
n) Der Pariser Madonna verwandt ist das Bild im
Tympanon des nördlichen Seitenportals der Kathedrale
zu Bourges (Photogr. Mieusement 11497) und an der
Porta pretiosa im Kreuzgang von Notre-Dame zu Reims
(Eugene Leblan »Les monuments historiques de
la ville de Reims« (Reims 1882) Lief. G, 1). Das Motiv
vervollkommnet sich fortwährend seit der ersten derben
Ausbildung, die es etwa in der Madonna der Abtes
Rupert zu Lüttich oder in der Kirche zu Beaulieu
gefunden. Es findet sich vor allem mit Vorliebe ver-
wandt in einer Reihe von als selbständige Kunstwerke
komponirten kleineren Einzelfiguren, in der bemalten
Holzstatuette des South Kensington Museums (4315-57),
der Madonna des Museums von Toulouse, der Kirche
zu Conques, endlich in einer Reihe von Pariser Samm-
lungen, bei Mr. Mr. Spitzer, Desmottes, Nollet, Gay.
gesetzt sind, diesmal historische Persönlichkeiten,
Philipp, Graf von Boulogne und seine Gattin
Mahaut. Der Graf selbst schaut etwas gelangweilt
drein, der Kopf hängt ein wenig vorn über, der
Ausdruck ist entschieden der der Ermüdung.
Mit raffinirter Einfachheit ist hier wieder der
Mantel arrangirt. Auf der linken Schulter liegt
er ganz flach an, dann ist er unter dem rechten
Arm hindurchgezogen und wie eine antike Toga
um den Leib geschlungen; der glatte Stoff hat
sich etwas verschoben und ist in die Höhe ge-
rutscht: so ist in den ruhigen Flufs ein reiches
Faltenmotiv hineingekommen. Ein ähnliches
originelles Motiv ist bei seiner Gattin entstanden,
die in würdevoller Pose den Mantel mit der
Linken aufrafft, während sie die Rechte, die
ehemals die Spange hielt, vor die Brust erhebt.12)
Gerade die an den Pfeilern der Vorhallen
aufgestellten Statuen entwickeln sich zuerst zu
gröfserer Freiheit in der Bewegung, weil hier der
einengende Zwang des architektonischen Auf-
baues, die Enge der Gewände und die Noth-
wendigkeit, zwischen den Figuren die Pfeiler-
kanten zu betonen, nicht mehr jede kühnere Be-
wegung abschnitt. Die schmalen langen Blöcke,
aus denen die Königsfiguren von Corbeil,Chartres,
Le Mans gearbeitet sind — man vergleiche die
Umrisse der ersten Figur (Abb. 1), die nur wie ein
länglicher hermenartiger Block mit einem Kopf
erscheint — verschwinden hier, die Breitedimen-
sion der Figuren ist nicht mehr durch die Kon-
struktion des architektonischen Theiles bedingt.
Nicht ganz ein Jahrhundert hat hingereicht,
um die plastische Schule von Chartres aus der
Erstarrung loszulösen und sie auf die Höhe des
monumentalen Stiles zu führen. An ihrer Ein-
gangspforte aber stehen als feierliche und ernst-
hafte Thorwächter die Königsfiguren von Corbeil.
Die ikonographische Ausdeutung dieser könig-
lichen Räthsel mufs der Einzelforschung vor-
behalten bleiben.
Bonn. Paul C1 e m e n.
■2) Von dem auf 5 Bände berechneten, ausführ-
lichen Werke des Abbe Bulteau »Monographie de la
cathedrale de Chartres» sind erst 2 Bände erschienen.
Die besten Abbildungen noch immer in dem pracht-
vollen Atlas der »Monographie de la cathedrale de
Chartres« von Lassus, Text von Durand. Kleinere
Proben bei Adams »Recueil des sculptures gothiques«
I, pl. 4; II, pl. 106, 110. Abb. der Gräfin Mahaut auch
»Bulletin monumental« XI, p. 45. Abgüsse: Museum
des Trocadero Nr. 125—137.