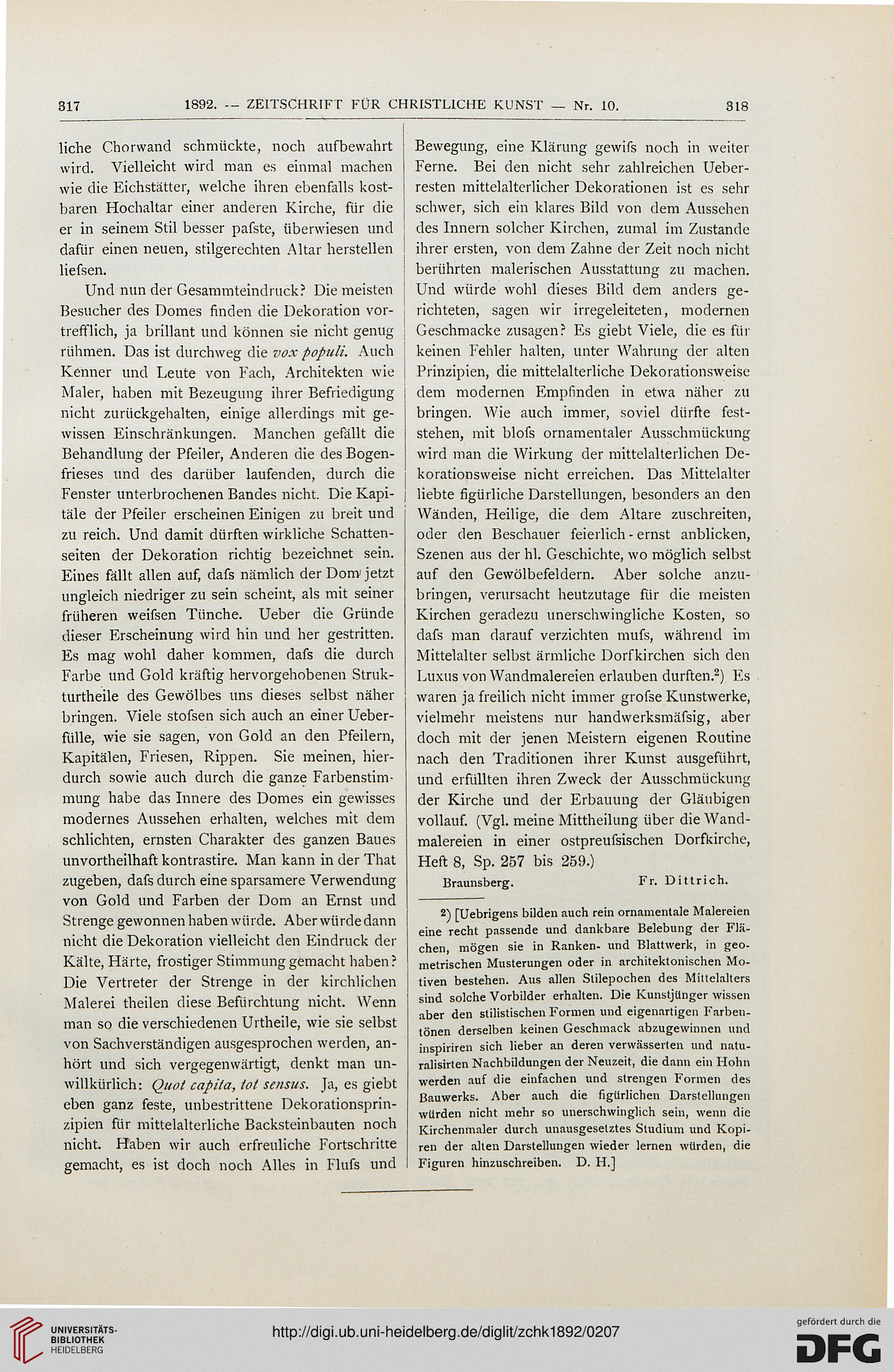317
1892.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
318
liehe Chorvvand schmückte, noch aufbewahrt
wird. Vielleicht wird man es einmal machen
wie die Eichstätter, welche ihren ebenfalls kost-
baren Hochaltar einer anderen Kirche, für die
er in seinem Stil besser pafste, überwiesen und
dafür einen neuen, stilgerechten Altar herstellen
liefsen.
Und nun der Gesammteindruck? Die meisten
Besucher des Domes finden die Dekoration vor-
trefflich, ja brillant und können sie nicht genug
rühmen. Das ist durchweg die vox populi. Auch
Kenner und Leute von Fach, Architekten wie
Maler, haben mit Bezeugung ihrer Befriedigung
nicht zurückgehalten, einige allerdings mit ge-
wissen Einschränkungen. Manchen gefällt die
Behandlung der Pfeiler, Anderen die des Bogen-
frieses und des darüber laufenden, durch die
Fenster unterbrochenen Bandes nicht. Die Kapi-
tale der Pfeiler erscheinen Einigen zu breit und
zu reich. Und damit dürften wirkliche Schatten-
seiten der Dekoration richtig bezeichnet sein.
Eines fällt allen auf, dafs nämlich der Dom jetzt
ungleich niedriger zu sein scheint, als mit seiner
früheren weifsen Tünche. Ueber die Gründe
dieser Erscheinung wird hin und her gestritten.
Es mag wohl daher kommen, dafs die durch
Farbe und Gold kräftig hervorgehobenen Struk-
turtheile des Gewölbes uns dieses selbst näher
bringen. Viele stofsen sich auch an einer Ueber-
fülle, wie sie sagen, von Gold an den Pfeilern,
Kapitalen, Friesen, Rippen. Sie meinen, hier-
durch sowie auch durch die ganze Farbenstim-
mung habe das Innere des Domes ein gewisses
modernes Aussehen erhalten, welches mit dem
schlichten, ernsten Charakter des ganzen Baues
unvortheilhaft kontrastire. Man kann in der That
zugeben, dafs durch eine sparsamere Verwendung
von Gold und Farben der Dom an Ernst und
Strenge gewonnen haben würde. Aber würde dann
nicht die Dekoration vielleicht den Eindruck der
Kälte, Härte, frostiger Stimmung gemacht haben ?
Die Vertreter der Strenge in der kirchlichen
Malerei theilen diese Befürchtung nicht. Wenn
man so die verschiedenen Urtheile, wie sie selbst
von Sachverständigen ausgesprochen werden, an-
hört und sich vergegenwärtigt, denkt man un-
willkürlich: Quot capila, tot sensus. Ja, es giebt
eben ganz feste, unbestrittene Dekorationsprin-
zipien für mittelalterliche Backsteinbauten noch
nicht. Haben wir auch erfreuliche Fortschritte
gemacht, es ist doch noch Alles in Flufs und
Bewegung, eine Klärung gewifs noch in weiter
Ferne. Bei den nicht sehr zahlreichen Ueber-
resten mittelalterlicher Dekorationen ist es sehr
schwer, sich ein klares Bild von dem Aussehen
des Innern solcher Kirchen, zumal im Zustande
ihrer ersten, von dem Zahne der Zeit noch nicht
berührten malerischen Ausstattung zu machen.
Und würde wohl dieses Bild dem anders ge-
richteten, sagen wir irregeleiteten, modernen
Geschmacke zusagen? Es giebt Viele, die es für
keinen Fehler halten, unter Wahrung der alten
Prinzipien, die mittelalterliche Dekorationsweise
dem modernen Empfinden in etwa näher zu
bringen. Wie auch immer, soviel dürfte fest-
stehen, mit blofs ornamentaler Ausschmückung
wird man die Wirkung der mittelalterlichen De-
korationsweise nicht erreichen. Das Mittelalter
liebte figürliche Darstellungen, besonders an den
Wänden, Heilige, die dem Altare zuschreiten,
oder den Beschauer feierlich - ernst anblicken,
Szenen aus der hl. Geschichte, wo möglich selbst
auf den Gewölbefeldern. Aber solche anzu-
bringen, verursacht heutzutage für die meisten
Kirchen geradezu unerschwingliche Kosten, so
dafs man darauf verzichten mufs, während im
Mittelalter selbst ärmliche Dorfkirchen sich den
Luxus von Wandmalereien erlauben durften.2) Es
waren ja freilich nicht immer grofse Kunstwerke,
vielmehr meistens nur handwerksmäfsig, aber
doch mit der jenen Meistern eigenen Routine
nach den Traditionen ihrer Kunst ausgeführt,
und erfüllten ihren Zweck der Ausschmückung
der Kirche und der Erbauung der Gläubigen
vollauf. (Vgl. meine Mittheilung über die Wand-
malereien in einer ostpreufsischen Dorfkirche,
Heft 8, Sp. 257 bis 259.)
Braunsberg. Fr. Dittrich.
2) [Uebrigens bilden auch rein ornamentale Malereien
eine recht passende und dankbare Belebung der Flä-
chen, mögen sie in Ranken- und Blattwerk, in geo-
metrischen Musterungen oder in architektonischen Mo-
tiven bestehen. Aus allen Stilepochen des Mittelalters
sind solche Vorbilder erhalten. Die Kunstjunger wissen
aber den stilistischen Formen und eigenartigen Farben-
tönen derselben keinen Geschmack abzugewinnen und
inspiriren sich lieber an deren verwässerten und natu-
ralisirten Nachbildungen der Neuzeit, die dann ein Hohn
werden auf die einfachen und strengen Formen des
Bauwerks. Aber auch die figürlichen Darstellungen
würden nicht mehr so unerschwinglich sein, wenn die
Kirchenmaler durch unausgesetztes Studium und Kopi-
ren der alten Darstellungen wieder lernen würden, die
Figuren hinzuschreiben. D. H.]
1892.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 10.
318
liehe Chorvvand schmückte, noch aufbewahrt
wird. Vielleicht wird man es einmal machen
wie die Eichstätter, welche ihren ebenfalls kost-
baren Hochaltar einer anderen Kirche, für die
er in seinem Stil besser pafste, überwiesen und
dafür einen neuen, stilgerechten Altar herstellen
liefsen.
Und nun der Gesammteindruck? Die meisten
Besucher des Domes finden die Dekoration vor-
trefflich, ja brillant und können sie nicht genug
rühmen. Das ist durchweg die vox populi. Auch
Kenner und Leute von Fach, Architekten wie
Maler, haben mit Bezeugung ihrer Befriedigung
nicht zurückgehalten, einige allerdings mit ge-
wissen Einschränkungen. Manchen gefällt die
Behandlung der Pfeiler, Anderen die des Bogen-
frieses und des darüber laufenden, durch die
Fenster unterbrochenen Bandes nicht. Die Kapi-
tale der Pfeiler erscheinen Einigen zu breit und
zu reich. Und damit dürften wirkliche Schatten-
seiten der Dekoration richtig bezeichnet sein.
Eines fällt allen auf, dafs nämlich der Dom jetzt
ungleich niedriger zu sein scheint, als mit seiner
früheren weifsen Tünche. Ueber die Gründe
dieser Erscheinung wird hin und her gestritten.
Es mag wohl daher kommen, dafs die durch
Farbe und Gold kräftig hervorgehobenen Struk-
turtheile des Gewölbes uns dieses selbst näher
bringen. Viele stofsen sich auch an einer Ueber-
fülle, wie sie sagen, von Gold an den Pfeilern,
Kapitalen, Friesen, Rippen. Sie meinen, hier-
durch sowie auch durch die ganze Farbenstim-
mung habe das Innere des Domes ein gewisses
modernes Aussehen erhalten, welches mit dem
schlichten, ernsten Charakter des ganzen Baues
unvortheilhaft kontrastire. Man kann in der That
zugeben, dafs durch eine sparsamere Verwendung
von Gold und Farben der Dom an Ernst und
Strenge gewonnen haben würde. Aber würde dann
nicht die Dekoration vielleicht den Eindruck der
Kälte, Härte, frostiger Stimmung gemacht haben ?
Die Vertreter der Strenge in der kirchlichen
Malerei theilen diese Befürchtung nicht. Wenn
man so die verschiedenen Urtheile, wie sie selbst
von Sachverständigen ausgesprochen werden, an-
hört und sich vergegenwärtigt, denkt man un-
willkürlich: Quot capila, tot sensus. Ja, es giebt
eben ganz feste, unbestrittene Dekorationsprin-
zipien für mittelalterliche Backsteinbauten noch
nicht. Haben wir auch erfreuliche Fortschritte
gemacht, es ist doch noch Alles in Flufs und
Bewegung, eine Klärung gewifs noch in weiter
Ferne. Bei den nicht sehr zahlreichen Ueber-
resten mittelalterlicher Dekorationen ist es sehr
schwer, sich ein klares Bild von dem Aussehen
des Innern solcher Kirchen, zumal im Zustande
ihrer ersten, von dem Zahne der Zeit noch nicht
berührten malerischen Ausstattung zu machen.
Und würde wohl dieses Bild dem anders ge-
richteten, sagen wir irregeleiteten, modernen
Geschmacke zusagen? Es giebt Viele, die es für
keinen Fehler halten, unter Wahrung der alten
Prinzipien, die mittelalterliche Dekorationsweise
dem modernen Empfinden in etwa näher zu
bringen. Wie auch immer, soviel dürfte fest-
stehen, mit blofs ornamentaler Ausschmückung
wird man die Wirkung der mittelalterlichen De-
korationsweise nicht erreichen. Das Mittelalter
liebte figürliche Darstellungen, besonders an den
Wänden, Heilige, die dem Altare zuschreiten,
oder den Beschauer feierlich - ernst anblicken,
Szenen aus der hl. Geschichte, wo möglich selbst
auf den Gewölbefeldern. Aber solche anzu-
bringen, verursacht heutzutage für die meisten
Kirchen geradezu unerschwingliche Kosten, so
dafs man darauf verzichten mufs, während im
Mittelalter selbst ärmliche Dorfkirchen sich den
Luxus von Wandmalereien erlauben durften.2) Es
waren ja freilich nicht immer grofse Kunstwerke,
vielmehr meistens nur handwerksmäfsig, aber
doch mit der jenen Meistern eigenen Routine
nach den Traditionen ihrer Kunst ausgeführt,
und erfüllten ihren Zweck der Ausschmückung
der Kirche und der Erbauung der Gläubigen
vollauf. (Vgl. meine Mittheilung über die Wand-
malereien in einer ostpreufsischen Dorfkirche,
Heft 8, Sp. 257 bis 259.)
Braunsberg. Fr. Dittrich.
2) [Uebrigens bilden auch rein ornamentale Malereien
eine recht passende und dankbare Belebung der Flä-
chen, mögen sie in Ranken- und Blattwerk, in geo-
metrischen Musterungen oder in architektonischen Mo-
tiven bestehen. Aus allen Stilepochen des Mittelalters
sind solche Vorbilder erhalten. Die Kunstjunger wissen
aber den stilistischen Formen und eigenartigen Farben-
tönen derselben keinen Geschmack abzugewinnen und
inspiriren sich lieber an deren verwässerten und natu-
ralisirten Nachbildungen der Neuzeit, die dann ein Hohn
werden auf die einfachen und strengen Formen des
Bauwerks. Aber auch die figürlichen Darstellungen
würden nicht mehr so unerschwinglich sein, wenn die
Kirchenmaler durch unausgesetztes Studium und Kopi-
ren der alten Darstellungen wieder lernen würden, die
Figuren hinzuschreiben. D. H.]